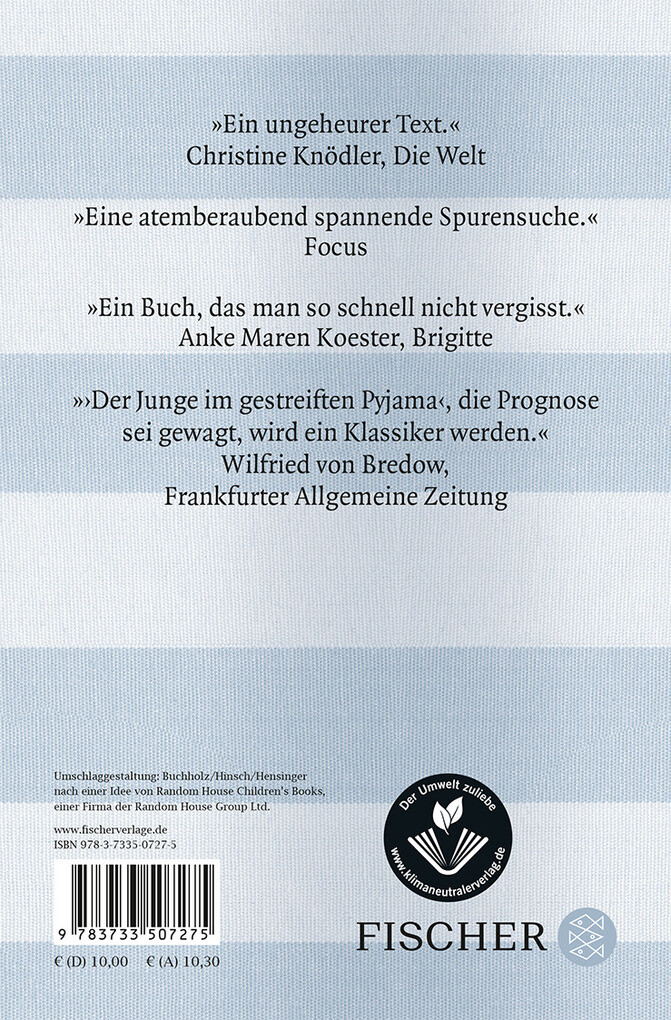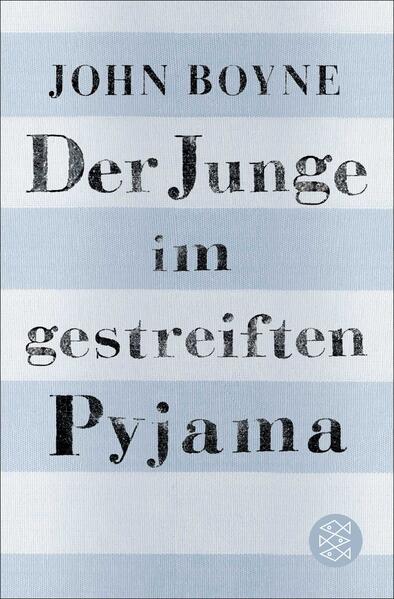
Zustellung: Di, 20.05. - Do, 22.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Die Geschichte von »Der Junge im gestreiften Pyjama« ist schwer zu beschreiben. Normalerweise geben wir an dieser Stelle ein paar Hinweise auf den Inhalt, aber bei diesem Buch - so glauben wir - ist es besser, wenn man vorher nicht weiß, worum es geht. Wer zu lesen beginnt, begibt sich auf eine Reise mit einem neunjährigen Jungen namens Bruno. (Und doch ist es kein Buch für Neunjährige.) Früher oder später kommt er mit Bruno an einen Zaun. Zäune wie dieser existieren auf der ganzen Welt.
Preise und Auszeichnungen für »Der Junge im gestreiften Pyjama«:
- Nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2008 (Jugendjury)
- Buch des Monats Dezember 2007 der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur e. V. , Volkach
- Empfehlungsliste des Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises 2008
- Ausgezeichnet als Penguin Orange Readers' Group Book of the Year 2009
- Ausgezeichnet mit dem Irish Book Award: Bestes Kinderbuch des Jahres
- Ausgezeichnet mit dem Listener's Choice Book of the Year: Bestes Hörbuch des Jahres (UK)
- Nominiert für die Carnegie Medal (UK)
- Nominiert für den Ottakar's Book Prize (UK)
- Nominiert für den Paolo Ungari Prize (Italien)
Produktdetails
Erscheinungsdatum
25. Januar 2023
Sprache
deutsch
Auflage
4. Auflage, Neuausgabe
Seitenanzahl
288
Altersempfehlung
ab 12 Jahre
Autor/Autorin
John Boyne
Übersetzung
Brigitte Jakobeit
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
englisch
Produktart
kartoniert
Gewicht
256 g
Größe (L/B/H)
186/123/24 mm
ISBN
9783733507275
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 08.05.2025
Besprechung vom 08.05.2025
Über das Grauen schreiben
Wie schreibt man für Kinder über den Holocaust? Wie schildert man, wie es zu dem damaligen Grauen kommen konnte? Wie erzählt man sensibel und nicht zu verstörend, aber auch nicht beschönigend von den Opfern? Und wie von den Tätern?
Dass diese Aufgabe schwer ist, steht fest. Die allermeisten Kinderbuchautoren, die über die Zeit des Nationalsozialismus schreiben, berichten davon anhand einer Geschichte, anhand von fiktiven oder realen Charakteren, anhand von Kindern, die die damalige Zeit erlebt haben.
Judith Kerr etwa ist es mit "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" eindrücklich gelungen, von der Flucht einer jüdischen Familie aus Nazideutschland zu berichten. Mirjam Presslers Roman "Malka Mai" schildert, was Vertreibung mit einem Kind anrichtet. Ein Welterfolg wurde "Der Junge im gestreiften Pyjama" des irischen Schriftstellers John Boyne: Aus der Sicht eines naiven Kindes, dem Sohn des Lagerkommandanten, erzählt er vom Horror in Auschwitz.
Die chilenische Autorin und Zeichnerin Carla Infanta Gabor, geboren im Jahr 1974, ist einen anderen Weg gegangen: Ihr Buch "Nicht sehr lang her, nicht sehr weit weg" ist ein illustriertes Sachbuch für Kinder von zehn Jahren an, das zusammenfassend und präzise die Entwicklungen nachzeichnet, die in der Vernichtung von Millionen europäischer Juden mündeten. In dem von Ilse Layer übersetzten Band (19,90 Euro, erschienen bei Fischer Sauerländer) beschreibt sie, wie der Antisemitismus sich in Europa verbreiten konnte, wie die Nazis die wirtschaftliche Not nutzen konnten, um Anhänger für sich zu gewinnen, wie die Juden nach und nach entrechtet wurden, wie ihre Vernichtung geplant und organisiert wurde.
Man erfährt, wer Adolf Hitler und seine Verbündeten waren, man liest, wie der Überlebende Primo Levi den Hass der Nazis beschrieben hat, und auch davon, wie diejenigen, die den Holocaust überlebten, sich nach dem Kriegsende nach Palästina oder Nordamerika aufmachten. Klar, niemals ausschweifend und von dunklen, beeindruckenden Zeichnungen und Infografiken flankiert schildert die Autorin die Geschehnisse.
Auf die Idee zu ihrem Buch ist Carla Infanta Gabor gekommen, als sie selbst vor einigen Jahren mit ihren elf und zwölf Jahre alten Kindern über den Holocaust sprechen wollte. Damals konnte sie kein geeignetes Buch finden, um dessen Ursprünge, Entwicklung und Folgen zu erklären - und beschloss, sich selbst daran zu versuchen. Bei ihrer Arbeit wurde die Autorin von Fachleuten wie dem britischen Historiker Richard Overy oder Beate Wenker, einer Kuratorin des Jüdischen Museums in Chile, unterstützt. Dass ihr das Thema am Herzen liegt, hängt auch mit ihrer eigenen Familiengeschichte zusammen: Ihre Großeltern mütterlicherseits sind 1939 aus der heutigen Ukraine vor den Nazis nach Chile geflohen.
"Nicht sehr lang her, nicht sehr weit weg" ist ein besonderes Kinderbuch über den Holocaust, weil es ganz einfach und sehr sachlich von der Nazi-Zeit erzählt und einen trotzdem stark berührt und mitnimmt. Spannend ist es auch für erwachsene Menschen. Und sicherlich werden bei den Kindern beim Lesen noch viele weitere Fragen auftauchen. Am besten ist es deshalb, das Buch gemeinsam in der Familie zu lesen. ALEXANDER JÜRGS
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 12.04.2025
Eine Emotionale Geschichte aus der Sicht eines neun Jährigen Jungen
Ich finde den Schreibstil vom Autor sehr gut, die Geschichte finde ich auch echt gelungen. Die Geschichte wird durch die Sicht eines Kindes ( eines Jungen) erzählt, was es natürlich ein bisschen einfacher macht. Den wir wissen Kinder sehen vieles anders als Erwachsene, es wird aus der Sicht von einem neun Jährigen erzählt. Ich weiß es ist nicht eine leichte und einfache Geschichte und was passiert ist kann man auch nicht schön reden, es hat mich einfach fasziniert und ich habe es sehr gerne gelesen.
LovelyBooks-Bewertung am 13.03.2025
Schwierig, realitätsfern und eine Beleidigung für die Opfer