Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale
NEU: Das Hugendubel Hörbuch Abo - jederzeit, überall, für nur 7,95 € monatlich!
Jetzt entdecken
mehr erfahren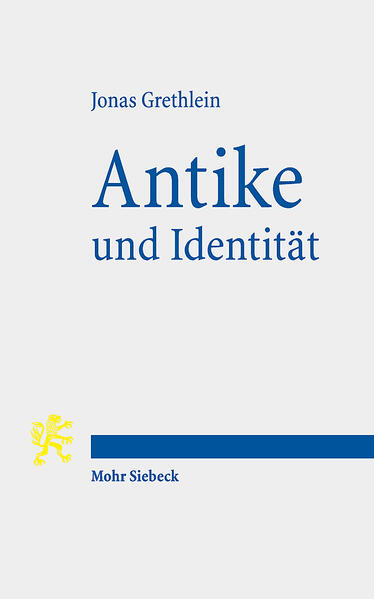
Zustellung: Di, 02.09. - Do, 04.09.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Welche Bedeutung hat die Antike heute? Liegen in ihr die Wurzeln unserer kulturellen Identität oder müssen die Altertumswissenschaften identitätspolitisch reformiert werden? Der Heidelberger Gräzist Jonas Grethlein zeigt die Fallstricke des Identitätskonzepts auf beiden Seiten und überlegt, wie sich das griechisch-römische Altertum für die Gegenwart erschließen läßt.
Forderungen nach Dekolonialisierung haben in den Altertumswissenschaften zuletzt eine heftige Debatte über den Platz der griechisch-römischen Antike in der Geschichte und Gegenwart ausgelöst. Jonas Grethlein zeichnet hier diese Debatte nach und entwickelt eine eigene Position. Den Advokaten der Identitätspolitik, die eine kritische Revision der Geschichte der Altertumswissenschaften und des Kanons fordern, stehen konservative Fachvertreter gegenüber, die im griechisch-römischen Altertum die Wurzeln unserer kulturellen Identität sehen. In beiden Fällen erweist sich die Kategorie der Identität als problematisch - sie verkürzt entweder den Zugriff auf die Antike narzisstisch oder überstrapaziert sie normativ. Auch Uvo Hölschers Formel des 'nächsten Fremden' kann in einer globalisierten Welt die Beschäftigung mit der Antike nicht mehr rechtfertigen - es gibt viele andere vergangene und gegenwärtige Kulturen, die uns neue Perspektiven auf die Gegenwart eröffnen können. Es ist eine zentrale Herausforderung für die Altertumswissenschaften, die Hinterlassenschaft der Antike für die Gegenwart fruchtbar zu machen. Auch wenn griechische und lateinische Texte keinen besonderen Status mehr beanspruchen können, bietet ihre Reflexivität vielfältige Ansatzpunkte für die Auseinandersetzung.
Inhaltsverzeichnis
1. Wissenschaft zwischen Fakten und Identitäten
2. Die Kontroverse in Classics
2. 1. Hintergründe
2. 2. Ein neues Verständnis von Wissenschaft?
2. 3. Die blinden Flecke der Identitätspolitik
2. 4. Der Preis des vergessenen Historismus
3. Die Antike, , das nächste Fremde' ?
4. Reflexivität und Rezeption
2. Die Kontroverse in Classics
2. 1. Hintergründe
2. 2. Ein neues Verständnis von Wissenschaft?
2. 3. Die blinden Flecke der Identitätspolitik
2. 4. Der Preis des vergessenen Historismus
3. Die Antike, , das nächste Fremde' ?
4. Reflexivität und Rezeption
Produktdetails
Erscheinungsdatum
17. November 2022
Sprache
deutsch
Untertitel
Die Herausforderungen der Altertumswissenschaften.
Seitenanzahl
94
Autor/Autorin
Jonas Grethlein
Verlag/Hersteller
Originalsprache
deutsch
Produktart
kartoniert
Gewicht
101 g
Größe (L/B/H)
185/116/10 mm
ISBN
9783161618529
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Antike und Identität" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









