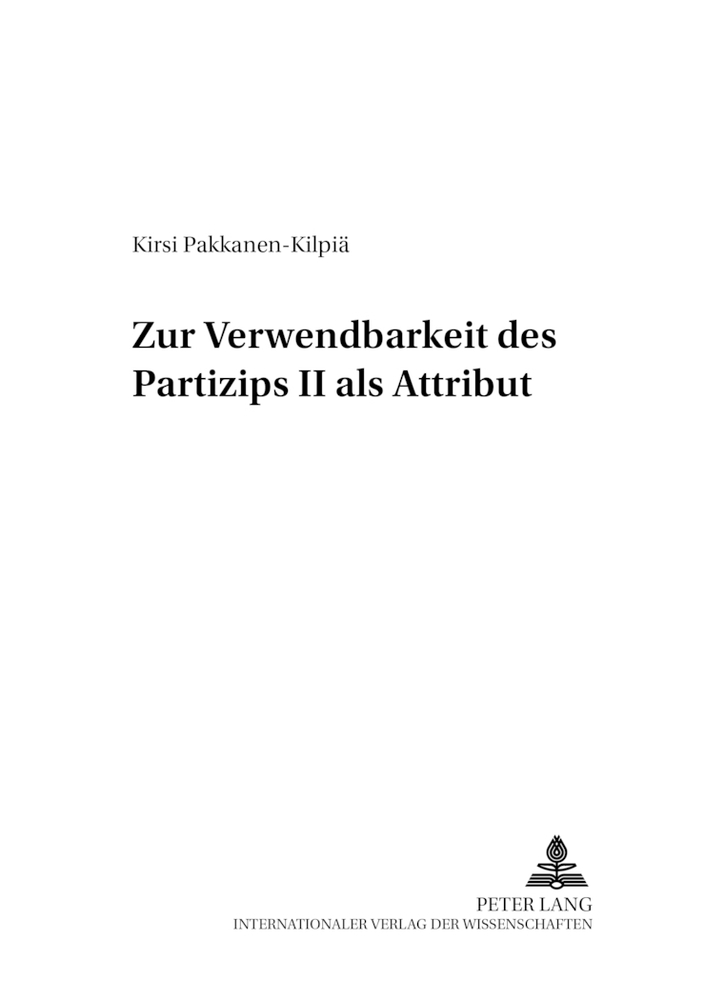
Zustellung: Sa, 24.05. - Di, 27.05.
Versand in 4 Tagen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
In der einschlägigen Literatur wird die Verwendbarkeit des Partizips II als Attribut mit den zentralsten Erscheinungen der Verbsyntax in Verbindung gebracht. Die grammatische Tradition zieht als hauptsächliche Attribuierbarkeitskriterien die Passivierbarkeit und die Auxiliarselektion heran. In der Forschungsliteratur finden sich gelegentlich auch andere Anhaltspunkte. Die Arbeit stellt sich die Aufgabe, verschiedene Auffassungen zu diesem Thema vorzustellen und mithilfe von Textmassen empirisch zu überprüfen. Der thematische Schwerpunkt liegt auf dem attributiven Gebrauch des zweiten Partizips, wegen des engen Zusammenhangs wird aber zugleich auch das PII in verschiedenen periphrastischen Verbformen (werden-Passiv, sein-Passiv, sein-Reflexiv) in Betracht gezogen. Problematisiert werden dabei u. a. die semantisch bedingte Klassifizierung der passivischen Gefüge und die Diskrepanzen zwischen Regelformulierungen einerseits und authentischem Sprachgebrauch andererseits.
Inhaltsverzeichnis
Aus dem Inhalt: Zur Korrelation der Passivierbarkeit mit der PII-Attribuierbarkeit - Zu den Restriktionen für die Bildbarkeit des Vorgangspassivs - Zu den Restriktionen für die Bildbarkeit des Zustandspassivs - Zur Dreiteilung Vorgangspassiv - Zustandspassiv - Allgemeine Zustandsform in Helbig/Buscha (2001) - Zur Korrelation des attributiven Partizips II mit den sogenannten Ergativitätsmerkmalen - Zur Korrelation der Bildbarkeit des Zustandsreflexivs mit der Attribuierbarkeit des Partizips II - PII-Attribute außerhalb des Ableitungsschemas von Helbig/Buscha (2001) - «Unerlaubte» PII-Attribute.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
20. Januar 2004
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
276
Reihe
Finnische Beiträge zur Germanistik
Autor/Autorin
Kirsi Pakkanen-Kilpiä
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
370 g
Größe (L/B/H)
15/148/210 mm
ISBN
9783631521588
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Zur Verwendbarkeit des Partizips II als Attribut" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









