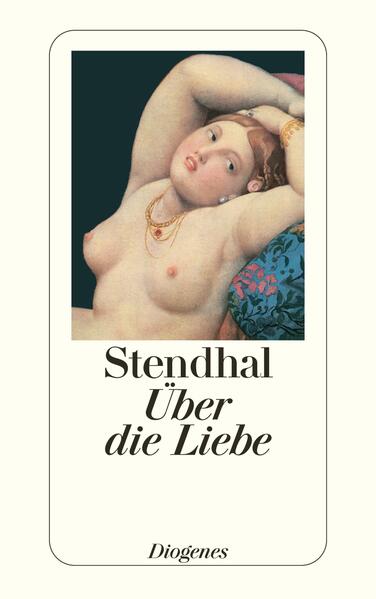
Zustellung: Sa, 31.05. - Mi, 04.06.
Versand in 3 Wochen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Als Stendhal die Liebe und ihre Geheimnisse ergründen wollte, war er ein Verletzter. Der Grund: seine unerwiderte Liebe zu Mathilde Dembowskij. Stendhal wußte, daß es ihm nicht gelingen würde, seine Seelenwunden zu vergessen oder zu überwinden, um die Liebe aus rein analytischer Sicht betrachten zu können. Und so ist in diesem großen Essay über die Liebe seine innere Zerrissenheit durchwegs präsent, ja angelegt: Da ist einerseits die Stimme der Vernunft, die uns klar begreifen läßt, warum wir leiden. Aber da ist auch das andere, das raunt und fleht. . . Was am Ende siegt? Wie immer - es ist, trotz allem, die Unvernunft der Liebe!
Produktdetails
Erscheinungsdatum
25. Januar 2002
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
448
Reihe
detebe
Autor/Autorin
Stendhal
Übersetzung
Franz Hessel
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
französisch
Produktart
kartoniert
Gewicht
327 g
Größe (L/B/H)
180/113/181 mm
ISBN
9783257209679
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Der Gegensatz zwischen Stendhal und Henry Miller ist nur ein Scheingegensatz. Sie gehören zusammen. « Alfred Andersch
Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 08.10.2012
Liebeskummer treibt bisweilen seltsame Blüten. Marie-Henri Beyle, genannt Stendhal etwa, trieb sie dazu, seine Überlegungen und Beobachtungen zur Liebe zu Papier zu bringen: Er hatte sich 1814 unsterblich in die Bankierstochter Mathilde Dembowski verliebt, eine selbstbewusste junge Frau, die zwar offiziell noch verheiratet war, aber seit vier Jahren von ihrem Mann getrennt lebte. Leider erwiderte sie diese Liebe nicht. Die Jahre der fortgesetzten Werbung und Ablehnung wurden zu Stendhals großem Trauma, das er ab dem Jahr 1819 versuchte, mit einem groß angelegten Essay über die Liebe, zu verarbeiten.
Das Buch brachte ihm kein Glück. Stendhal selbst sagt, das Buch habe in ca. 20 Jahren ¿kaum hundert Leser¿ gefunden. Immerhin vier Versuche machte er, mit neuen Ausgaben die Verbreitung zu fördern. Jedes Mal fügte er dem Werk eine neue Vorrede hinzu, mit der er das Desaster aus seiner Sicht zu erklären versuchte. Darin macht er sehr deutlich, dass dieses Buch nur für einen bestimmten Schlag Menschen überhaupt verständlich sein könne und der Rest der Leser sich notwendig zu Recht darüber aufrege. Das klingt nach Apologie, nach Selbstverteidigung, ein wenig peinlich nach Rechtfertigung. Und war wahrscheinlich wenig dazu angetan, neue Leser neugierig zu machen.
Der Erfolg kam erst deutlich später, im Fin de Siècle. Der französische Philosoph, Historiker und Kritiker Hippolyte Taine entdeckte Stendhal neu. Er schätzte dessen unverfälschten, unprosaischen Stil, der ganz natürlich aufs Papier zu fließen schien und damit eine Frische und extreme Ehrlichkeit mit sich brachte, die für die Zeit neu war. Taine, der sich auch auf dem Gebiet der historischen Psychologie behauptete, rückte Stendhal so ins Zentrum einer Zeit, die ohnehin stark um sich selbst kreiste. Autoren wie Marcel Proust oder Maurice Barrès entdeckten ihn für sich.
Ohnehin hatte Stendhal sich inzwischen durch seine Romane ¿Rot und Schwarz¿ und ¿Die Kartause von Parma¿ einen Namen gemacht, so dass nun auch sein Essay ¿Über die Liebe¿ mit anderen Augen gesehen wurde. Die Begeisterung für Stendhal wirkt bis in die Gegenwart nach. Serge Gainsbourg zitierte Stendhal in ¿Anna¿ ebenso wie Eric Rohmer in ¿Pauline am Strand¿. Wobei es heute zumeist das Bild der Kristallisation ist, das sich mit Stendhal verbindet.
Diesen Ausdruck hat Stendhal ursprünglich geprägt, und er ist anfangs stark dafür angefeindet worden. Es geht zurück auf das Bild vom ¿Salzburger Zweig¿, das im Anhang an den Essay in dem vom Fischer TB Verlag jetzt neu veröffentlichten Band mit abgedruckt ist: ¿In den Salzbergwerken von Hallein bei Salzburg werfen die Bergleute in die verlassenen Gruben einen vom Winter entblätterten Baumzweig; zwei oder drei Monate später finden sie ihn durch die Einwirkung der salzhaltigen Wasser, die den Zweig tränken und dann im Versickern trocknen lassen, ganz bedeckt mit schimmernden Kristallisationen. [...] Man kann den ursprünglichen Zweig nicht mehr erkennen; es ist ein Kinderspielzeug, reizend anzusehen.¿
Letztlich dürfte es sich bei der Kristallisation um nichts anderes handeln als das, was Jahre später von Freud als Projektion bezeichnet wurde. Stendhal betont immer wieder, dass gerade in der Abwesenheit des Liebesobjekts diese Kristallisation sich vollzieht; d.h., dass unser Gegenüber für uns mit Wert überzogen wird, nicht durch seinen wahren Charakter, sondern durch die Eigenschaften, die wir ihm in Abwesenheit andichten. Brecht hat das im ¿Herrn K.¿ einmal so ausgedrückt: ¿Wenn ich einen Menschen liebe, mache ich einen Entwurf von ihm und sorge, dass er ihm ähnlich wird.¿ - ¿Wer, der Entwurf?¿ - ¿Nein¿, sagte Herr K., ¿Der Mensch.¿
Im ersten Band seines zweibändigen Werks widmet sich Stendhal sehr ausführlich dieser Kristallisation, wenn auch aus seiner damaligen, sehr praxisorientierten Sicht, deskriptiv. Er versucht die Phänomene der Liebe, von ihrer Entstehung über die Intimität bis hin zu Eifersucht und Streitliebe, zu kategorisieren. Das war damals gerade Mode. Wissenschaftlich zu arbeiten bedeutete zu seiner Zeit in erster Linie, die Dinge, die man in der Natur entdeckte, zu klassifizieren. Und so beginnt auch Stendhal damit, vier Arten der Liebe voneinander zu trennen und gegeneinander abzugrenzen: die leidenschaftliche, die galante, die sinnliche und die Liebe aus Eitelkeit.
Der zweite Band enthält hingegen eher regionale Beobachtungen, ist aber ansonsten deutlich weniger strukturiert. Besonders erwähnenswert hier die Gegenüberstellung von Don Juan und Werther in Kapitel 59, allein weil er hier die Liebe des gelangweilten Draufgängers gegen die eigene Erfahrung mit seiner Méthilde setzt, ohne sie namentlich zu erwähnen. Seine Solidarität mit dem schmachtenden Werther ist unübersehbar. Es ist die ¿Seligkeit eines Schülers, der ein Trauerspiel schreibt, nur tausendmal stärker.¿ Auf die Frage, wie aus einer Verliebtheit eine reife, langjährige Liebe werden kann, hat allerdings auch Stendhal keine Antwort.
¿Über die Liebe¿ ist zum schnellen Genuss völlig ungeeignet. Meine Versuche, den Text zunächst einmal komplett zu lesen, um mich dann en détail noch einmal näher mit den einzelnen Abschnitten zu beschäftigen, ist grandios gescheitert. Wir leben deutlich in einer Zeit nach Freud. Unser Bild der Liebe ist anders geprägt. So war ich bei jedem Absatz, den ich las, versucht, das eben Gelesene zu übersetzen und mit eigenen Erfahrungen zu füllen. Dazu kommt, dass Stendhal sehr belesen war. Ständig zitiert er Zeitgenossen und frühere Autoren, wobei ihm Andeutungen offensichtlich häufig genügten, um ein bestimmtes Bild entstehen zu lassen. Um aber wirklich zu erfassen, was Stendhal da von sich gibt, wäre eine begleitende Lektüre eben dieser Autoren unerlässlich.
So ist der Band ¿Über die Liebe¿ eher Einstiegstor in eine Zeitreise, als ein Werk, das für sich stehend dem Phänomen Liebe gerecht würde. Lesenswert allein schon, um der Idee der Kristallisation mehr Zeit zu widmen, ansonsten aber eher Ausgangspunkt für eine eigene Suche, noch völlig unbefleckt von Psychoanalyse, Hirnforschung und ähnlichen Disziplinen, die heute für das Verständnis der Attraktion eine zentrale Rolle spielen. Wer einen historischen Überblick gewinnen will, kommt mit Stendhal weit, sollte aber unbedingt Zeit einplanen und die Lust, eben nicht nur ihn, sondern eine ganze Bibliothek an Autoren kennenzulernen, die sich mit diesem Phänomen auseinandergesetzt haben.









