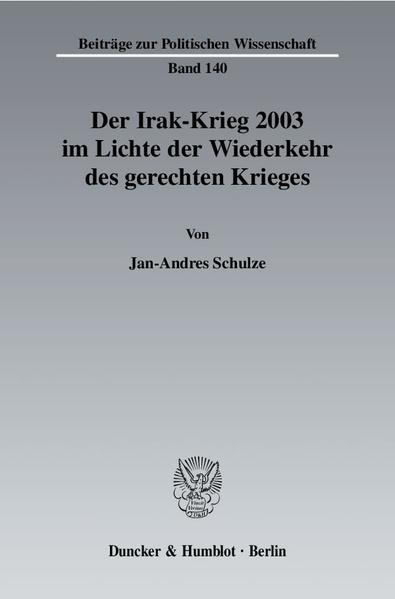
Zustellung: Do, 07.08. - Mo, 11.08.
Versand in 3 Wochen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Der "gerechte Krieg" und seine widersprüchliche Bewertung - hochaktuelles wie klassisches Thema der Politischen Theorie - stehen im Mittelpunkt der vorliegenden Studie. Jan-Andres Schulze zieht bei der Frage nach der Legalität bzw. Legitimität des Vorgehens der USA gegen den Irak 2003 die bedeutendsten historischen und zeitgenössischen Theoretiker der Lehre des "gerechten Krieges" heran. Als Hauptzeuge dient ihm insbesondere der spanische Spätscholastiker Francisco de Vitoria, der als Begründer des Völkerrechts gilt. Denn viele Indizien und gemeinsame "Meta-Bedingungen" sprechen dafür, daß die Kriege im zivilisatorischen Altersstadium der Staaten eindrucksvolle Parallelen zu den Kriegen der fünfhundert Jahre zurückliegenden Entstehungsphase der Staaten - die Zeit Franciso de Vitorias - aufweisen.
Der Autor wendet die klassischen Rechtfertigungsgründe des "gerechten Krieges" auf die "Operation Iraqi Freedom" an. Dabei wird u. a. die historische und strukturelle Parallelität zwischen dem Verhältnis der Vereinten Nationen und den USA einerseits und den Universalmächten zu Zeiten der Conquista andererseits diskutiert. Angesichts der Wiederkehr illegaler Kombattanten und des Söldnerwesens untersucht der Autor, ob die aus der spanischen Epoche des Völkerrechts entnommene religiös-honorable Komponente eine ähnlich begrenzende Wirkung auf die Kriegführung zukünftiger Konflikte haben könnte, wie dies bereits im französischen Völkerrechtszeitalter der Kabinettskriege der Fall gewesen ist.
Fazit: Die erarbeiteten Vergleichsschemata von Irak-Krieg und spanischer Conquista erlauben eine einordnende Bewertung der "Operation Iraqi Freedom", die wie die Conquista hinter den völkerrechtlichen bzw. theologischen Normierungen und Forderungen zurückbleibt. Abschließend diskutiert Jan-Andres Schulze die Chancen einer Lehre vom gerechten Krieg für die Gegenwart.
Der Autor wendet die klassischen Rechtfertigungsgründe des "gerechten Krieges" auf die "Operation Iraqi Freedom" an. Dabei wird u. a. die historische und strukturelle Parallelität zwischen dem Verhältnis der Vereinten Nationen und den USA einerseits und den Universalmächten zu Zeiten der Conquista andererseits diskutiert. Angesichts der Wiederkehr illegaler Kombattanten und des Söldnerwesens untersucht der Autor, ob die aus der spanischen Epoche des Völkerrechts entnommene religiös-honorable Komponente eine ähnlich begrenzende Wirkung auf die Kriegführung zukünftiger Konflikte haben könnte, wie dies bereits im französischen Völkerrechtszeitalter der Kabinettskriege der Fall gewesen ist.
Fazit: Die erarbeiteten Vergleichsschemata von Irak-Krieg und spanischer Conquista erlauben eine einordnende Bewertung der "Operation Iraqi Freedom", die wie die Conquista hinter den völkerrechtlichen bzw. theologischen Normierungen und Forderungen zurückbleibt. Abschließend diskutiert Jan-Andres Schulze die Chancen einer Lehre vom gerechten Krieg für die Gegenwart.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsübersicht: 1. Prolog: Der Analyserahmen des Irak-Krieges 2003 - Bedeutende Theoretiker der Lehre des gerechten Krieges (Cicero, Augustinus, Aquin) - "Prima Cathedra de Salamanca": Francisco de Vitoria - Zeitgenössische Kritiker und Erneuerer der Lehre des gerechten Krieges (Carl Schmitt, Michael Walzer) - 2. "Ius ad bellum" - das Recht zum Krieg: "Legitima auctoritas": Die Berechtigung zur Kriegführung - "Iusta causa": Gerechte Gründe und Rechtstitel - "Recta intentio": Die Wiederherstellung einer gerechten Ordnung - 3. "Ius in bello" - Periodizität und Interdependenzen der Kriegführung: Wiederkehr und Symbiose "illegaler Kombattanten" - Die Bekämpfung der "hostes generis humani" - Interdependenz von Kriegführung und Kriegsbegründung - Der Standpunkt der Theorie des gerechten Krieges - 4. Hegung des Krieges - eine Frage der Ehre?: Ritterliche Ehre und Kriegführung - Hegung in der Epoche des gerechten Feindes - Ehre als normatives Moment soldatischen Handelns - 5. Epilog oder die Zukunft des gerechten Krieges: Die Lehre Francisco de Vitorias in der Gegenwart - Der Irak-Krieg und die Chancen einer Theorie des gerechten Krieges - Literaturverzeichnis - Personenverzeichnis - Sachwortverzeichnis
Produktdetails
Erscheinungsdatum
04. Oktober 2005
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
210
Reihe
Beiträge zur Politischen Wissenschaft
Autor/Autorin
Jan-Andres Schulze
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Abbildungen
210 S.
Gewicht
288 g
ISBN
9783428118960
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
"Schon die Nato-Intervention im Kosovo 1999 ist in der Politik- und Völkerrechtswissenschaft als fragwürdiger Präzedenzfall angesehen worden, der das spätestens mit dem Westfälischen Frieden von 1648 endgültig verabschiedet geglaubte Konzept des gerechten Krieges hat wiederaufleben lassen. Und nun die 'Operation Iraqui Freedom'? Jan-Andres Schulze unternimmt den gedanklich reizvollen und trotz aller Unterschiede in der historisch-politischen Situation angesichts der Kriegsrhetorik des amerikanischen Präsidenten nicht völlig abwegigen Versuch, das Vorgehen der Vereinigten Staaten und der 'Koalition der Willigen' gegen den Irak 2003 mit der spanischen Conquista des 16. Jahrhunderts zu vergleichen und deren Legitimität am Maßstab der in der spanischen Spätscholastik, insbesondere durch Francisco de Vitoria, voll entfalteten Lehre vom gerechten Krieg zu prüfen. Er fragt daher in einem kontrastierenden Vergleich des spanischen Zeitalters mit der Ära der Vereinten Nationen nach der legitima auctoritas, der iusta causa und der recta intentio. Durften die Vereinigten Staaten ohne Ermächtigung des Sicherheitsrates Krieg führen? Waren die von ihnen angeführten Gründe valid, und darf demokratisches Sendungsbewußtsein als rechte Absicht gelten?
Gerade die Überzeugung von der eigenen moralischen Überlegenheit birgt, wie Schulze zeigt, die Gefahr einer Illegalisierung der als hostes generi humani bekämpften Feinde: Die moralische Kriegsbegründung führt zur unmoralischen Kriegführung. Die scholastische Lehre vom gerechten Krieg wandte sich gerade gegen den kreuzzugartigen Charakter der Conquista. Auch im gerechten Krieg sollte der 'gerechten Seite' nicht jedes Mittel erlaubt sein. Mag 'auf den ersten Blick der Kampf um die Übertragung des christlichen Glaubens auf die Indianer mit der weltweiten Durchsetzung der individualistischen Konzeption der Menschenrechte vergleichbar' sein, so verbietet sich doch eine 'Umdeutung der Lehre Vitorias zu einem die Gegenwart spiegelnden
, formal-säkularen Rechtsordnungsentwurf universaler Menschenrechte'. Tatsächlich, dies ist das Fazit der anregenden, wenn auch etwas feuilletonistisch geratenen Studie, bedroht nicht die Theorie des gerechten Krieges den Weltfrieden, sondern die Wiederkehr derjenigen Determinanten von Krieg und Kriegführung, die eine solche Theorie erst nötig machten." Christian Hillgruber, in: FAZ, 21.2.2006
Gerade die Überzeugung von der eigenen moralischen Überlegenheit birgt, wie Schulze zeigt, die Gefahr einer Illegalisierung der als hostes generi humani bekämpften Feinde: Die moralische Kriegsbegründung führt zur unmoralischen Kriegführung. Die scholastische Lehre vom gerechten Krieg wandte sich gerade gegen den kreuzzugartigen Charakter der Conquista. Auch im gerechten Krieg sollte der 'gerechten Seite' nicht jedes Mittel erlaubt sein. Mag 'auf den ersten Blick der Kampf um die Übertragung des christlichen Glaubens auf die Indianer mit der weltweiten Durchsetzung der individualistischen Konzeption der Menschenrechte vergleichbar' sein, so verbietet sich doch eine 'Umdeutung der Lehre Vitorias zu einem die Gegenwart spiegelnden
, formal-säkularen Rechtsordnungsentwurf universaler Menschenrechte'. Tatsächlich, dies ist das Fazit der anregenden, wenn auch etwas feuilletonistisch geratenen Studie, bedroht nicht die Theorie des gerechten Krieges den Weltfrieden, sondern die Wiederkehr derjenigen Determinanten von Krieg und Kriegführung, die eine solche Theorie erst nötig machten." Christian Hillgruber, in: FAZ, 21.2.2006
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Der Irak-Krieg 2003 im Lichte der Wiederkehr des gerechten Krieges." und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









