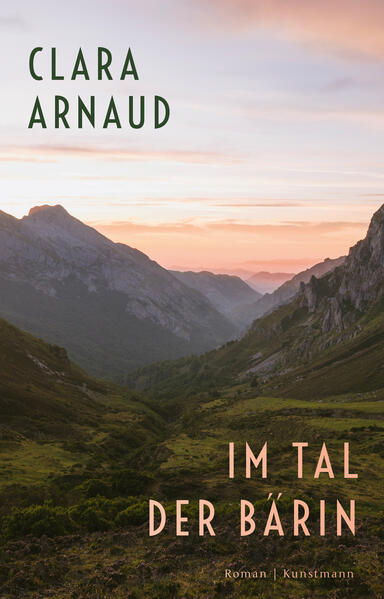Besprechung vom 28.06.2025
Besprechung vom 28.06.2025
Tödliche Umarmung am Berg der Seelen
Zwischen Nature Writing und Wildtier-Debatten ein aktueller Roman: Clara Arnaud erzählt vom widersprüchlichen Verhältnis des Menschen zum Bären
"Um dort oben zu bestehen, musst du die bösen Geister loswerden", gibt der alte Schäfer Jean seinem jungen Nachfolger Gaspard mit auf den Weg, bevor dieser sich mit einer Herde von 800 Schafen zum Almauftrieb in die abgeschiedenen Höhen der Pyrenäen begibt. Die bösen Geister plagen Gaspard, seit er im Jahr zuvor nicht nur Dutzende Tiere, sondern auch eine so lebensfrohe wie unerschrockene Kollegin in den Bergen verlor. Im "Tal der Bärin", so der Titel von Clara Arnauds Roman, der in einer besonders spärlich besiedelten Ecke des Départements Ariège unweit der Grenze zu Spanien angesiedelt ist, spricht man höchstens in Andeutungen über das, was doch alle zu wissen glauben: Am tödlichen Absturz der Schäferin kann nur das Tier schuld sein, das die Phantasie, Träume und Ängste der Bergbewohner beflügelt wie kaum ein anderes und den Alteingesessenen gar als "Seele der Berge" gilt.
Die 1986 geborene Reisejournalistin Clara Arnaud reiht sich mit ihrem vierten Roman (dem ersten ins Deutsche übersetzten) in eine Erzähltradition ein, denn nicht nur in der realen Bergwelt, auch in der Literatur ist der Bär ein über die Zeiten überaus beliebtes Motiv. Über die "Nackte von Vicdessos" (ebenfalls im Ariège) etwa, eine Adlige, die auf der Flucht vor der Guillotine in der Einsamkeit der Bergwelt überfallen und beraubt worden sein und schließlich jahrelang unbekleidet unter Bären gelebt haben soll, existieren nicht nur amtliche Aufzeichnungen des zuständigen Unterpräfekten von 1814, sondern auch eine Unzahl an mal lüsternen, mal mystifizierenden, mal Urängste schürenden Fiktionalisierungen. Bis heute ist der Bär neben dem Wolf als Symbol für ehrfurchtgebietende Naturgewalten und die Unterwanderung zivilisatorischer Ordnungshierarchien eine mystisch aufgeladene Gestalt des sogenannten Nature Writing. Sylvain Tessons reichlich gefühliges "Tagebuch aus der Einsamkeit" am sibirischen Baikalsee oder auch Matteo Righettos Roman "Das Fell des Bären" - eine nicht weniger salbungsvolle Geschichte über eine Bärenjagd, die zur seelenerschütternden Selbsterfahrung von Vater und Sohn gerät - wurden zu internationalen Bestsellern.
Auch Clara Arnaud erzählt über die Begegnung des Menschen mit Bären, genauer gesagt von Faszination und Abstoßung, die Jäger, Schäfer, Züchter, Ökologen und Verhaltensforscher gegenüber einer Bärin empfinden, die im Höhenweidegebiet des Ariège ihr Unwesen treibt. Unwesen? Während den Schäfer Gaspard die Angst um sein Leben und das seiner Tiere um den Schlaf bringt, ist die junge Ethologin Alma überzeugt, dass der Mensch nur verlernt habe, mit Wildtieren zusammenzuleben: "Diese Bärin war eine Königin, und Alma gefiel die Vorstellung, in ihrem Reich zu leben." Der Dorfbevölkerung im Tal gilt Alma derweil als abgehobene Intellektuelle, die "nie von hier sein wird", weil sie als Frau aus der Wissenschaft, die schlicht keine Ahnung habe, wie es in der unerbittlichen Bergwelt zugeht, eben nicht verstehe, dass man das Tier - das bis dahin noch niemand zu Gesicht bekam - schon "längst hätte abknallen müssen".
Die Gemengelage, die Clara Arnaud aus wechselnden Perspektiven in einer stimmig austarierten Konstellation von atmosphärischen Naturbeschreibungen, Figuren- und Milieucharakterisierungen und naturkundlicher Unterfütterung beschreibt, erinnert das deutsche Lesepublikum unweigerlich an den begriffsbildenden Problembären. Als seit 170 Jahren erster in Deutschland in freier Wildbahn gesichteter Braunbär wurde Bruno nach zahlreichen Schafsrissen und einer geradezu irrwitzig erratischen Debatte 2006 bei Bayrischzell erlegt. Dass Clara Arnauds Geschichte mehr ist als eine literarische Aufbereitung anekdotischer Reibungspunkte zwischen Zivilisation und Wildnis, führt die Erinnerung an den sechsundzwanzigjährigen Jogger vor Augen, den Brunos Schwester 2023 in der Provinz Trient anfiel und tötete.
Arnaud bietet in ihrer Geschichte glücklicherweise keine fertigen Lösungen zum Umgang mit dem für Menschen potentiell gefährlichsten in Europa lebenden Wildtier an. Stattdessen lässt sie in der Abgeschiedenheit der Bergwelt die unterschiedlichen Reaktionen auf den Konflikt zwischen natürlichen Abläufen und zivilisatorischen Erfordernissen wie unter einem Brennglas aufeinanderprallen. Auch die Einsamkeit selbst spielt immer wieder eine Rolle in der sich langsam, aber kontinuierlich zuspitzenden Handlungsdynamik, die schließlich in ein "kollektives Scheitern" mündet. Gerade diejenigen, die meinen, in der Einsamkeit der alltäglichen Unbill der Zivilisation und den eigenen Dämonen entfliehen zu können, belehren die Millionen Jahre alten Konturen und natürlichen Kreisläufe der Pyrenäen eines Besseren. Während die einen der Isolationserfahrung in der zuweilen gnadenlos unwirtlichen Natur mit markigen Sprüchen, Waffen und Gerät begegnen, fordern andere in raunendem Ton spirituell grundierte Demut und universalistischen Respekt vor der Natur.
Sowohl die Wissenschaftlerin Alma als auch der Schäfer Gaspard lässt die Lebenswelt des Hochgebirges zweifeln, was sie eigentlich hierherbrachte und was ihre Gegenwart rechtfertigt. Clara Arnaud gelingt es, die verschiedenen Ebenen ihrer Geschichte jenseits schamanischer Erweckungserlebnisse und Ich-Optimierung so zu verknüpfen, dass daraus ein eigenes literarisches Universum wird. In ihm verhandelt sie das widersprüchliche Verhältnis zwischen Tier und Mensch, zwischen Gemeinschaft und Abgeschiedenheit, zwischen stupender Schönheit und tödlicher Bedrohung. CORNELIUS WÜLLENKEMPER
Clara Arnaud: "Im Tal der Bärin". Roman.
Aus dem Französischen von Sophie Beese. Verlag Antje Kunstmann, München 2025. 351 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.