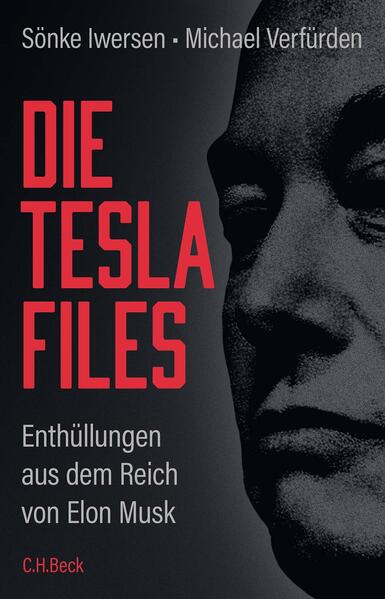Besprechung vom 11.08.2025
Besprechung vom 11.08.2025
Zweifel am Autopiloten
"Tesla-Files" erlauben Blick hinter die Kulissen
Anfang August hat ein Gericht in Florida den amerikanischen Elektroautohersteller Tesla wegen eines tödlichen Autopilot-Unfalls vor sechs Jahren zu einer hohen Geldstrafe verurteilt: Tesla muss mehr als 242 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Die Geschworenen machten Tesla teilweise für einen Unfall verantwortlich, bei dem ein Tesla des Typs Model S mit eingeschaltetem Autopilot-System nach dem Überqueren einer Kreuzung in ein stehendes Fahrzeug fuhr, neben dem die beiden Opfer am Seitenstreifen standen. Der Tesla-Fahrer hatte zuvor das Autopilot-System aktiviert und war zum Zeitpunkt des Unfalls abgelenkt, weil er sich nach seinem Handy bückte, das ihm kurz zuvor auf den Boden gefallen war. Tesla will das Urteil so nicht hinnehmen und will in Berufung gehen. Dennoch hat der Fall für Schlagzeilen gesorgt: Es ist das erste Mal, dass Tesla in einem Gerichtsverfahren um das Autopilot-System für einen Todesfall zu Schadenersatz verurteilt wurde. Tesla war zwar schon mit vielen ähnlichen Klagen konfrontiert, in den früheren Fällen aber wurde das Unternehmen entweder freigesprochen, oder Tesla hat die Klagen mit Vergleichszahlungen an die Kläger vor einem Urteil aus der Welt geschafft.
Zweifel an der Sicherheit des Tesla-Autopiloten gibt es schon lange. Gut dokumentiert sind sie in dem Buch "Die Tesla Files" der beiden "Handelsblatt"-Investigativjournalisten Sönke Iwersen und Michael Verfürden. Das Buch basiert im Kern auf geheimen Dokumenten, die den beiden von einem Whistleblower zugespielt wurden, zudem auf weiteren Recherchen, die sich später nach und nach ergaben, seien es Gespräche mit enttäuschten Kunden oder ehemaligen Mitarbeitern. Der Whistleblower Lukasz Krupski arbeitete ab 2018 für Tesla in Norwegen und war dort IT-Mitarbeiter auf einer niedrigen Hierarchiestufe, der aber dennoch - zu seinem eigenen Erstaunen - Zugriff auf hochsensible Unternehmensdaten hatte. Er selbst hatte einst davon geträumt, für Tesla arbeiten zu dürfen, doch als er dort auf Ungereimtheiten stieß und mit der Zeit auch noch gemobbt wurde, wuchs die Distanz - bis er sich im November 2022 an die Journalisten wandte, mit dem Anliegen, dass es riesige Probleme bei Tesla gebe. Er könne umfangreiche Daten liefern. Später stellte sich heraus, dass er selbst gar nicht ganz genau wusste, welche Geschichten in den endlosen Excel-Tabellen steckten.
Tatsächlich sind es viele verschiedene. Eine der wichtigsten sind die erheblichen Zweifel am Autopiloten. Die Journalisten finden in den Daten etliche interne Berichte von Kunden über ungewollte Beschleunigungen und automatische Notbremsungen. Die zugespielten Daten enthalten mehr als 2400 Beschwerden über Selbstbeschleunigungen und "mehr als 1500 Probleme mit Bremsfunktionen, darunter 139 Fälle von ungewollten Notbremsungen und 383 Phantombremsungen infolge falscher Kollisionswarnungen", schreiben die Autoren: "Die Zahl der Crashs liegt bei mehr als 1000" - manche davon endeten tödlich. Die Journalisten recherchieren etlichen Fällen hinterher. Mithilfe der Daten können die Autoren den vollmundigen Versprechen von Elon Musk die Realität gegenüberstellen.
Das Buch erzählt dabei nicht nur diverse Geschichten aus dem Hause Tesla, sondern vor allem die Geschichte der ganzen Recherche, die sich über rund zwei Jahre zieht: vom ersten anonymen Anruf des Whistleblowers Lukasz Krupski im November 2022, über die anfänglichen Zweifel der Redaktion am Wert der Enthüllungen bis hin zu den internen Debatten, ob man sich wirklich mit Elon Musk, dem reichsten Mann der Welt, anlegen soll. Geschrieben ist das Buch großteils aus Ich-Perspektive von Sönke Iwersen, auch wenn das Buchcover Michael Verfürden als gleichrangigen Ko-Autoren nennt. Dabei bekommt der Leser lehrreiche Einblicke in die Arbeitsweise investigativer Journalisten.
Iwersen erzählt von seinen anfänglichen Zweifeln, wie er die Datenmassen zunächst recht wahllos durchforstet, um zu testen, ob die Daten gefälscht sind. Das liest sich spannend - zumal dabei interessante Nebengeschichten als Beifang herausspringen. Zum Beispiel als er aus Neugier und Berufserfahrung den riesigen Datensatz einfach mal nach dem Wort "Staatsanwaltschaft" durchsucht, weil, wie er selbst schreibt, die Erfahrung gezeigt habe, dass Dokumente, die dieses Wort enthalten, "in der Regel eine gewisse Brisanz haben".
Der Moment, in dem er die Trefferliste auf dem Bildschirm gesehen habe, sei einer der seltsamsten in seinem ganzen Berufsleben gewesen, schreibt Iwersen. Eine der angezeigten Dateien enthielt das Wort "TKÜ", ein Kürzel für "Telekommunikationsüberwachung", was Journalisten von Natur aus neugierig macht. Beim Öffnen der Datei wurde es noch interessanter: "Strafsache gegen Jan Marsalek" stand dort. Aus dem Schreiben ergibt sich, dass die österreichische Staatsanwaltschaft von Tesla die Ortungsdaten eines Tesla-Fahrzeugs eines österreichischen Politikers angefordert hat, weil sie vermutet, dass der Politiker sich als Fluchthelfer des früheren Wirecard-Vorstandes Jan Marsalek verdingt hat, der sich nach dem Milliardenbetrug ins Ausland absetzte und seither international gesucht wird. Als Iwersen merkt, dass sein Whistleblower sich selbst wundert, wieso der Fall Wirecard in den Tesla-Daten auftaucht, war ihm klar, dass die Daten echt sind: "Ich selbst habe den Suchbegriff ausgewählt: Niemand hat das Dokument als Köder ausgelegt". TILLMANN NEUSCHELER
Sönke Iwersen und Michael Verfürden: Die Tesla-Files - Enthüllungen aus dem Reich von Elon Musk. C.H.Beck, München 2025, 246 Seiten
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.