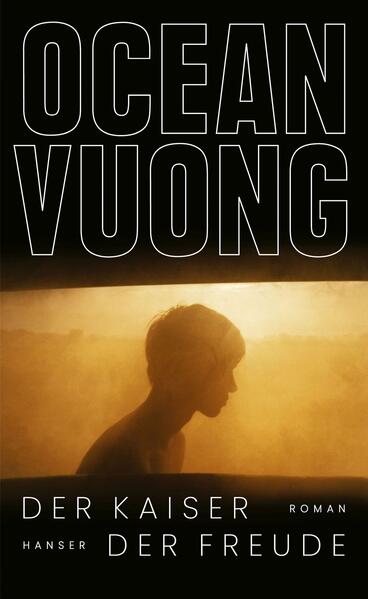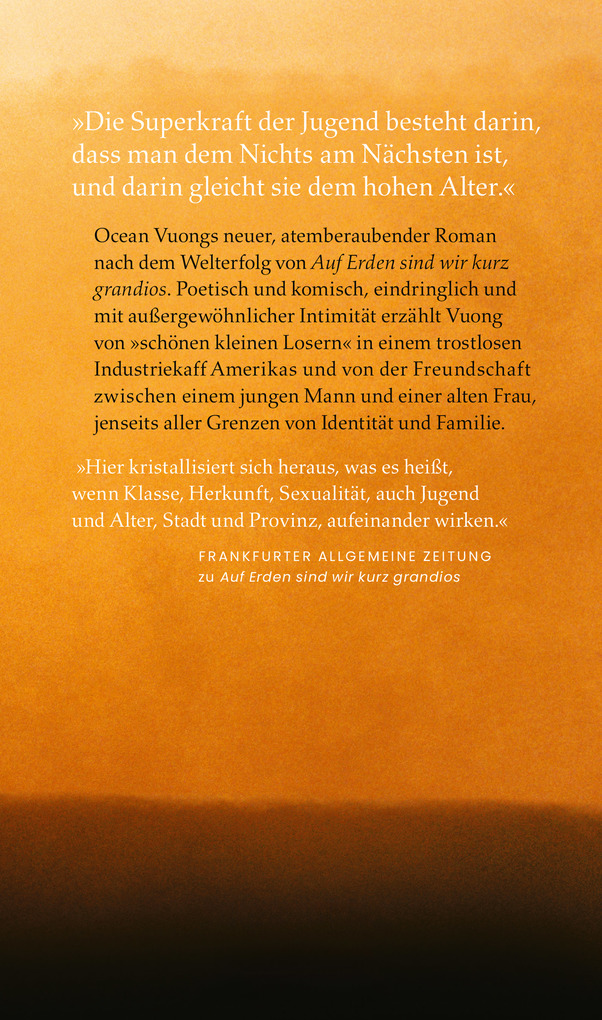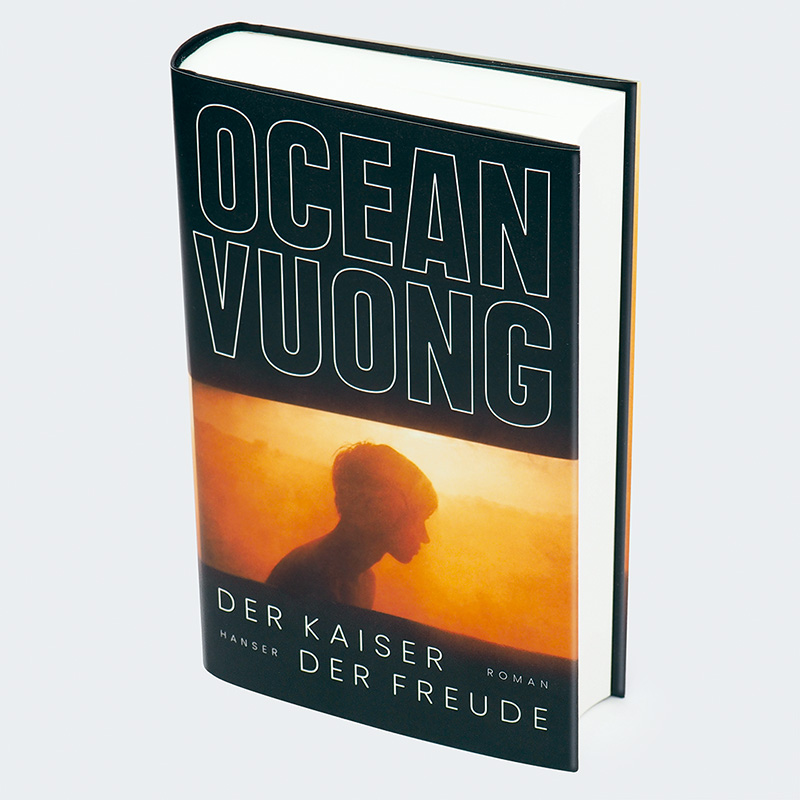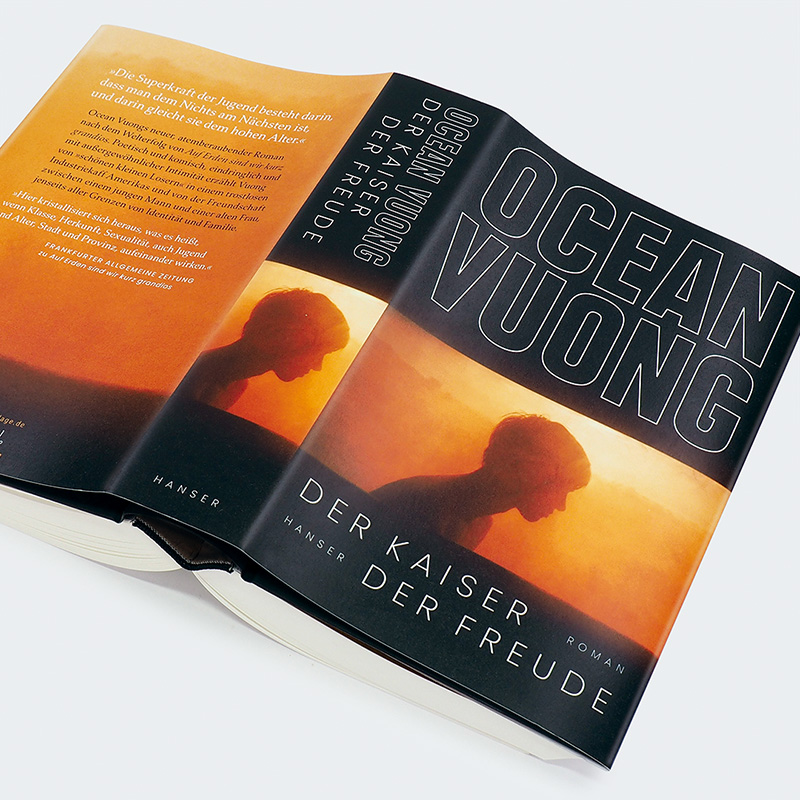Besprechung vom 05.07.2025
Besprechung vom 05.07.2025
Literatur aus dem Glückskeks
Ocean Vuong wird gefeiert als Superstar der amerikanischen Literatur. Kann sein neuer Roman "Der Kaiser der Freude" dem hohen Anspruch gerecht werden?
Ocean Vuong gilt als eine der bedeutendsten Stimmen der jüngeren Generation amerikanischer Schriftsteller. 1988 in Vietnam geboren, kam er im Alter von zwei Jahren mit seinen Eltern nach Connecticut. Mit Gedichtbänden wie "Nachthimmel mit Austrittswunden" sowie seinem Romandebüt "Auf Erden sind wir kurz grandios" begeisterte er Leser und Kritiker gleichermaßen. Er erhielt Preise, sein Romanerstling verkaufte sich in Amerika eine Million Mal. Besonders hervorgehoben wird dabei immer, dass nicht nur Vuongs Lyrik, sondern auch seine Prosa durchdrungen sei von einer poetischen Sprache, die persönliche Erfahrungen mit den ganz großen Themen Identität, Trauma und Zugehörigkeit verknüpft.
Kein Wunder also, dass sein neuer Roman "Der Kaiser der Freude" gefeiert wird als Werk voller - wahlweise - "Herz", "Empathie", "Würde", Eifer", "Hoffnung", "Güte". Dem Text wird sogar attestiert, wie eine "sauber genähte Wunde zu wirken", wobei nicht recht klar ist, worin die Wirkmacht einer Wunde bestehen könnte. Die hymnischen Zuschreibungen könnten jedoch zu tun haben mit der besonderen Verfasstheit dieser Prosa. Denn man wird den Eindruck nicht los, dass Ocean Vuong seine Leserinnen und Leser mit seinem pathetisch enthemmten Stil ansteckt.
Der Roman ist eine Verführung und wird darüber fast schon zu einem Manifest, jedenfalls ist er mehr Empowerment als Schule der Empathie, wie es der Literatur ja gern nachgesagt wird. "Der Kaiser der Freude" aber gibt seinen Lesern nicht den Raum, die Welt mit anderen Augen zu betrachten, denn die einzunehmende Perspektive wird von Anfang an etabliert. In diesem Sinn hat Vuong eine Mission, er will seine Leser bekehren, sie zu empfindsameren, empathischeren - ja besseren Menschen machen. Und weil dieses Ansinnen aus jeder Zeile tropft, läuft das Werk auf Grund.
Erzählt wird die Geschichte des queeren Hai, der wie sein nach dem Ozean benannter Schöpfer einen ungewöhnlichen Namen trägt und ebenfalls einer vietnamesischen Familie entstammt. Der Roman beginnt in größter Verzweiflung, als sich der neunzehnjährige Protagonist von einer Brücke stürzen will. Gerettet wird er von der zweiundachtzigjährigen Grazina, einer litauischen Immigrantin mit beginnender Demenz. Nach geglückter Bergung bietet sie Hai an, bei ihr einzuziehen. Dafür soll er sich um sie kümmern.
Grazinas derangiertes Haus steht in East Gladness, worauf im Original der Romantitel "The Emperor of Gladness" anspielt. Im Deutschen geht die Zweideutigkeit leider verloren. Denn der Name der Stadt steht für die Schönheit Neuenglands und bildet zugleich einen krassen Gegensatz zu all dem Elend und der Aussichtslosigkeit ihrer Bewohner, die der Roman schildert. Hier sind die Rasenflächen verdorrt, und die Verlierer kleben vor ihren Fernsehern. Aus der ungewöhnlichen Wohngemeinschaft von Hai und Grazina entwickelt sich die Freundschaft zweier Traumatisierter, die sich an den entgegengesetzten Enden ihres Lebens befinden. Beide suchen ihren Platz in einer unwirtlichen Welt. So wird aus dem odd couple ein Paar, dessen unwahrscheinliche, dabei lebensverändernde Beziehung beispielhaft wirken soll.
Doch damit nicht genug, erklimmt Ocean Vuong eine weitere romantherapeutische Stufe, als er Hai, der seiner prekär lebenden Mutter vorgaukelt, in Harvard Medizin zu studieren, während er in Wahrheit gegen seine Drogensucht ankämpft, einen Job bei "HomeMarket" antreten lässt. In der Fast-Food-Klitsche putzt er Toiletten und Theken und trifft seinen Cousin Sony wieder, der ebenfalls einen dieser Dingnamen trägt, die von Entfremdung zeugen sollen. In dieser Kulisse fettiger Bräter und speckiger Tische bricht sich die Solidarität unter den Lohnsklaven endgültig Bahn, und die Gemeinschaft der Abgehängten samt Hai und Sony findet unerwartet Halt.
An dieser Stelle spätestens sollte man auf den amerikanischen Traum beziehungsweise dessen Kehrseite zu sprechen kommen. Nun handelt ja fast jeder zweite amerikanische Roman davon - sodass es fast schon wieder originell wäre, mal einen Roman über den erfüllten Traum zu lesen. Aber dass die Glücksformel nicht dem migrantischen Romanpersonal zugedacht ist, versteht sich von selbst. In Hinblick auf das gegenwärtige Amerika und Donald Trumps restriktive Einwanderungspolitik könnte sich der Roman daher gerade jetzt als äußerst aktuell und brisant erweisen. Doch Aktualität allein nobilitiert noch keine Prosa. Denn die Beziehung zwischen dem jungen Hai und der alten Grazina ist geprägt von Fürsorge und dem Versuch, durch Rollenspiele (man spielt Szenen aus dem Zweiten Weltkrieg nach) und gemeinsame Rituale (man tritt Brötchen gegen die Schwermut) Momente des Trostes und der Selbstfindung zu schaffen. Auch das Fast-Food-Restaurant ist daher nicht nur Mikroschauplatz gesellschaftlicher Missstände, sondern liefert eine Anleitung zur Solidargemeinschaft frei Haus.
Die literarische Herausforderung des Romans liegt sicherlich darin, dass keine der Figuren eine Entwicklung durchmacht oder eine Wende zum Besseren erlebt. Das wird von Vuong konsequent durchgehalten, weshalb sich ein leicht statisches Leseerlebnis einstellt. Es drängt nichts weiter, weil die Protagonisten vor allem darum kämpfen, dass es nicht noch schlimmer wird. Auch das Personal der Fast-Food-Kette wie der "Hähnchenmann" Wayne oder Big Jean, die als Wrestlerin groß herauskommen will und zwischen Fertigprodukten, Hygieneartikeln und "dem essigartigen Geruch menschlicher Arbeit" noch ein Lächeln für die Kundschaft zaubern müssen, zeichnet Vuong kundig, der selbst viele Jahre in solchen Frittenbuden gearbeitet hat.
Leider schwelgt der Roman dann aber in der Tapferkeit seiner Figuren. Diese haben keine Erwartungen an das Leben, sondern halten sich mit stiller Weisheit über Wasser. Hier begehrt niemand auf, und Hierarchien werden nicht infrage gestellt, sondern über die Reichen allenfalls Witze gemacht, weil sie verdorbenes Gemüse für "bio" halten. Ein Glanz der Armut schimmert durch den Roman und befremdet in seinem Wohlfühl-Imperativ zunehmend. Während der Auftakt noch von der Schönheit einer Tankstelle einigermaßen originell erzählt, kippen die Bilder des begabten Erzählers immer mehr ins Konventionelle und lassen Subtilität vermissen. Da werden Dostojewski, Camus oder Virginia Woolf als Säulenheilige simpel herbeizitiert und Kurt Vonnegut, als es um einen Schlachthof geht.
Unentwegt fahndet diese Geschichte nach großen Gefühlen. Doch die Kombination aus poetischer Sprache und sozialer Realität geht nicht auf. Was daraus folgt, sind Sätze, die mitunter wie Sentenzen klingen oder wie die Texte, die in chinesischen Restaurants in Glückskeksen eingebacken werden. "Jungsein besteht darin, dem Nichts am nächsten zu sein - wie das Alter" ist so ein Satz oder: "Manchmal muss man Glück haben, aber auch großen Mut" oder: "Da geht einer hin und stirbt und urplötzlich, dachte er, wird man zu einer Kiste für diesen Menschen, bewahrt all das auf, was keiner je gesehen hat, und so lebt man weiter mit einem Sarg in sich und hält darin die Erinnerung an die Toten wach."
Geschildert wird eine Welt, in der alles und alle von Verzweiflung umhüllt sind. Der Leser aber hat kaum Zeit, das zu verdauen, weil schon das nächste Drama vor der Tür steht. So wird das Elend trivialisiert, um daraus literarisch Kapital zu schlagen. Man muss nur fest genug an das Gute glauben, um Gutes zu erfahren. Die amerikanische Gegenwart lehrt uns gerade das Gegenteil. SANDRA KEGEL
Ocean Vuong: "Der Kaiser der Freude".
Roman.
Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl und Anne-Kristin Mittag. Hanser Verlag, München 2025. 528 S. geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.