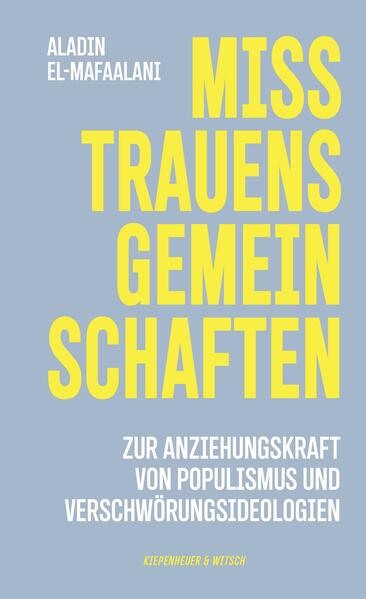Besprechung vom 01.11.2025
Besprechung vom 01.11.2025
Das Gift des Misstrauens
Auf welchem Boden Populismus und Verschwörungstheorien gedeihen
In einer zunehmend unsicheren und unüberschaubaren Welt muss jeder Mensch vertrauen können. Wer kein Vertrauen aufbringen kann, wird handlungsunfähig. Ohne jegliches Vertrauen könnte man morgens nicht einmal sein Bett verlassen. Das hat Niklas Luhmann schon 1968 in seinem Buch "Vertrauen" formuliert. Der Dortmunder Soziologe Aladin El-Mafaalani knüpft in seinem diese Woche erscheinenden Buch "Misstrauensgemeinschaften. Zur Anziehungskraft von Populismus und Verschwörungsideologien" daran an.
Er beschreibt funktionierende, gewachsene Vertrauensverhältnisse - in Partnerschaften oder gegenüber Nachbarn, denen man den Schlüssel der eigenen Wohnung anvertraut. Im Kleinen scheint die wechselseitige soziale Praxis des Vertrauens zu funktionieren, das Vertrauen in gesellschaftliche Systeme und Institutionen dagegen wird immer brüchiger, obwohl es dringend nötig wäre, um die Komplexität des modernen Alltags zu reduzieren. Allerdings etablierten sich durch Vertrauen auch immer ausdifferenziertere Systeme, die ebenfalls auf Vertrauen angewiesen seien, so der Soziologe.
Er erinnert an die Finanzkrise im Jahr 2008, als Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister Steinbrück der Öffentlichkeit versicherten, ihre Spareinlagen seien sicher, obwohl sie die finanziellen Spielräume der Bundesregierung bei Weitem übertrafen. Doch die Anleger vertrauten, und die Anlegerflucht blieb aus. Ob das inzwischen noch einmal gelänge, darf bezweifelt werden. Die seither immer beliebteren Krypto-Währungen seien die Währung der Misstrauischen, meint El-Mafaalani.
Misstrauen sei nicht das Gegenteil von Vertrauen, sondern sein funktionales Äquivalent. "Wer misstraut, wird deshalb handlungsfähig, weil negative Erwartungen handlungsleitend werden", analysiert er und verweist darauf, dass viele mögliche Entwicklungen ausgeblendet und nur nachteilige angenommen werden. Um als Misstrauender nicht völlig handlungsunfähig zu werden, vertraut man nur denen, die ebenfalls misstrauen. Das ist insofern gefährlich, als es keine rationalen Grundlagen für das Vertrauen der Misstrauischen gibt: Weder Kompetenz noch Erfahrung zählen. Die Verbindung leistet einzig und allein das gemeinsame Misstrauen. Es entstehen dann Misstrauensgemeinschaften.
Sie wenden sich gegen etablierte Strukturen und Prinzipien der Gesellschaft und leben davon, dass sie den Rest der Gesellschaft fälschlicherweise als homogenes Ganzes darstellen. "Misstrauen erhöht die Anfälligkeit für populistische Orientierungen oder Verschwörungsideologien. Denn beide Phänomene basieren selbst auf Misstrauen und kanalisieren es", heißt es in dem Buch. Denn beide reduzierten Komplexität auf radikale Weise.
Natürlich wirbt El-Mafaalani nicht für blindes Vertrauen, sondern sieht, dass Skepsis nicht nur überlebensnotwendig ist, sondern funktionales Misstrauen zentral für einige Berufe ist. Er nennt polizeiliche Ermittler an einem Tatort, Richter in Gerichtsverfahren, Journalisten bei ihrer Recherche oder Forscher bei scheinbar noch so plausiblen Annahmen. Genau diese "misstrauischen Berufe" repräsentierten aber Systeme, die auf Vertrauen angewiesen sind. Sie sind Protagonisten spezialisierter Funktionssysteme wie Politik, Wirtschaft, Recht, Journalismus. Destruktiv ist das normative Misstrauen, das sich nicht gegen Defizite oder Fehlfunktionen richtet, sondern zu einem identitätsstiftenden Element wird, das auf Abgrenzung und Feindschaft zielt. Als Beispiel für solche Misstrauensgemeinschaften nennt der Soziologe die Querdenkerbewegung während der Corona-Pandemie.
Gerade weil transnationale Zusammenhänge von Pandemien, Klimawandel, Migration, Finanzregulierung oder gewaltsamen Konflikten nationalstaatliche Politik immer ohnmächtiger erscheinen lassen, sind sie stärker von Legitimationskrisen betroffen, zumal sich Menschen über unterschiedliche Kommunikationsmedien darüber informieren. Die erwarteten klaren Antworten bekommen sie weder aus Wissenschaft noch Medien, sie verlieren also an Vertrauen. Zugleich wachsen aus der Sicht des Autors die Misstrauensstrukturen, weil nicht der Wahrheitsgehalt einer Aussage oder die Wirkung politischer Maßnahmen im Vordergrund stünden, sondern nur die Absicht bewertet werde. Der Autor warnt Medienunternehmen davor, mit einer Strategie von Klickzahlen auf die neuen Rahmenbedingungen zu reagieren.
"Wenn der Staat als überlastet, dysfunktional oder nicht reformfähig wahrgenommen wird, erodiert damit auch das Vertrauen in Politik und Demokratie insgesamt", schnellere und effizientere Wirkungsmechanismen könnten helfen, aber auch mehr Vertrauen auf Seiten des Staates. "Statt durch ausufernde Berichtspflichten und Kontrollen den Alltag zu verkomplizieren, könnte der Staat stärker auf Vertrauen setzen", schlägt El-Mafaalani vor. Die Misstrauensstrukturen dagegen förderten Populismus, Verschwörungserzählungen und libertäre Strömungen. Deren Mechanismen offenzulegen, ist die Leistung dieses Essays. HEIKE SCHMOLL
Aladin El-Mafaalani: Misstrauensgemeinschaften. Zur Anziehungskraft von Populismus und Verschwörungsideologien. Kiepenheuer & Witsch, 128 Seiten
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.