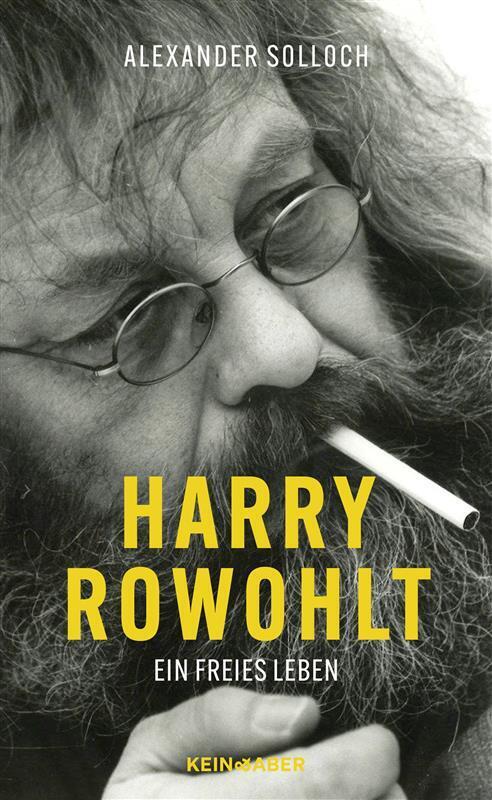»Dieses Buch hat einen ganz eigenen, einen Harry Rowohlt-Sound. « Florian Felix Weyh, Deutschlandfunk Kultur Lesart, 03. 05. 2025 Deutschlandfunk Kultur
»Solloch lässt sich in seiner Nachzeichnung von Harry Rowohlts Leben übrigens vom flüssigen Schreibstil Rowohlts weitgehend inspirieren. Es fallen einem wenig Biografien ein, die man je so gerne gelesen hat. « Thomas Andre, Hamburger Abendblatt, 01. 04. 2025 Thomas Andre, Hamburger Abendblatt
»Alexander Solloch hat Harry Rowohlt eine brillante Biographie gewidmet, aus der man auch ein bisschen die DNA des deutschsprachigen Literaturbetriebs extrahieren kann. « Denis Scheck, ARD Druckfrisch, 27. 03. 2025 Denis Scheck
»Wunderbar ausgedrückt - sehr empfehlenswert, sehr lesenswert. « Knut Cordsen, BR Bayern 2 Kulturleben, 17. 03. 2025 Bayern 2
»Die Biographie setzt ihm ein würdiges Denkmal. « der Freitag, 11. 09. 2025 der Freitag
»Die Biographie zeigt: Rowohlt war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, hatte seinen ganz eigenen Humor und Stil. Sie bietet auch einen Blick hinter die Kulissen. « Rhein Zeitung/Westerwälder Zeitung, 04. 09. 2025 Lena Bongard, Rhein-Zeitung
»Wer Harry Rowohlt noch live erlebt hat, wird viel Neues in diesem Buch entdecken. Und wer ihn vorher nicht kannte, wird eine faszinierende Neuentdeckung machen. Und das alles auf unterhaltsame Weise. « Hildesheimer Allgemeine, 04. 09. 2025 Claus-Urlich Heinke, Hildesheimer Allgemeine
»Was mich an diesem Buch wirklich fasziniert: Es ist ein Buch, aus dem man lernen kann, seine Angst zu verlieren. . . in Zeiten, in denen uns so Vieles Angst macht, ist das ein Buch genau zur richtigen Zeit« Denis Scheck, WDR 2, 10. 08. 2025 Denis Scheck, WDR 2
»Ein ganzes Buch über den Hamburger Stubenhocker Harry Rowohlt? Dieses Kunststück hat Alexander Solloch zusammengebracht. « Linda Stift, Die Presse, 11. 07. 2025 Linda Stift, Die Presse
»Der Journalist Alexander Solloch hat dazu eine liebevolle Hommage geschrieben. Er legt mit großer spürbarer Sympathie den Menschen Rowohlt frei, mit seinen Irrwegen und Selbstzweifeln, seinem Ringen um Freiheit, um den Ausbruch aus dem Korsett der Erwartungen. « Andreas Meixner, Mittelbayerische Zeitung, 02. 07. 2025 Andreas Meixner, Mittelbayerische Zeitung
»Die Mühen der Recherche sind dem Buch nicht anzumerken, und so kann sich die Leserschaft selbst auf unterhaltsame Weise ein Bild vom (Lebens-)Künstler Harry Rowohlt machen, dessen Penner-Look nicht darüber hinwegtäuschen durfte, dass Rowohlt in seiner Arbeit sowohl pedantisch als auch genial war. « Stadtgespräch, Juli 2025 Stadtgespräch
»Solloch, und das zeichnet ihn aus, nimmt diese Geschichten als Material, nicht für die ganze Wirklichkeit des historischen Geschehens, und spricht ihnen jedoch umgekehrt eine eigene Wirklichkeit nicht ab. « Jakob Hayner, nd aktuell, 25. 06. 2025 Jakob Hayner, nd
»Eine um Objektivität bemühte Biografie des hörens- und lesenswerten Kolumnisten, Briefeschreibers und Vorlesungskünstlers Harry Rowohlt, die hinter die nicht immer realitätsgetreuen Selbstdarstellungen blickt. Eine Hommage zum 80. Geburtstag. « Gaggenauer Woche, 23. 06. 2025 Gaggenauer Woche
»In dieser Nähe bei gleichzeitiger Distanz ist hier eine schwer unterhaltsame Biografie entstanden. « Oberholzer Anzeiger, 21. 06. 2025 Oberholzer Anzeiger
»Sollochs Buch ist sowohl das Produkt einer langen Faszination mit Rowohlt wie auch von zahllosen neuen Quellen, Interviews und der generellen Akribie seines Autors. « Felix Haas, Schweizer Monat, 16. 6. 2025 Felix Haas, Schweizer Monat
»Zwei Anlässe, um die Biografie von Alexander Solloch zu würdigen, die Harry Rowohlt heißt und damit verrate ich hoffentlich nicht zu viel ganz ausgezeichnet ist. « Klaus Bittermann, taz, 15. 06. 2025 Klaus Bittermann, taz - Die Tageszeitung
»Für alle, die daran zweifeln, ob daraus eine gescheite Biografie werden kann, gibt das Buch direkt selbst eine Antwort. « Marija Bakker, WDR Westart, 14. 06. 2025 Marija Bakker, WDR 5
»Solloch nähert sich dem Übersetzer, Autor, Schauspieler und Vortragskünstler mit großer Sympathie. Er findet in seinem Schreiben aber auch stets die nötige Distanz zum Porträtierten vor allem vermeidet er den Fehler, Rowohlts Sprachstil zu imitieren, der bei aller Schnoddrigkeit doch stets enorm präzise war. « Michael Schleicher, tz, 13. 06. 2025 Michael Schleicher, tz-Tageszeitung
»So schildert seine Biografie ein intensives Leben, das nicht ausschließlich von der Sonne beschienen war. Und er skizziert zugleich ein Stück Kulturgeschichte. « Michael Schleicher, Münchner Merkur, 13. 06. 2025 Michael Schleicher, Münchner Merkur
»Eine Fleißarbeit, die sich gelohnt hat. « Frank Keil, taz, 11. 06. 2025 Frank Keil, taz - Die Tageszeitung
»Wer dem Genre der Biografie bis jetzt etwas zaghaft gegenüberstand, soll dieses Leben lesen. « Nora Zukker, Tages-Anzeiger Newsletter, 03. 06. 2025 Nora Zukker, Tages-Anzeiger
»Solloch zeichnet genau nach, was der Untertitel verspricht: Ein freies Leben. « Eurosaar, 01. 06. 2025 Eurosaar
»Zum 80. Geburtstag und 10. Todestag des bärigen Unikums aus Hamburg legt der Journalist Alexander Solloch nun eine Biografie bzw. blanke Liebeserklärung vor. « Nürnberger Nachrichten, 01. 06. 2025 Nürnberger Nachrichten
»Diese Biografie leistet vor allem das, was Solloch im Sinn gestanden haben dürfte: einzuladen, sich wieder, erstmals oder weiterhin mit Rowohlts Texten zu beschäftigen. « Thomas Schaefer, konkret, Juni 2025 Thomas Schaefer, konkret
»Solloch hat einen Ton getroffen, der weder anbiedernd noch demütig ist, nein, es stimmt hier einfach alles, und wer dem Genre der Biografie bis jetzt etwas zaghaft gegenüberstand, soll dieses Leben lesen. « Tages-Anzeiger, Mai 2025 Tages-Anzeiger
»Solloch hat's getroffen, man erfährt wahnsinnig viel aus diesem Buch. « Denis Scheck, WDR 3 Mosaik, 12. 05. 2025 WDR 3
»Eine gut recherchierte und anekdotenreiche Biografie. « tam. tam Stadtmagazin, 05. 05. 2025 tam. tam Stadtmagazin
»Durch dieses Buch bleibt Harry Rowohlt in bester Erinnerung. « Torsten Meinike und Max Stotte, Hamburger Morgenpost, 02. 05. 2025 Hamburger Morgenpost
»Eine der besten Biografien überhaupt, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. So sehr angenehm im Ton, undogmatisch, locker, diskret und doch nichts verschweigend, und oft herrlich formuliert. « Michael Maar
»Solloch erzählt leichthändig, anrührend, sensibel und unterhaltsam. « Alexander Kluy, Buchkultur, 11. 04. 2025 Alexander Kluy, Buchkultur
»Der Journalist Alexander Solloch hat mit 'Ein freies Leben' die Biografie dieses vielschichtigen Mannes geschrieben und erzählt, wie der Hamburger Verlagserbe sich seinen Weg durch die Kulturlandschaft suchte. « KAM, Hamburger Morgenpost, 28. 03. 2025 Hamburger Morgenpost
»Alexander Solloch gräbt Bemerkenswertes aus, ohne je in Voyeurismus zu verfallen. . . eine gut recherchierte Biographie. « Knut Cordsen, BR2, 27. 03. 2025 Bayern 2
»Alexander Solloch hat eine anekdotenreiche Biographie geschrieben und dazu mit vielen gesprochen, die ihn kannten. Harry Rowohlt hat gern und viel von sich erzählt aber nicht unbedingt zuverlässig. Das holt Solloch nach. « Kaiserslautern Nachrichten, 27. 03. 2025 Nachrichten Kaiserslautern
»Eine wunderbare und unbedingt lesenswerte Biographie. . . sehr unterhaltsam, niemals anbiedernd vorgetragen. Solloch schreibt, er habe einen zutiefst distanziert-journalistischen Standort eingenommen. Das und die vielen Zeitzeugen-Stimmen machen die Stärke des Buchs aus. « Philipp Seidel, AZ, 27. 03. 2025 Abendzeitung München
»Solloch findet den richtigen Ton, um über diesen Mann zu schreiben: Zupackend und zugleich respektvoll-distanziert. Humorvoll, gelegentlich ironisch, immer unterhaltsam geht es trotzdem zu, und das liest sich gut. « Fritz-Peter Linden, Trierischer Volksfreund, 27. 03. 2025 Trierischer Volksfreund
»Die Rowohlt-Biographie ist ein besonders unterhaltsames Buch geworden, was selbstverständlich am Sujet, aber auch am schriftstellerischen Talent des Biografen liegt. « Ulrike Sárkány, Lesart, März 2025 Lesart Magazin
»Erhellendes über den Meister der Abschweifung Harry Rowohlt. . . ein Buch für Fans, geschrieben von einem Fan. « Hartmut Horstmann, Westfalen-Blatt, Westfälische Nachrichten, u. a. , 21. 03. 2025 Westfalen-Blatt
»Ein launiges Buch erzählt die nicht nur lustige Vita des genialen Übersetzers Harry Rowohlt. « Sebastian Fasthuber, Falter, 19. 03. 2025 Falter