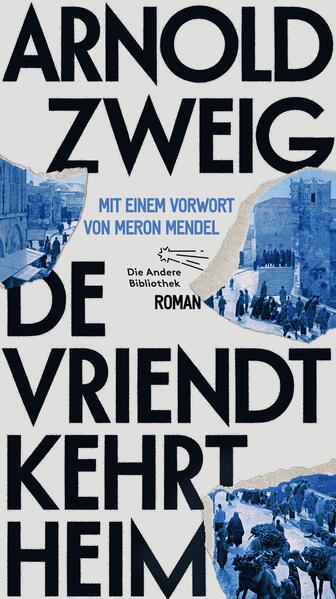
Zustellung: Sa, 17.05. - Di, 20.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Der früheste Roman über den Nahostkonflikt: Weltliteratur mit Kriminalhandlung von global-politischer Brisanz
An einem Spätsommerabend des Jahres 1929 wird der Schriftsteller und Jurist Jizchak Josef de Vriendt in Jerusalem erschossen. Ein Attentat aus dem Hinterhalt. Kommt der Mörder aus den zionistischen Kreisen, die in dem klugen, auf Ausgleich mit der arabischen Seite bedachten Politiker einen Verräter an der nationalen Sache sehen? Oder aus der Familie des jungen Arabers Saûd, der für de Vriendt mehr war als ein Schüler? Mr. Irmin, Chef des Geheimdienstes bei der britischen Verwaltung von Palästina, ein Freund de Vriendts und eingeweiht in dessen Freigeisterei, will den Täter stellen. Seine Fahndungen konfrontieren ihn mit der explosiven Situation im Land, den rivalisierenden Bevölkerungsgruppen der Araber, Juden und Christen, mit einer überwältigenden Landschaft und einer historischen Tradition von mehr als dreitausend Jahren.
Arnold Zweigs Roman von 1932 gilt als erster historischer Roman über den Nahostkonflikt und basiert auf einem wahren Mordfall. Mit seiner literarischen Bearbeitung der Ereignisse vermag er den Verstrickungen auf den Grund zu kommen, die die Welt noch immer in Atem halten.
»Ein politischer Mord ist Drehpunkt dieses ersten historischen Romans über das Land Palästina/Israel - vor einem explosiven politischen Hintergrund, der die Anfänge heutiger Konflikte im Nahen Osten aufzeigt. « Arnold Zweig, 1932
»Man ist so erlebenssatt, nachdem man durch ist - der Stoff, sein Reichtum, die Schärfe der Zeichnung, die Unparteilichkeit der Schilderung, das nimmt Besitz von einem. « Sigmund Freud
Produktdetails
Erscheinungsdatum
16. Dezember 2024
Sprache
deutsch
Auflage
2. Auflage
Seitenanzahl
267
Reihe
Die Andere Bibliothek
Autor/Autorin
Arnold Zweig
Vorwort
Meron Mendel
Weitere Beteiligte
Meron Mendel, FAVORITBUERO
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
2 Karten
Gewicht
364 g
Größe (L/B/H)
217/124/20 mm
ISBN
9783847720652
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Ein Buch für unsere zerrüttete Gegenwart! « Salzburger Nachrichten
»Es ist ein sehr unbequemes Buch, mit den Widersprüchen, die es aufdeckt, unvermindert aktuell« Jens Jessen, DIE ZEIT
»Geschenktipp für weltpolitisch Interessierte und Buchliebhaber« WELT am Sonntag
»Arnold Zweigs scharfsichtiger Roman ist die direkte, fast zeitgleich entstandene literarische Antwort auf die dramatischen Ereignisse vor 100 Jahren. « Eberhard Falcke, Deutschlandfunk - Büchermarkt
»Im Abstand von mehr als neunzig Jahren liest sich der Roman wie ein Buch für unsere Zeit, eine Chance, die man wahrnehmen sollte. « Die Furche
»ein sinnliches, elegant geschriebenes Panorama Palästinas zwischen den Weltkriegen« Tages-Anzeiger
»Wer überzeugt ist, dass alles, was historisch gewachsen ist, auch historisch überwunden werden kann, der kommt an Zweigs Nahost-Roman nicht vorbei. « Süddeutsche Zeitung
»Eine literarische Momentaufnahme, mit wortgewaltigen Beschreibungen des Landes, seiner Bewohner und seiner Landschaft durchzogen. [. . .] Unbedingt lesenswert! « haGalil. com - Jüdisches Leben online
»Tatsächlich gelingt Arnold Zweig mit seinem Palästina-Roman ein glänzend geschriebenes, spannendes Prosawerk. « Frankfurter Rundschau
»Es ist eine unglaublich gute Idee, dieses Buch zu lesen. [. . .] eine literarische Entdeckung [. . .], in großartigem Stil geschrieben [. . .]: Es kommt genau zur richtigen Zeit, diese Neuedition. « David Eisermann, WDR 5 - Scala
» De Vriendt kehrt heim ist eine Art literarischer Steinbruch, aus dem sich nichtzuletzt Fragestellungen herausschlagen lassen, die unsere Gegenwart unmittelbar betreffen. « Tobias Schwarz, Berliner Morgenpost
»Es ist ein sehr unbequemes Buch, mit den Widersprüchen, die es aufdeckt, unvermindert aktuell« Jens Jessen, DIE ZEIT
»Geschenktipp für weltpolitisch Interessierte und Buchliebhaber« WELT am Sonntag
»Arnold Zweigs scharfsichtiger Roman ist die direkte, fast zeitgleich entstandene literarische Antwort auf die dramatischen Ereignisse vor 100 Jahren. « Eberhard Falcke, Deutschlandfunk - Büchermarkt
»Im Abstand von mehr als neunzig Jahren liest sich der Roman wie ein Buch für unsere Zeit, eine Chance, die man wahrnehmen sollte. « Die Furche
»ein sinnliches, elegant geschriebenes Panorama Palästinas zwischen den Weltkriegen« Tages-Anzeiger
»Wer überzeugt ist, dass alles, was historisch gewachsen ist, auch historisch überwunden werden kann, der kommt an Zweigs Nahost-Roman nicht vorbei. « Süddeutsche Zeitung
»Eine literarische Momentaufnahme, mit wortgewaltigen Beschreibungen des Landes, seiner Bewohner und seiner Landschaft durchzogen. [. . .] Unbedingt lesenswert! « haGalil. com - Jüdisches Leben online
»Tatsächlich gelingt Arnold Zweig mit seinem Palästina-Roman ein glänzend geschriebenes, spannendes Prosawerk. « Frankfurter Rundschau
»Es ist eine unglaublich gute Idee, dieses Buch zu lesen. [. . .] eine literarische Entdeckung [. . .], in großartigem Stil geschrieben [. . .]: Es kommt genau zur richtigen Zeit, diese Neuedition. « David Eisermann, WDR 5 - Scala
» De Vriendt kehrt heim ist eine Art literarischer Steinbruch, aus dem sich nichtzuletzt Fragestellungen herausschlagen lassen, die unsere Gegenwart unmittelbar betreffen. « Tobias Schwarz, Berliner Morgenpost
 Besprechung vom 19.03.2025
Besprechung vom 19.03.2025
Der Gewalt auf der Spur
Neuausgabe mit aktueller Brisanz: Arnold Zweigs Roman "De Vriendt kehrt heim", erstmals erschienen 1932, über einen politischen Mord in Palästina
Im Jahr 1924 wurde in Jerusalem der holländische Dichter Jacob Israël de Haan ermordet. Früher war er Sozialist, hatte aber zu seinen jüdischen Wurzeln zurückgefunden und gehörte dann einer Partei ultraorthodoxer Juden in Palästina an, die den Zionismus entschieden ablehnten. Historiker nehmen an, dass der Mörder Abraham Tehomi hieß und aus den Reihen der Zionisten kam, doch das wurde nie eindeutig bewiesen.
Acht Jahre später, 1932, schrieb Arnold Zweig einen Roman über dieses Ereignis. Es ging ihm dabei weder um die Nachzeichnung der historischen Vorgänge noch um ein getreues Porträt de Haans, sondern um die Gestaltung menschlicher und politischer Konflikte, die auch Zweig selbst betrafen.
Er hatte einen scharfen Blick für gesellschaftliche Verhältnisse, und im Ersten Weltkrieg war Zweig sich der Identitätskrise bewusst geworden, in die das deutsche Judentum geraten war. Früh bekannte er sich zum Zionismus, die militanten Aspekte der jüdischen Nationalbewegung aber erfüllten ihn schon bald mit Unbehagen, und sein Roman über den ersten politischen Mord in der Geschichte des zionistischen Aufbauwerks geht diesen Ambivalenzen nach.
Zweig fiktionalisiert die Ereignisse und datiert sie um: De Haan heißt de Vriendt, und ermordet wird er 1929, kurz vor einem Massaker, dem viele Juden in Hebron zum Opfer fielen. Damit begann der arabisch-jüdische Konflikt, der bis heute nicht zur Ruhe gekommen ist.
Der Roman hat drei Teile und wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt - zuerst aus der Sicht von Loland B. Irmin, einem Engländer im Geheimdienst der britischen Mandatsmacht. Er steht den Juden aus Osteuropa mit Sympathie gegenüber und spricht zuweilen fast wie ein Zionist. Doch sein Blick ist unparteiisch, und auch Zweig selbst identifiziert sich mit dieser Figur.
Irmin hat in Erfahrung gebracht, dass der Dichter de Vriendt in Lebensgefahr schwebt, und rät ihm, Jerusalem für eine Weile zu verlassen. Dann wechselt die Perspektive, und wir erhalten Einblick in die zerrissene Seele des Dichters. De Vriendt ist nicht nur streng orthodox und bekämpft die Zionisten, weil der Aufbau des Judenstaates zu Gottes Heilsplan gehört, dem niemand vorgreifen darf; wie der historische de Haan ist er auch homosexuell und muss es verbergen, denn in den Augen der Frommen ist das eine unverzeihliche Sünde.
De Vriendts Liebe gilt Saûd, einem Jungen aus einer angesehenen arabischen Familie in Jerusalem. Auch Palästinas Araber sind konservativ, die Familienehre ist ihnen heilig, und zunächst scheint die Gefahr für de Vriendt aus dieser Richtung zu kommen. Der kluge Saûd aber verehrt seinen älteren Freund zutiefst und weiß die Gefahr abzuwenden.
Klug ist auch Irmin, den Zweig wie einen nachdenklichen Sherlock Holmes gestaltet, aber das Schicksal nimmt bereits seinen Lauf. Die antizionistischen Schritte, die de Vriendt im Namen seiner Partei unternimmt, sind von der Presse inzwischen aufgebauscht worden, der Mörder ist schon unterwegs, und das Attentat kann Irmin nicht verhindern. Auf offener Straße fällt de Vriendt unter den Kugeln.
Zweig hat den Roman so konzipiert, dass der Mord sich in seiner Mitte ereignet. Denn er wollte nicht nur erzählen, wie es dazu gekommen war. Mehr noch ging es ihm um die Folgen der politischen Gewalt, die sich am Ende der Zwanzigerjahre in Palästina schon abzeichneten. Bald nach dem Massaker von Hebron kam Zweig zum ersten Mal ins Land, wurde Zeuge der Unruhen und begann, genauer über die Implikationen des Zionismus nachzudenken. Am Vorabend von Hitlers Machtergreifung gehörte das Buch zu seinen Versuchen, größere Klarheit über die Lage der deutschen und europäischen Juden zu gewinnen.
Unter dem Titel "De Vriendt kehrt heim", der nicht ohne Ironie ist, spielt der Roman die verschiedenen Optionen der jüdischen Nationalbewegung durch. Niemand weiß, wer den Dichter ermordet hat, und bei Zweig wird der Fall zum Rorschachtest, der die politischen Haltungen in Palästina kenntlich macht. Die zionistische Presse verdächtigt die Araber, in der arabischen Presse kommt erstmals der Gedanke auf, dass es sich bei dem Mörder um einen jüdischen Nationalisten handeln könnte, und auf einem Herrenabend in Jerusalem wird erörtert, ob man zur Beerdigung de Vriendts gehen sollte.
Alle Anwesenden sind Zionisten. Zweig bringt das ganze Spektrum zu Gehör - von der faschistischen Rechten bis zur araberfreundlichen Linken -, und nach dem Abend führen zwei der Herren auf ihrem Heimweg ein intimeres Gespräch. Der eine ist Dozent für Philosophie an der Universität und stammt aus Deutschland, der andere ist ein Ingenieur aus Russland - ein West- und ein Ostjude also, die vor ihrer Einwanderung nach Palästina sehr verschiedene Erfahrungen gemacht haben und den Zionismus jeweils anders deuten.
Im dritten Teil wird sichtbar, warum der Roman im Jahr 1929 spielt. Zweig konstruiert ihn wie einen Politthriller, und nach dem Massaker von Hebron spitzen die Ereignisse sich zu. Während die Juden überall im Land ihre Stellungen aufbauen, um sich gegen arabische Angriffe zu verteidigen, tritt der Fall de Vriendt in den Hintergrund und scheint an Bedeutung zu verlieren.
Die Proportionen haben sich plötzlich verschoben. Mord und Totschlag sind zur Tagesordnung geworden, und wieder ist es Loland B. Irmin, der die Entwicklungen reflektiert. Nicht nur sein Posten im Jerusalemer Geheimdienst verpflichtet ihn zur Aufklärung des Falles, er ist auch persönlich betroffen, denn de Vriendt hat ihm nahegestanden.
Durch eine Reihe von Zufällen kommt Irmin schließlich auf die Spur des Mörders. Wie oft in Kriminalromanen überzeugt das dénouement nicht unbedingt, und dennoch gelingt es Zweig, für seinen Roman ein überraschendes Ende zu finden. Am Toten Meer stellt Irmin den Mörder, sie führen ein langes Gespräch miteinander, bei dem kein Zeuge zugegen ist - und am Ende lässt er ihn laufen.
Das ist die Konsequenz eines unlösbaren Dilemmas. Zwei jüdische Fanatiker stehen sich hier gegenüber: ein kompromissloser Gottesmann und ein zum Mord bereiter Nationalist. Für Zweig sind das verschiedene Formen des Wahnsinns, aber sein Roman entsteht im Schatten der heraufziehenden Katastrophe, und zwischen den beiden Unmöglichkeiten weiß er sich nicht zu entscheiden. Er war ein säkularer deutscher Jude und Pazifist, Zionist wurde er nur, weil er für sein Volk keinen anderen Ausweg sah.
Die Hitlerjahre verbrachte Zweig in Palästina, und dort waren weder seine deutsche Sprache noch seine politische Kompromissbereitschaft erwünscht. 1948 kehrte er nach Deutschland zurück und wurde einer der bedeutendsten Schriftsteller der DDR. Als die sich nach dem Sechstagekrieg von Israel abwandte, war er einer der wenigen ostdeutschen Intellektuellen, die sich weigerten, eine Verurteilung des Judenstaates zu unterzeichnen. Ein Jahr später, 1968, starb er. Ein Jahrhundert nach de Haans Tod legt Die Andere Bibliothek jetzt eine gut kommentierte Neuausgabe des Romans vor. Der 7. Oktober 2023 gibt diesem Buch eine weitere, unerwartete Dimension. JAKOB HESSING
Arnold Zweig: "De Vriendt kehrt heim." Roman.
Vorwort von Meron Mendel. Die Andere Bibliothek, Berlin 2024. 276 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.








