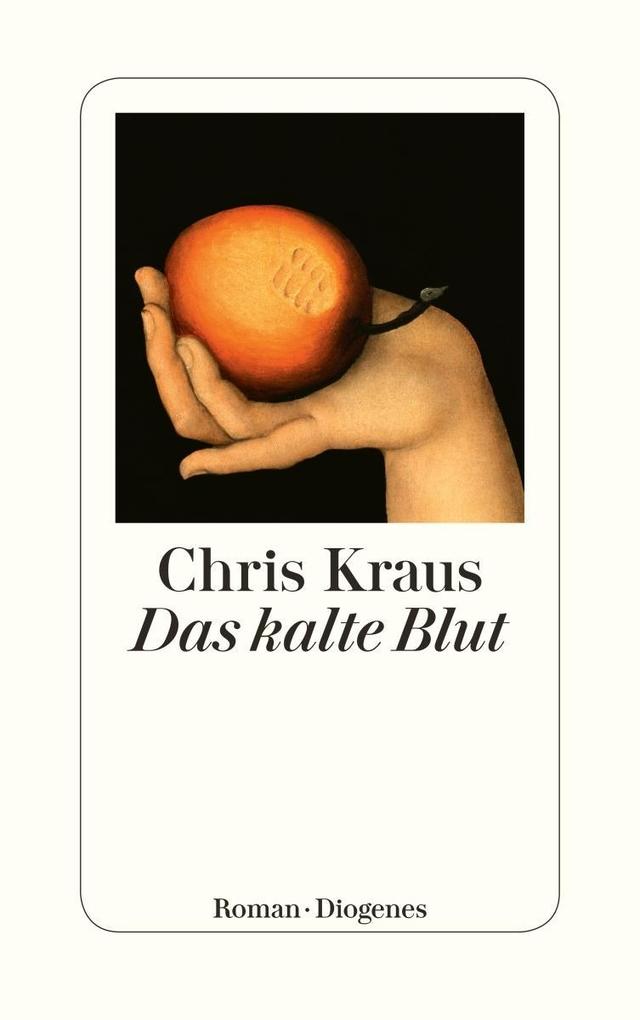
Zustellung: Sa, 07.06. - Do, 12.06.
Versand in 3 Wochen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Zwei Brüder aus Riga machen Karriere: erst in Nazideutschland, dann als Spione der jungen BRD. Die Jüdin Ev ist mal des einen, mal des anderen Geliebte. In der leidenschaftlichen Ménage à trois tun sich moralische Abgründe auf, die zu abenteuerlichen politischen Verwicklungen führen. Chris Kraus erzählt die jüngere Geschichte Deutschlands aus einem aufregend neuen Blickwinkel.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
22. März 2017
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
1200
Autor/Autorin
Chris Kraus
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
991 g
Größe (L/B/H)
207/136/43 mm
ISBN
9783257069730
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Chris Kraus ist ein besessener Erzähler. « Martina Knoben / Süddeutsche Zeitung, Süddeutsche Zeitung
»Kraus hat ein ausgeprägtes Gespür für Pointen. « Silja Ukena / Kulturspiegel, Kulturspiegel
»Kraus hat ein ausgeprägtes Gespür für Pointen. « Silja Ukena / Kulturspiegel, Kulturspiegel
 Besprechung vom 30.04.2025
Besprechung vom 30.04.2025
Der lange Schatten kurzer Sätze
Zu einer unerfindlichen Formulierung in einem zeithistorischen Roman / Von Normen Gangnus
Schon als mir in einer Verlagsvorankündigung der Buchtitel "Wo der Name wohnt" erstmalig begegnete, wusste ich, dass ich diesen Roman lesen würde, ohne auch nur annähernd zu wissen, wovon darin erzählt wird. Der Titel und der beneidenswert schöne und andeutungsvolle Satz "Lange dachte ich, Früher heißt das Land, aus dem sie kamen" sowie die im eilig gelesenen Teaser erwähnte Stadt Riga, mit der ich auf andere Art verbunden bin, ohne jemals dort gewesen zu sein, genügten. Selten nahm ich ein Buch so wohlwollend in die Hand, zuletzt vielleicht "Das kalte Blut" von Chris Kraus oder "Das schwarze Königreich" von Szczepan Twardoch. Sonst bin bei Büchern äußerst skeptisch, ja misstrauisch, erwarte unweigerlich eine Enttäuschung. Hier aber war ich bereit, über Fehler und Unstimmigkeiten und kleine Unzulänglichkeiten aller Art, über ein Zuviel oder Zuwenig an Linearität, an Plausibilität, an den handlungsantreibenden Fragen und Themen, an der Figurenzeichnung hinwegzusehen, allein weil mich der Titel "Wo der Name wohnt" schon für sich einnahm.
Das Etikett "Roman" bietet den Vorteil, unter diesem Deckmantel alles nur Erdenkliche schreiben und Fiktionen und Realgeschehen nach eigenen Regeln vermengen zu können. Man kann sich hinter diesen Mantel, der bei Bedarf gleichsam zum Schutzschild wird, zurückziehen, sich verbarrikadieren und sagen: Es ist nur ein Roman, der diese oder jene Auslassung, Verfremdung, Verkürzung möglich oder nötig machte. Autobiographisches Schreiben, die große Verlockung für jeden Debütanten, geht oft mit der Gefahr einher, sich selbst allzu kenntlich für andere zu machen und, vielleicht, sich selbst bei dieser schreibenden Selbsterkundung zu nahe zu kommen.
In "Wo der Name wohnt" wird um erfahrene Nähe und Vertrautheit gekreist, und in dieser kreisenden Bewegung ist es ein Zurück- und Hinterherschauen, wenn die Nähe verloren geht; ein Versuch, sich festzuklammern und zu bewahren, was man nicht festhalten kann außer in Worten, die aber weniger wiegen als ein Händedruck, ein Lächeln oder ein Rote-Bete-Salat. Es ist eine anrührend nacherzählte Nähe zwischen einer Großmutter und ihrer Enkelin, mit wechselnden Sprachen durch die Zeiten des zwanzigsten Jahrhunderts und über Grenzen hinweg, vermengt mit Spuren europäischer Zeitgeschichte, ein nachklingendes Echo, so wie man es erwarten kann, und darin gelungen.
Die Geschichtslosigkeit dieser Geschichte mag man bedauern oder als Teil eines erzählerischen Konzeptes verklären: Wieso wird die Geschichte der Migration der Großeltern nicht wenigstens lose mit der Migration einer ganzen Generation jüdischer Menschen aus der Sowjetunion Anfang der Siebzigerjahre verbunden beziehungsweise in diese eingebettet, wieso wird die Perspektive nicht auf soziale, politische und historische Kontexte geweitet? Über das Ausmaß der Fiktionalisierung der Figuren kann man spekulieren, es ist schließlich ein Roman. Auch dass die naheliegenden Themen ausgelassen oder nur flüchtig, mitunter pflichtschuldig wirkend aufgegriffen und lediglich en passant ins Erzählen eingebunden werden, dass dieser Text, so erschien er in der Lektüre, so wenig Welthaltigkeit in sich trägt und ganz im kammerspielartigen Spiegelblick der Generationen aufgeht, dass es kaum mehr als bloße Introspektion ist - all das kann man ertragen oder vielleicht sogar mögen; ich blieb, die wohlwollende Neugier hielt an, bis zur Seite 137 unentschieden.
Jede Idee legt, manchmal über Umwege, einen langen Weg mit vielen Schritten zurück, bevor sie, Satz für Satz, zum Text und viel später zum Buch wird. Man kann, ja sollte vielleicht sogar davon ausgehen, dass jeder Satz, jedes Wort gewogen und den eigenen Worten misstraut wird, sie wieder und wieder beschaut werden, zumal wenn der Text den eigenen Schreibtisch verlässt und auf andere Tische wandert, um dort aufmerksamen Augen ausgeliefert zu werden, die akribisch und streng nach Fehlern suchen, für die man selbst vielleicht betriebsblind ist, bevor dann die zum Buch gewordene Idee aufbricht und all das Hineingeschriebene und Hineingedachte versucht, sich in der Öffentlichkeit zu behaupten.
Aber wenn auf Seite 137 in "Wo der Name wohnt" unzureichend knapp und anscheinend auf einem Wikipedia-Artikel basierend die Geschichte der lettischen Juden, deren Untergang und fast vollständige Auslöschung im Holocaust rekapituliert wird - und ja: "Wo der Name wohnt" ist keine wissenschaftliche Monographie, sondern immer noch ein Roman - und in dieser Passage der seltsam unbedacht wirkende und zu gefährlichen Missverständnissen einladende Satz "Etwa 2000 [lettische Juden] überlebten in polnischen und deutschen Lagern" auftaucht, darf, kann und muss man sich fragen, wie ein solch geschichtsvergessener Satz auch nur gedacht, geschweige denn geschrieben und vor allem: wie ein solcher Satz in dieses Buch gelangen konnte. Ein Satz, der die von Deutschen im besetzten Polen betriebenen Massenmordfabriken leichthin zu "polnischen Lagern" umetikettiert.
Die Frage stellt sich zunächst an die Autorin Ricarda Messner, aber auch an den Suhrkamp Verlag. Jetzt können Autorin und Verlag natürlich abwinken, die Kritik als paternalistisch oder überempfindlich abtun, diesen einen Satz ganz an den Rand rücken, ihn zur bloßen und überlesenswerten Lässlichkeit mindern und diesem einen Satz alle anderen Sätze im Buch gegenüberstellen und versuchen, den einen Satz mit den anderen Sätzen zu "verrechnen", aber dieser eine Satz entzieht dem anfänglichen Wohlwollen, das sich bis zur Seite 137 hartnäckig hielt, endgültig den Boden.
Natürlich ist der Satz nicht so gemeint, wie er lesbar ist, aber er ist eben auf diese Weise lesbar, weil er so geschrieben wurde; es gibt diese Verschiebung, dieses Auseinanderfallen zwischen dem, was gesagt werden wollte, und dem, was tatsächlich in diesem einen Satz gesagt wird, diese Unschärfe, diesen kontrafaktischen Anklang, mithin diese schmerzhafte Unbedachtsamkeit und mangelnde Sorgfalt, die einen Schatten auf die Gesamtheit des Textes wirft. Was bleibt, ist Schrecken.
Normen Gangnus ist Schriftsteller. Gerade ist bei Matthes & Seitz sein Buch ". . . mit zerrissenem Schlaf im Gesicht - Die Aufzeichnungen und Briefe des Arved von Sternheim. Band 2. Die Jahre 1943-1945" erschienen.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 10.02.2024
Eindringliche Geschichte, leider in dieser Detaildichte stellenweise nur schwer zu ertragen, wenn es um Taten und Wirken der Nazis geht.
LovelyBooks-Bewertung am 25.12.2022
Der blanke Wahnsinn, auch nach 1000 Seiten wirds nicht langweilig! Genial.









