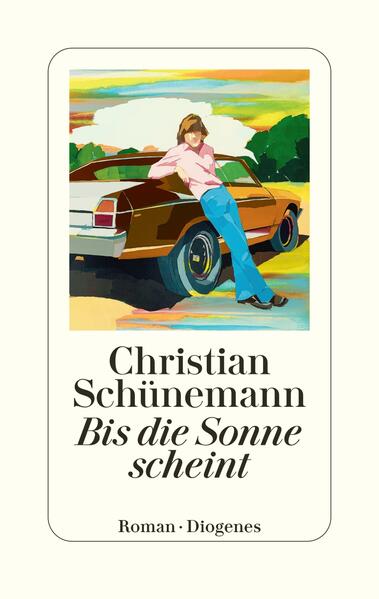"Alles war ganz anders, aber genauso war's" - dieser Satz könnte kaum treffender beschreiben, wie Christian Schünemann eine Zeit heraufbeschwört, die längst vergangen ist. Wir befinden uns im Jahr 1983. Der 14-jährige Daniel ist die Hauptfigur - eine literarische Version des Autors selbst. Für mich, damals selbst 14, waren beim Lesen immer wieder diese kleinen Erinnerungsblitze da: "Dallas" im Fernsehen, die Klänge von Rondo Veneziano, das Schreibmaschinengeklapper im Nebenzimmer, die Avon-Beraterin an der Haustür. All diese scheinbar nebensächlichen Details schaffen eine Atmosphäre, in der man sich sofort zuhause fühlt.Daniel wächst in einer sechsköpfigen Familie auf. Zufällig belauscht er ein Gespräch seiner Eltern - und begreift, dass das Fundament ihres Lebens wankt. Finanzielle Sorgen, drohende Insolvenz. Doch statt zu verzweifeln, setzt sich die Familie ins Auto und fährt "ins Blaue" - ein Versuch, dem Schrecken und der bedrückenden Realität für einen Moment zu entfliehen, wie ein Vogelstrauß, der den Kopf in den Sand steckt.Der Autor erzählt nicht nur Daniels (subjektive) Geschichte, sondern verwebt sie mit den Erlebnissen der Großeltern. Kapitelweise fließen Episoden aus deren Leben ein und machen spürbar, wie sehr die Erfahrungen der vorherigen Generationen die Eltern geprägt haben. So wird der Roman zu einem vielschichtigen Familienporträt, in dem Vergangenheit und Gegenwart ineinandergreifen.Die Stärke des Buches liegt in seiner feinen Beobachtungsgabe. Es sind oft die kleinen Dinge, die hängen bleiben: tropfende Decken im Bungalow, abplatzende Mauerkronen, die typischen Geräusche und Marken jener Jahre. All das macht den Roman nicht nur zu einer Geschichte über eine Familie in der Krise, sondern auch zu einer Zeitreise - mit all der Wärme, Nostalgie und leisen Melancholie, die Erinnerungen mit sich bringen.Ein leiser, aber berührender Roman darüber, was (oder wer) eine (reale) Familie zusammenhält - und wie man manchmal einfach losfahren muss, um nicht unterzugehen.