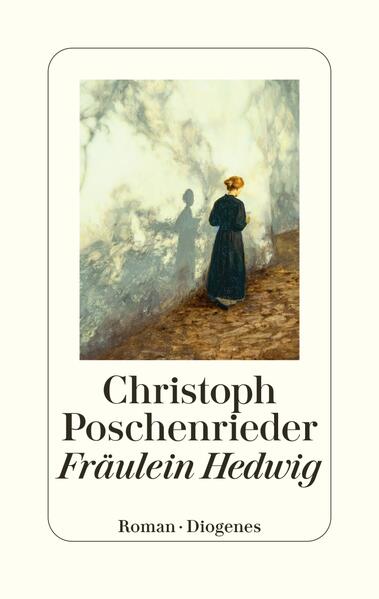Lehrerin Hedwig Poschenrieder leidet unter psychischen Problemen, daher lebt sie im NS-Regime in großer Gefahr - erschütternd und lesenswert
"Ob Hedwig Lehrerin werden wolle, wurde sie nicht gefragt. Es wurde einfach beschlossen. Denn ehrlich, was sollte sonst aus ihr werden? Heiratsmaterial konnte Margarete in ihr beim besten Willen nicht erkennen; und bei etwas weniger als besten Willen schon gar nicht.""Fräulein Hedwig" ist die ältere Schwester des Großvaters von Autor Christoph Poschenrieder. Als 1884 geborenes Mädchen bleiben ihr die Möglichkeiten einer freien Entscheidung verwehrt. Ihr Vater, der früh stirbt, und ihre gesundheitlich labile Mutter erziehen sie nach streng katholischen Moralvorstellungen. Hedwig hegt eine Leidenschaft für die Musik, wird aber genötigt, als Lehrerin zu arbeiten. Früh muss Hedwig ihre Mutter finanziell unterstützen. Doch die Anforderungen an den Lehrerinnenberuf machen Hedwig schwer zu schaffen. Psychisch instabil fällt sie immer öfter bei der Arbeit aus, wird psychiatrisch behandelt und schließlich arbeitsunfähig frühpensioniert. In der NS-Zeit schwebt sie als als psychisch Kranke in großer Gefahr. Personen wie Hedwig sind im Regime unerwünscht.Der Autor erzählt über verschiedene Dokumente wie die Tagebuchaufzeichnungen von Hedwigs Schwester Marie, Arztbriefen und anderen Schriftstücken Hedwigs Lebensgeschichte. Doch trotz aller Recherchen bleiben große Lücken, die Poschenrieder mit "Erfundenen füllt". Der Autor schreibt flüssig, aber formuliert oft recht lange Sätze. Er schildert weniger neutral als persönlich betroffen und wertend.Mit Hedwig hatte ich Mitleid. Sie darf ihren Neigungen nicht nachkommen, wird in einen Beruf gezwungen, der sie sehr stresst und unglücklich macht. Es lastet viel Verantwortung auf ihren Schultern. Mit ihrer Situation kommt Hedwig nicht klar. Sie sucht Hilfe bei Gott, aber weniger im Gebet, sondern in der Beichte, die sie mehrmals wöchentlich aufsucht. Von ihren Mitmenschen wird Frau nicht verstanden. Sie entwickelt sich immer mehr zur Außenseiterin. Hedwig ist eine tragische Figur.Christoph Poschenrieder schildert in seinem Roman die absolut erschütternde Geschichte einer Frau, die mit dem, was ihr das Leben bringt, überfordert ist und an ihren Pflichten zerbricht. Ein trauriges Schicksal wird hier auf interessante, vielschichtige Erzählweise dargestellt. Die unfassbar schlimmen Zustände in der NS-Diktatur werden einmal mehr schonungslos gezeigt. Aufwühlend und sehr lesenswert.