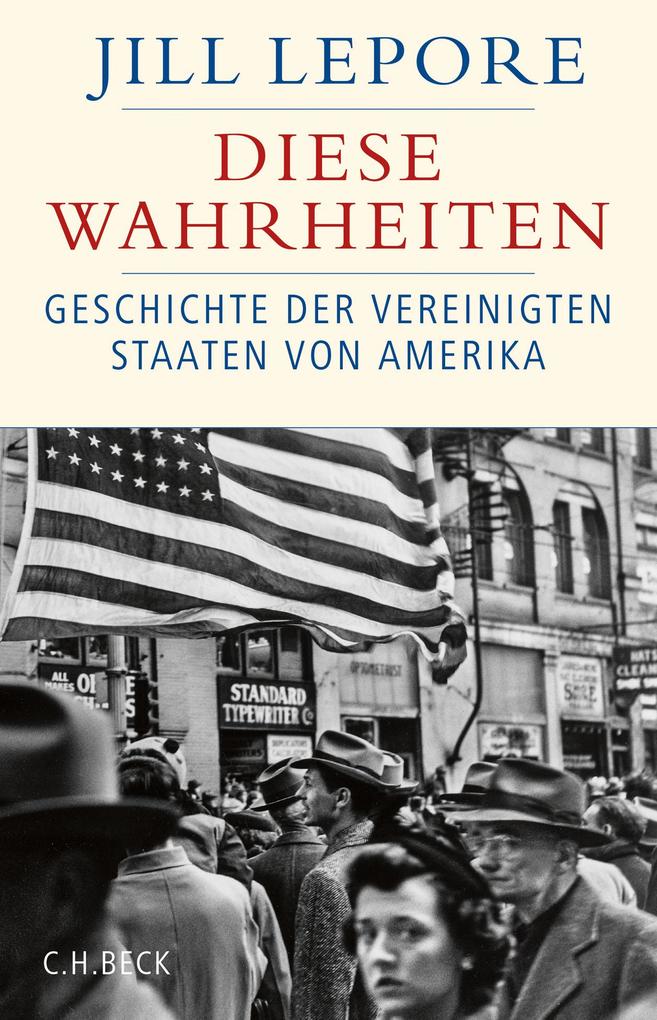" Lepore has written the most honest accounting of our countrys history that Ive ever read.
The New York Times, Bill Gates
" Lepore erzählt die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika als ständigen Konflikt zwischen Liberalen und Konservativen, dem Engagement für Gleichheit und Freiheit einerseits, Unterdrückung und Spaltung andererseits.
SPIEGEL, Leick, Romain/ Neukirch, Ralf
" Die Harvard-Historikerin ist nicht nur eine herausragende Wissenschaftlerin, sondern auch eine fulminante Autorin. "
Die ZEIT, Roman Pletter
" Eine intellektuelle Meisterleistung, deren Lektüre Spaß macht.
AmerInidian Research
" Das ist der Goldstandard der Geschichtsschreibung.
Landeszeitung für die Lüneburger Heide, Joachim Zießler
" Ungemein lesenswert.
Damals, Anke Ortlepp
" Höchst lesenswert.
SWR2 Lesenswert Kritik, Konstantin Sakkas
" In einer brillanten Studie schreibt die Historikerin Jill Lepore die Geschichte der USA von Christoph Kolumbus bis Donald Trump. Sie zeigt darin, dass die aktuelle politische Polarisierung nicht neu ist, sondern die Nation von Anbeginn begleitet.
Deutschlandfunk, Jens Balzer
" Ein reich bebilderter, unterhaltsamer, ernsthafter Lesegenuss.
Süddeutsche Zeitung, Meredith Haaf
" Die Harvard-Historikerin Jill Lepore kritisiert in ihrem Monumentalwerk Diese Wahrheiten. Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika die Allgegenwärtigkeit des Rassismus und das Scheitern liberaler Ideen.
Spiegel Bestseller, Martin Doerry
" Die bestlesbare Geschichte der Vereinigten Staaten in einem Band.
Die Tageszeitung, Claus Leggewie
" Knapp 1000 Seiten plus Anhang lassen keine Frage offen und liefern tiefe Einblicke in die amerikanische Mentalität.
PM History
" It' s exactly the kind of history that readers need today to understand the key struggles that have defined the United States - and to recognize that our history is always present. "
The Time, The 10 Best Nonfiction Books of the 2010s Decade
" Ein Ritt durch die Geschichte, bei dem man das Land in all seinen Widersprüchen kennenlernt.
ZEIT
" Jill Lepore - eine der wichtigen intellektuellen Stimmen der USA () vertritt klare Positionen. Dazu ist ihr Buch trotz seines ziegelsteinartigen Umfangs sehr gut lesbar. Voller Anekdoten und kleinen Geschichten.
mdr Kultur, Stefan Nölke
" Die US-Amerikaner stammen von Eroberern und Eroberten ab. Lepore erzählt von dieser Spaltung und dem politischen Experiment, dabei doch von der Gleichheit aller auszugehen.
Die Tageszeitung, Dirk Knipphals
" Ein Geniestreich mit Aussicht auf Bestand.
Neues Deutschland, Reiner Oschmann
" Packendes Amerika-Buch.
Neue Zürcher Zeitung, Kathrin Meier-Rust
" Lepore bringt luzide auf den Punkt, was die Entstehung und das Werden der USA bis heute ausmacht.
Tagesspiegel, Thomas Speckmann
" Es ist ein intellektuelles Vergnügen.
Bayern 2, Niels Beintker
" Lepores einfühlsame Schilderungen von Ungleichheit (. . .) folgen zwingend aus der Frage nach der Geltung der Verfassungsversprechen in der politischen Praxis und sind der rote Faden im Gewebe dieser mitreißenden Erzählung.
F. A. Z. , Paul Ingendaay
" Ein Buch, das seinesgleichen sucht: eine hochinformierte Rückschau auf die Geschichte der USA () ein monumentales Werk, das gerade kein Monument, kein Gedenken an mythologische Ursprünge ist, sondern leichtflüssig die hohe Kunst historischer Detektivarbeit vorführt: Lepore zeigt uns, wie sich eine Gemeinschaft wieder neu erfand und organisierte. "
NZZ Geschichte, Lea Haller
" Eine völlig neue, brillant erzählte Geschichte der Vereinigten Staaten () ein bahnbrechendes, ach was: revolutionäres Buch über den politischen Werdegang des Landes. "
ZEIT Messebeilage, Alexander Cammann
" Brillante Geschichte der USA.
Neue Zürcher Zeitung, Alfred Defago
" Ein Ritt durch die Geschichte, bei dem man das Land in all seinen Widersprüchen kennenlernt. "
ZEIT-Sachbuch-Bestenliste Oktober 2019
Lepores brillantes Buch läutet hell wie eine Kirchenglocke - der luzide, willkommene Ertrag eines klaren Denkens und eines scharfsinnigen Verstandes.
Karen R. Long, Newsday
" Lepore verbindet die Genauigkeit und umfassende Sachkenntnis der Gelehrten mit der lyrischen Präzision einer Dichterin. . . Dieses Buch ist schon jetzt ein Klassiker.
Kwame Anthony Appiah
" Jeder, der sich für die Zukunft Amerikas interessiert, muss dieses Buch lesen. Eine unserer größten Historikerinnen triumphiert, wo schon so viele gescheitert sind, aus der ganzen Leinwand unserer Geschichte einen Sinn zu ziehen. . . Lepore macht alles lebendig, das Gute, das Schlechte, das Schöne und das Hässliche.
Lynn Hunt
Brillant. . . Erst wenn man es zu lesen beginnt, begreift man, wie dringend unsere Zeit ein Buch wie dieses gebraucht hat.
Andrew Sullivan, New York Times
Jill Lepore ist eine wirklich außergewöhnlich begabte Autorin, und Diese Wahrheiten ist nichts Geringeres als ein Meisterwerk der Geschichtsschreibung. Indem sie sich mit der schmerzhaften Vergangenheit (und Gegenwart) unseres Landes intellektuell aufrichtig auseinandersetzt, hat sie ein Buch geschrieben, dass die Geschichte Amerikas einfängt in all ihrem Leiden und all ihrem Triumph.
Michael Schaub, National Public Radio
Staunenswert. . . Lepore zeigt uns Bilder eines Amerika, das besser ist, als manche von uns dachten, schlimmer als sich die meisten von uns träumen lassen, und unheimlicher, als die meisten ernsthaften Geschichtsbücher jemals vermitteln.
Casey N. Cep, Harvard Magazine