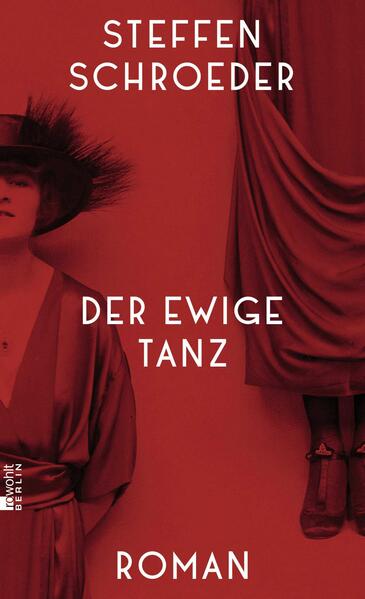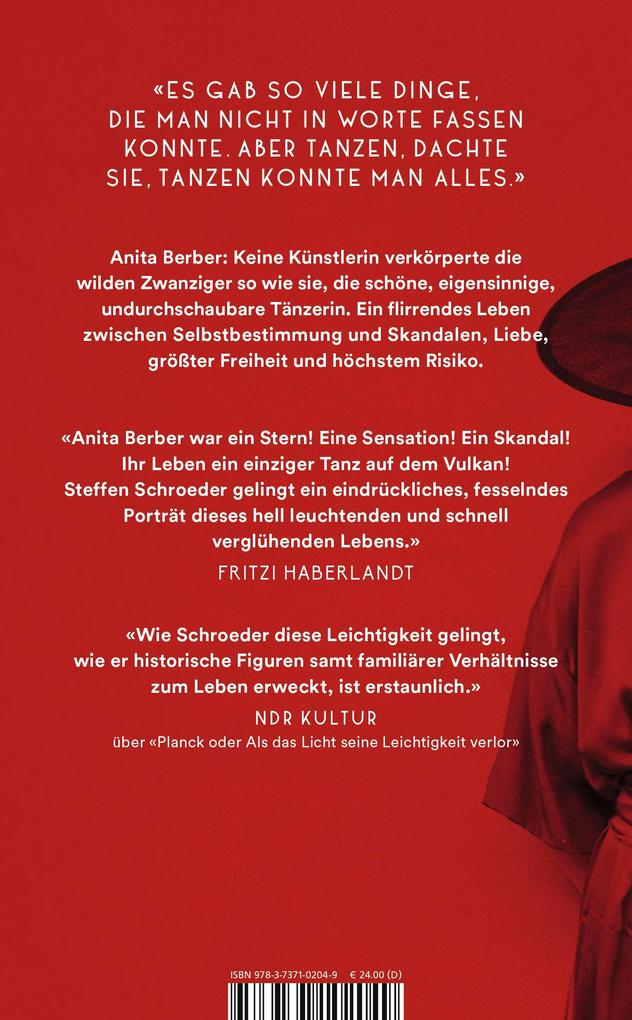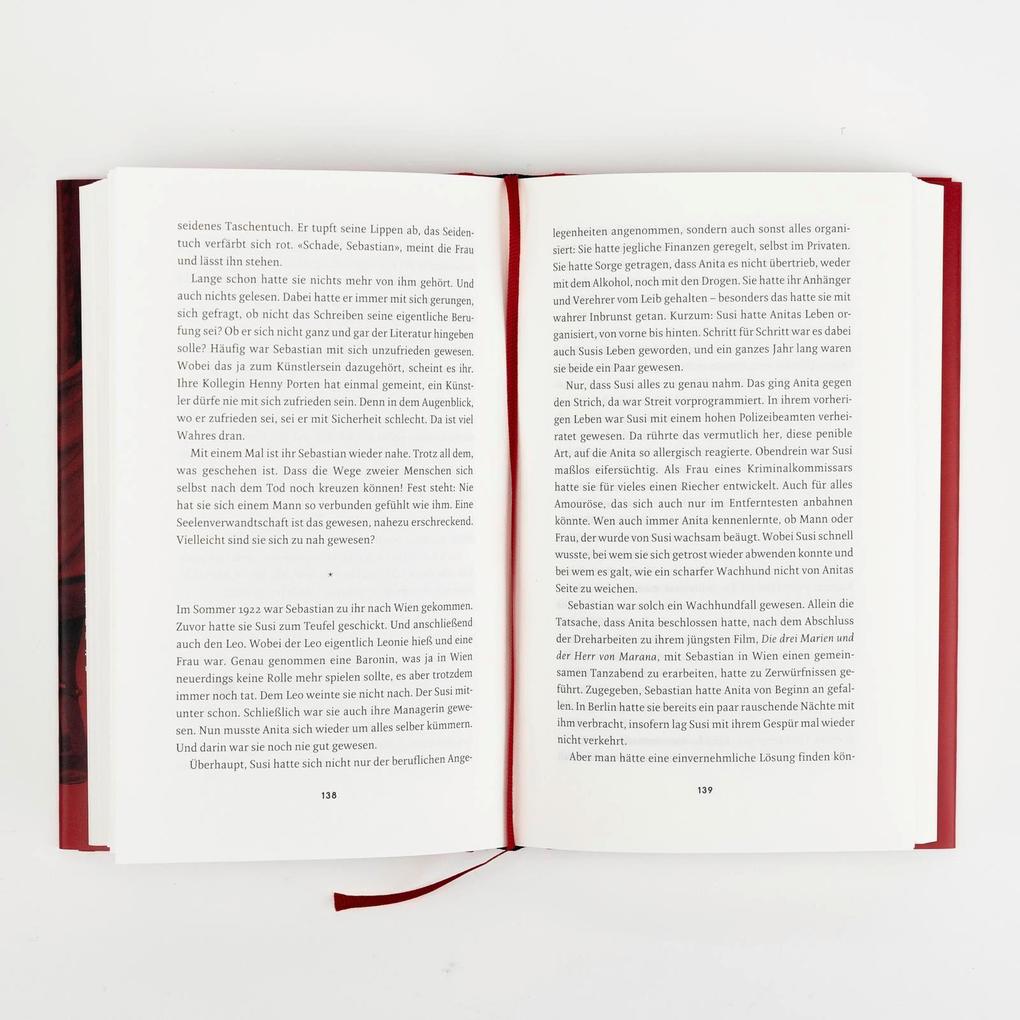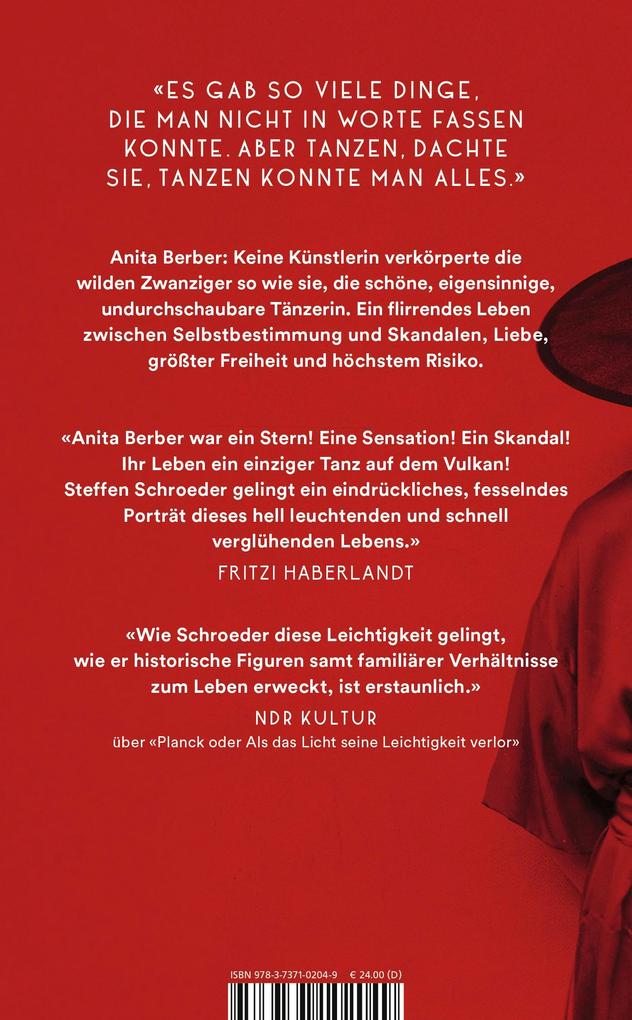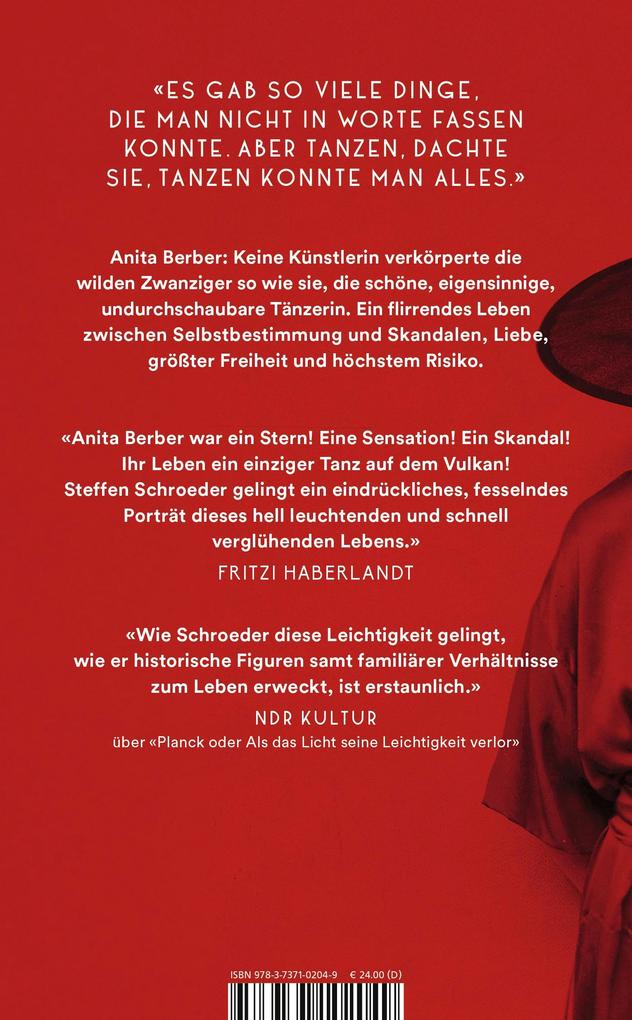Besprechung vom 22.08.2025
Besprechung vom 22.08.2025
Emanzipation bedeutet diesen Büchern alles
Durchaus auch Männersache: Drei weitere Beispiele für die aktuelle Blüte von Romanen über starke Frauen im frühen zwanzigsten Jahrhundert
Was ist eigentlich geschehen, seit Daniel Kehlmann 2005 "Die Vermessung der Welt" herausgebracht hat, den millionenfach verkauften (und vor allem auch gelesenen) Roman über Alexander von Humboldt, an dessen Popularisierung sich ein marktstrategischer Tausendsassa wie Hans Magnus Enzensberger zuvor vergeblich abgearbeitet hatte? Seit Kehlmanns Buch gibt es eine Schwemme von deutschsprachigen Romanen über historische Persönlichkeiten (nicht zuletzt weitere von Kehlmann selbst), die mehr oder minder fiktionalisierte, aber immer auf der Basis realer Ereignisse ruhende biographische Erzählungen bieten. Das jüngste gelungene Beispiel dafür ist Angela Steideles Roman "Ins Dunkel" über Greta Garbo und Marlene Dietrich, dem unsere obenstehende Rezension gilt.
Wobei publizistische Schwemmbewegungen Wellengesetzen gehorchen. In der Zwischenkriegszeit gab es das alles in der deutschsprachigen Literatur schon einmal, als Emil Ludwigs Erfolge den entsprechenden Anreiz gesetzt hatten und höchst namhafte Autoren wie etwa Stefan Zweig, Lion Feuchtwanger oder Heinrich Mann nachzogen. Heute nun sind wir mit der beliebtesten Handlungsepoche historischer Persönlichkeitsromane just in jener Zeit angelangt, in der das Genre seinen Anfang genommen hatte: dem ersten Drittel des zwanzigsten Jahrhunderts (siehe Garbo, siehe Dietrich). Und hinzu kommt, dass nun bevorzugt Frauenwerdegänge zum literarischen Thema werden (siehe Garbo, siehe Dietrich). Auch in von Männern geschriebenen Romanen (sieh an!). Drei neue seien hier exemplarisch genannt: Felix Kuchers "Von Stufe zu Stufe" über Louise Kolm, Steven Schneiders "Die schnellste Frau der Welt" über Elisabeth Junek und Steffen Schroeders "Der ewige Tanz" über Anita Berber.
Was macht nun neben dem Geschlecht ihrer Autoren den Unterschied dieser drei Bücher zu dem von Angela Steidele aus? Zunächst gewiss die Bekanntheit der Protagonistinnen. Garbo und Dietrich sind unsterbliche Legenden ihres Fachs, ihre Arbeiten zählen noch heute zum Kinokanon. Ihre Zeitgenossin Anita Berber (geboren 1899) dagegen ist heute viel bekannter durch das von Otto Dix gemalte Porträt denn als Tänzerin oder Filmschauspielerin - die eine Kunst (mit der sie in den Zwanzigerjahren Skandal machte) war schwer konservierbar, in der anderen war Berber nicht vergleichbar prominent. Elisabeth Junek (eigentlich Eliska Junková) wiederum, ein Jahr nach Berber geboren, war eine tschechische Autosportpionierin, die als Privatfahrerin in den Zwanzigern bei internationalen Rennen gegen die Werksfahrer von Mercedes, Alfa Romeo oder Bugatti antrat - der eingedeutschte Name sollte die Berichterstattung über ihre Erfolge erleichtern, und die waren erheblich. Trotzdem geriet sie in Vergessenheit.
Schließlich die Österreicherin Louise Kolm (oder Louise Fleck, wie sie in zweiter Ehe hieß, die aber nicht mehr von der Handlung des Romans umfasst wird), Jahrgang 1873, auch sie im Kino tätig, als eine der ersten Filmregisseurinnen; ihr ältester erhaltener Film stammt aus dem Jahr 1911. Der Romanbiograph Kucher dichtet ihr ein - durchaus möglich - verlorenes Frühwerk an, das sie zur Urheberin des ersten österreichischen Langfilms macht: Dieses fiktive Werk "Von Stufe zu Stufe", dem der Roman seinen Titel verdankt, ist 1908 entstanden, und eine Kopie hat im damals habsburgischen, heute ukrainischen Czernowitz überlebt, so die Prämisse des Geschehens. Deshalb begibt sich der Ich-Erzähler Marc, ein bislang erfolgloser Wiener Filmwissenschaftler, kurz vor dem Jahreswechsel 2021/22 dorthin. Zwei Monate später wird Russland in der Ukraine einfallen. Mit diesem Wissen spielt der Roman (wenn auch weitgehend folgenlos).
Kucher lässt seine Handlung ständig hin- und herspringen zwischen dem ersten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts und unserer Zeit. Damit treibt er ins Extrem, was ein für alle hier vorgestellten Romane (auch den von Steidele) charakteristisches Element ist: retrospektives Erzählen. Berber liegt mit nicht einmal dreißig Jahren schon auf dem Sterbebett, und Schroeder lässt sie durch Besuche von Weggefährten und behandlungsbedingte Morphiumträume immer wieder in die Vergangenheit abgleiten. Den Rahmen für Schneiders Rennfahrerinnen-Buch geben dagegen vier Monate im selben Jahr 1928 ab, als Junek auf Sizilien fast einmal die ganze männliche Konkurrenz düpiert hätte und dann gemeinsam mit ihrem Mann auf dem Nürburgring antritt, wo Vincent Junek tödlich verunglückt. Danach wird seine Frau nie mehr an einem Rennen teilnehmen. Aber zwischengeschaltet in die Ereignisse von 1928 sind die Stationen ihres Wegs in den Rennsport.
Alle diese Romane sind vor allem Emanzipationsgeschichten, mindestens so sehr gegen patriarchale Gesellschaftsstrukturen jener Zeit als auch gegen familiäre Hemmnisse. Bei Schroeder ist es eine eifersüchtige Mutter, während bei Kolm und Junek wohlmeinende Ehemänner auftreten, die sich jedoch schwertun damit, dass sich ihre Frauen als die Besseren im jeweiligen Fach erweisen. Ein Gutteil des Romangeschehens bei Schneider und Kucher besteht denn auch im Räsonieren ihrer Heldinnen darüber, wie sie ihre Gatten besänftigen können. Elisabeth Junek wählt den Weg des Schweigens, womit sie ihren Mann über ein für das Eheglück zentrales Problem hinwegtäuscht (wobei sich Vincent Junek kurz vor Schluss als der weitaus betrügerischere Schönfärber erweist), während Louise Kolm durch sanfte Beharrlichkeit den Abbruch der anfangs beschwerlichen Dreharbeiten verhindert. Ihre Romanbiographie bietet ein Happy End, während die anderen beiden Frauen in den ihnen gewidmeten Büchern tragisch scheitern - Junek an der Tatsache, dass sie sich doch nicht aus dem klassischen Rollenverständnis löst, Berber am Unvermögen ihrer Zeit, weibliche Unangepasstheit und damit Selbständigkeit (auch in sexuellen Fragen) zu akzeptieren.
Interessant ist, wie sehr Kucher, Schneider und Schroeder jeweils auf innere Monologe setzen, während Steidele die Kunst des Figurendialogs pflegt, um ihre Protagonistinnen zu charakterisieren. Alle erzählen sie dabei auktorial - mit der Einschränkung, dass Kucher wie gesagt einen männlichen Ich-Erzähler einsetzt, dies aber nur in den Gegenwartspassagen. Die Einfindung in die jeweilige Psychologie der Romanheldinnen wahrt damit eine gewisse Distanz, aber das ist keine Männersache; Steidele hält es ja auch so.
Männerspezifisch ist dagegen die starke Fokussierung auf die heiklen heterosexuellen Partnerschaften von Junek, Berber und Kolm. Wo Steidele souveräne Frauen vorstellt, die sich unter Frauen bewegen (und auch ihre Partnerinnen suchen), bemühen sich Schneider, Schroeder und Kucher um eine Geschlechterdichotomie, die historisch plausibler sein mag, aber den Reiz der Überführung eines Lebens ins Fiktionale preisgibt, der ja darin liegt, in der Belletristik auch so etwas wie utopische oder zumindest idealistische Elemente zu benutzen. Denn wozu brauchte es sonst Romane? Die langen Dankeslisten mit den Namen von Experten in den Büchern von Schneider und Schroeder beglaubigen jeweils die Recherche, aber nicht die Imagination. Kein Wunder, dass jener Roman, der sich mit gerade einmal drei Dankesnennungen begnügt, auch derjenige ist, der sich die größten Freiheit mit der zugrundliegenden Biographie nimmt. Wenn man auch bemängeln muss, dass sich Kuchers Buch sowohl des Vergnügungsbetriebs im Prater vor 120 Jahren als auch des Czernowitz unserer Tage derart beschreibungsfreudig annimmt, dass man dahinter umfangreiche Material- und Anschauungssammlungen spürt. So etwas ist kein glücklicher Eindruck bei der Lektüre von Romanen, in denen es mehr um die Interessen ihrer Figuren als um die ihres Autors gehen sollte.
Der bereits sechzigjährige Romannovize Schneider hat damit erstaunlicherweise das geringste Problem. Vor allem erspart er uns überlange Rennverlaufsnacherzählungen. Stattdessen gelingt es ihm, aus Einzelerfahrungen bei der Ausübung des Sports quälende leitmotivische Erinnerungen zu machen, die Elisabeth Juneks sonstiges Leben vergiften - und nicht selten legt er in den Rückblicken bereits Spuren zu noch kommenden Erlebnissen. Er verquickt die Zeitebenen geschickter als Kucher oder Schroeder.
Dafür hat Letzterer den süffigsten Stoff. Auch den sexuell aufgeladensten. Im Vergleich mit Steidele ist Schroeder ungleich expliziter, vor allem auch drastischer, dabei stand Marlene Dietrich in Sachen sexueller Ambiguität Anita Berber nicht nach. In Steideles Roman gibt es übrigens einen Auftritt von Berber, bei Schroeder wiederum einen der Dietrich, denn beide Frauen kannten und bewunderten sich. So ergibt sich aus den Lektüren der vielen Romanschilderungen einer Kulturepoche auch ein spannendes Puzzlebild. Die Elisabeth Junek des Romans von Schneider etwa ahmt das Outfit Greta Garbos nach.
Dieses Puzzlespiel wird sich dank der Konjunktur des historischen Personenromans bald fortsetzen lassen. Das nächste solche Buch über starke Frauen dieser Generation ist bereits angekündigt: In vier Wochen wird nämlich weiter über Marlene Dietrich erzählt, allerdings dann vorgerückt ins Jahr 1964, als die Schauspielerin nach Berlin zurückkehrt. Beim Roman "Transit 64" hat ein Trio Hand angelegt: das Autorenkollektiv BudeMunkWieland, bestehend aus zwei Frauen und einem Mann. Mal sehen, was dabei für eine Emanzipationsgeschichte herauskommt. ANDREAS PLATTHAUS
Felix Kucher: "Von Stufe zu Stufe". Roman.
Picus Verlag, Wien 2025. 264 S., geb., 24,- Euro.
Steven Schneider: "Die schnellste Frau der Welt". Roman.
Rüffler & Rüb,
Zürich 2025.
395 S., 1 Abb., geb., 29,- Euro.
Steffen Schroeder: "Der ewige Tanz". Roman.
Rowohlt Berlin Verlag,
Berlin 2025.
302 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.