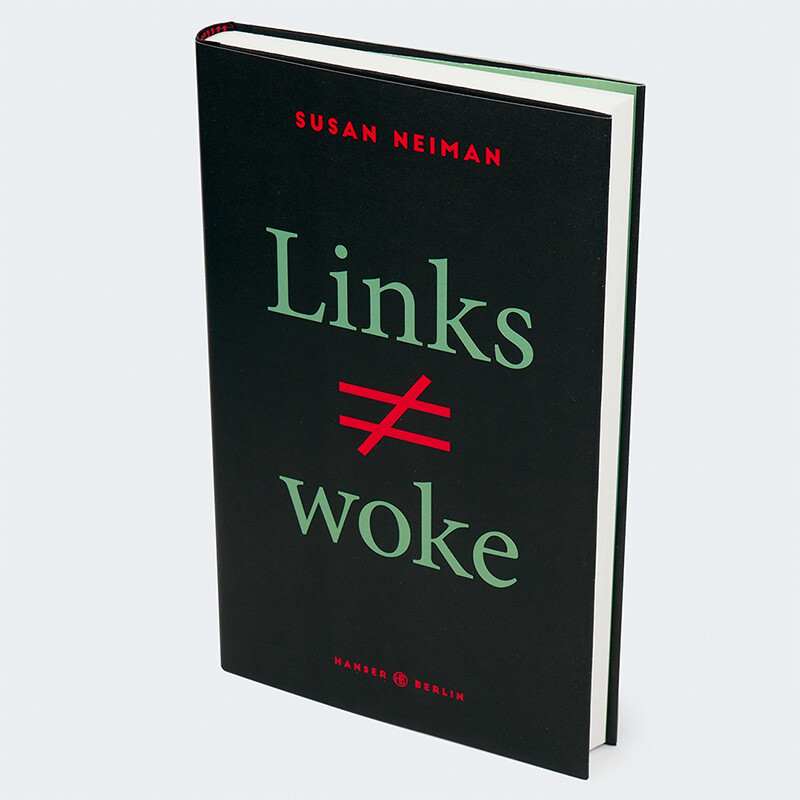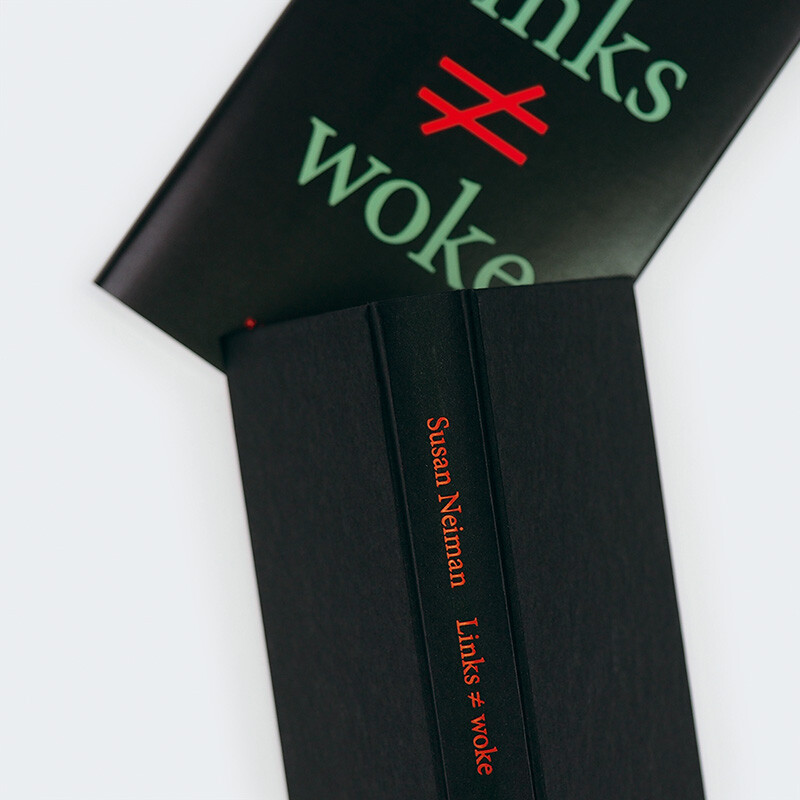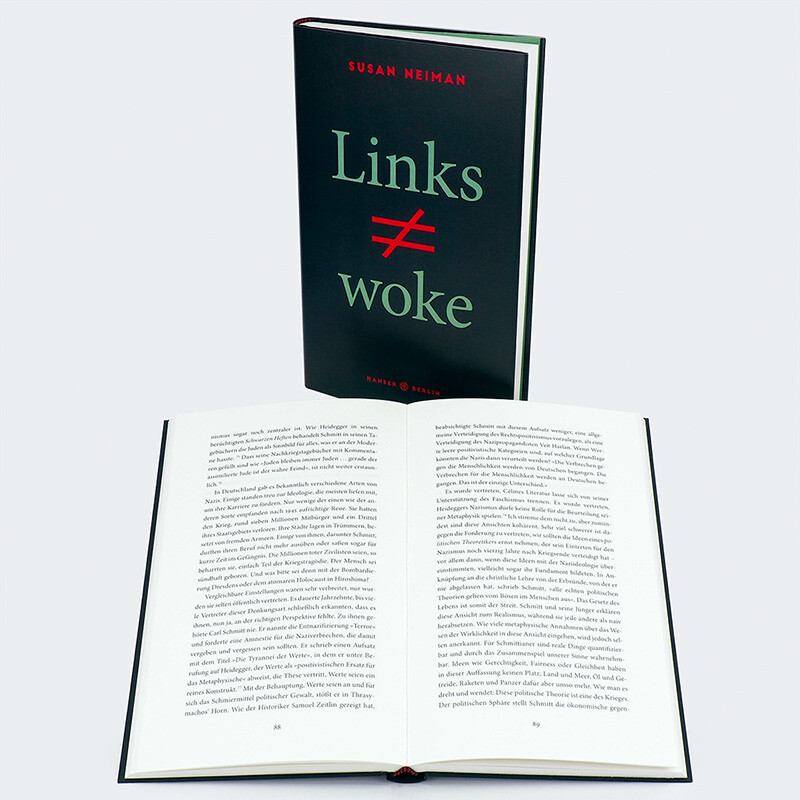Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale
NEU: Das Hugendubel Hörbuch Abo - jederzeit, überall, für nur 7,95 € monatlich!
Jetzt entdecken
mehr erfahren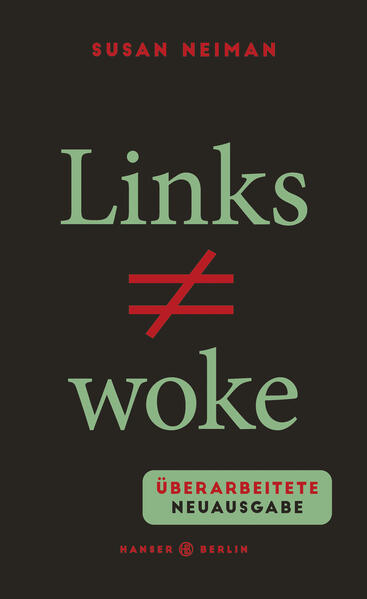
Zustellung: Mo, 01.09. - Mi, 03.09.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Die streitlustige Kritik einer überzeugten Linken an Identitätspolitik. "Susan Neimans klares Denken und ihre pfeilgenaue Sprache sind Rettung und Genuss." (Eva Menasse)Seit sie denken kann, ist Susan Neiman erklärte Linke. Doch seit wann ist die Linke woke? In ihrer von Leidenschaft und Witz befeuerten Streitschrift untersucht sie, wie zeitgenössische Stimmen, die sich als links bezeichnen, ausgerechnet die Überzeugungen aufgegeben haben, die für den linken Standpunkt entscheidend sind: ein Bekenntnis zum Universalismus, der Glaube an die Möglichkeit des Fortschritts und die klare Unterscheidung zwischen Macht und Gerechtigkeit. Als Philosophin überprüft sie dabei die identitätspolitische Kritik an der Aufklärung als rassistisch, kolonialistisch, eurozentristisch und stellt fest: Die heutige Linke beraubt sich selbst der Konzepte, die für den Widerstand gegen den weltweiten Rechtsruck dringend gebraucht werden.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
21. August 2023
Sprache
deutsch
Untertitel
Originaltitel: LEFT IS NOT WOKE.
5. Auflage.
Auflage
5. Auflage
Seitenanzahl
176
Autor/Autorin
Susan Neiman
Übersetzung
Christiana Goldmann
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
englisch
Produktart
gebunden
Gewicht
312 g
Größe (L/B/H)
127/204/26 mm
ISBN
9783446278028
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Platz 1 der Sachbuch-Bestenliste von ZEIT, Deutschlandfunk Kultur und ZDF, September 2023
Neiman gelingt eine exemplarisch zugespitzte Systematisierung und Charakterisierung der in den vergangenen Jahren viel diskutierten Konfliktlinien. Ihre forsche Fortschrittsemphase hat etwas Mitreißendes, das in heillos komplizierten Zeiten wie diesen sehr selten geworden ist. Die bittersüße Lektüre der Stunde. Jens-Christian Rabe, Süddeutsche Zeitung, 22. 08. 23
Susan Neiman gelingt es, auf wenigen Seiten die Gefahren aufzuzeigen, die drohen, wenn die Ideen der Aufklärung vernachlässigt oder abgelehnt werden. Sie argumentiert klar und prägnant mit der Ruhe einer analytischen Philosophin, die die logischen Fehlschlüsse ihrer Gegner seziert. Nicht nur inhaltlich, sondern auch stilistisch zeigt sie eine Alternative zum schwammigen Relativismus auf, der in den geisteswissenschaftlichen Instituten längst zum Trend geworden ist. Nils Schniederjann, Deutschlandfunk, 21. 08. 23
Susan Neiman will deutlich machen, dass sie die Sache so sieht, wie sie andere nicht sehen können. Weil sie blind sind für das, was vor ihren Füßen liegt. Durch Vorurteile, die sie sich nicht bewusst machen wollen. Oder nicht bewusst machen können. Thomas Ribi, NZZ, 12. 09. 23
Susan Neiman will mit ihrem neuen Buch das kritische Denken schärfen. Elisabeth von Thadden, Die Zeit, 17. 08. 23
Ein Buch, das die Linke über ihre eigenen Widersprüche aufklärt . . . und Emotionen und Geist anregt. Wolfram Eilenberger, Deutschlandfunk Kultur, 27. 08. 23
Neiman macht die halbverdauten, theoretischen Grundlagen eines allgemeinen Kulturwandels aus. Ihr Buch ist ein, mutiges, intellektuell anspruchsvolles Projekt. Nils Schniederjann, Deutschlandfunk Kultur, 02. 09. 23
Eine Streitschrift, über die man streiten und Futter für Diskussionen und das eigene Denken ziehen kann. Daniella Baumeister, hr 2, 23. 08. 23
Neimans Mut, sich dem belehrungsfreudigen Puritanismus der Cancel Culture entgegenzustellen, verdient Respekt. Günter Kaindlstorfer, SWR 2, 14. 11. 23
Das Argumentierte und das Anekdotische, das Philosophische und das Feuilletonistische, gehen in Neimans temperamentvollem Essay immer wieder Hand in Hand. Gregor Dotzauer, Tagesspiegel, 24. 08. 23
Prompt möchte man US-Philosophin Susan Neiman spontanen Dank aussprechen. So einfach lassen sich die unbestechlichen Analytiker menschlicher Urteilskraft eben in keinen Sack stecken. Neiman kämpft um den Ruf der Linken` als Gattung. Ronald Pohl, Der Standard, 30. 08. 23
Es war an der Zeit, dass jemand die Courage aufbringt, sich dem belehrungsfreudigen Puritanismus der Cancel Culture entgegenzustellen. Neimans Mut verdient in jedem Fall Respekt. Günter Kaindlstorfer, ORF Ö1, 29. 09. 23
Ein wunderbares Büchlein; die Art von Buch, das mehr Intellektuelle schreiben sollten. Neimans Stil ist lebhaft und erfrischend furchtlos. Sie bezieht einen klaren Standpunkt und bleibt ihm treu. Ein Buch, das man Freundinnen und Familienmitgliedern empfehlen kann, selbst wenn diese mit Neimans Ansatz nicht einverstanden sind. Dustin Guastella (übers. v. Tim Steins), Jacobin, 20. 08. 24
Dieses Buch ist eine Wohltat. Susan Neiman setzt sich fundiert, engagiert, mit gewichtigen Argumenten und in ruhigem Ton mit dem Thema auseinander und übt eine fast schmerzhafte Kritik an jener Linken, die sie selbst einstmals als Verbündete im Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit erkannte. Claudia Kühner, Journal21, 09. 09. 23
Susan Neiman stellt die Welt auf den Kopf und entlarvt den Begriff woke. Dabei ist die preisgekrönte Philosophin eindeutig und einleuchtend in ihren Aussagen. Daniel Arnet, Blick, 10. 09. 23
Berechtigt kritisiert Neiman die kursierende Auffassung, nach der ein Taschenspielertrick im Universalismus gesehen wird. Gerade in derartigen Ausführungen liegen die innovativen Potentiale der Streitschrift. Armin Pfahl-Traughber, Humanistischer Pressedienst, 07. 09. 23
Neiman gelingt eine exemplarisch zugespitzte Systematisierung und Charakterisierung der in den vergangenen Jahren viel diskutierten Konfliktlinien. Ihre forsche Fortschrittsemphase hat etwas Mitreißendes, das in heillos komplizierten Zeiten wie diesen sehr selten geworden ist. Die bittersüße Lektüre der Stunde. Jens-Christian Rabe, Süddeutsche Zeitung, 22. 08. 23
Susan Neiman gelingt es, auf wenigen Seiten die Gefahren aufzuzeigen, die drohen, wenn die Ideen der Aufklärung vernachlässigt oder abgelehnt werden. Sie argumentiert klar und prägnant mit der Ruhe einer analytischen Philosophin, die die logischen Fehlschlüsse ihrer Gegner seziert. Nicht nur inhaltlich, sondern auch stilistisch zeigt sie eine Alternative zum schwammigen Relativismus auf, der in den geisteswissenschaftlichen Instituten längst zum Trend geworden ist. Nils Schniederjann, Deutschlandfunk, 21. 08. 23
Susan Neiman will deutlich machen, dass sie die Sache so sieht, wie sie andere nicht sehen können. Weil sie blind sind für das, was vor ihren Füßen liegt. Durch Vorurteile, die sie sich nicht bewusst machen wollen. Oder nicht bewusst machen können. Thomas Ribi, NZZ, 12. 09. 23
Susan Neiman will mit ihrem neuen Buch das kritische Denken schärfen. Elisabeth von Thadden, Die Zeit, 17. 08. 23
Ein Buch, das die Linke über ihre eigenen Widersprüche aufklärt . . . und Emotionen und Geist anregt. Wolfram Eilenberger, Deutschlandfunk Kultur, 27. 08. 23
Neiman macht die halbverdauten, theoretischen Grundlagen eines allgemeinen Kulturwandels aus. Ihr Buch ist ein, mutiges, intellektuell anspruchsvolles Projekt. Nils Schniederjann, Deutschlandfunk Kultur, 02. 09. 23
Eine Streitschrift, über die man streiten und Futter für Diskussionen und das eigene Denken ziehen kann. Daniella Baumeister, hr 2, 23. 08. 23
Neimans Mut, sich dem belehrungsfreudigen Puritanismus der Cancel Culture entgegenzustellen, verdient Respekt. Günter Kaindlstorfer, SWR 2, 14. 11. 23
Das Argumentierte und das Anekdotische, das Philosophische und das Feuilletonistische, gehen in Neimans temperamentvollem Essay immer wieder Hand in Hand. Gregor Dotzauer, Tagesspiegel, 24. 08. 23
Prompt möchte man US-Philosophin Susan Neiman spontanen Dank aussprechen. So einfach lassen sich die unbestechlichen Analytiker menschlicher Urteilskraft eben in keinen Sack stecken. Neiman kämpft um den Ruf der Linken` als Gattung. Ronald Pohl, Der Standard, 30. 08. 23
Es war an der Zeit, dass jemand die Courage aufbringt, sich dem belehrungsfreudigen Puritanismus der Cancel Culture entgegenzustellen. Neimans Mut verdient in jedem Fall Respekt. Günter Kaindlstorfer, ORF Ö1, 29. 09. 23
Ein wunderbares Büchlein; die Art von Buch, das mehr Intellektuelle schreiben sollten. Neimans Stil ist lebhaft und erfrischend furchtlos. Sie bezieht einen klaren Standpunkt und bleibt ihm treu. Ein Buch, das man Freundinnen und Familienmitgliedern empfehlen kann, selbst wenn diese mit Neimans Ansatz nicht einverstanden sind. Dustin Guastella (übers. v. Tim Steins), Jacobin, 20. 08. 24
Dieses Buch ist eine Wohltat. Susan Neiman setzt sich fundiert, engagiert, mit gewichtigen Argumenten und in ruhigem Ton mit dem Thema auseinander und übt eine fast schmerzhafte Kritik an jener Linken, die sie selbst einstmals als Verbündete im Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit erkannte. Claudia Kühner, Journal21, 09. 09. 23
Susan Neiman stellt die Welt auf den Kopf und entlarvt den Begriff woke. Dabei ist die preisgekrönte Philosophin eindeutig und einleuchtend in ihren Aussagen. Daniel Arnet, Blick, 10. 09. 23
Berechtigt kritisiert Neiman die kursierende Auffassung, nach der ein Taschenspielertrick im Universalismus gesehen wird. Gerade in derartigen Ausführungen liegen die innovativen Potentiale der Streitschrift. Armin Pfahl-Traughber, Humanistischer Pressedienst, 07. 09. 23
 Besprechung vom 20.08.2023
Besprechung vom 20.08.2023
Schattenboxen in drei Kapiteln
Die Philosophin Susan Neiman will erklären, warum links nicht gleich woke ist. Aber sie erklärt nicht mal, was woke ist.
VonNovina Göhlsdorf
Die US-amerikanische, in Deutschland lebende Philosophin Susan Neiman führt in ihrer Streitschrift "Links woke" eine Kontroverse gegen eine Bewegung, die sich als solche nicht ausfindig machen lässt, deren Angehörige sie nicht nennt und weder direkt noch indirekt zu Wort kommen lässt. Sie erhebt Einspruch gegen angebliche Annahmen und Ziele dieser Bewegung, für die ihre 137 Fußnoten keinen einzigen Beleg enthalten. Und sie greift die Theorien an, die diese Bewegung vermeintlich geprägt haben. Susan Neimans Buch ist ein Schattenboxkampf in drei Kapiteln.
Der plakative Titel legt es nahe: Neiman grenzt die Positionen und Anliegen derer, die sie als woke Linke versteht oder denen sie vielmehr unterstellt, sich als woke Linke zu verstehen, ab von denen, die sie für (wahrhaft) links erklärt. Laut einer sprachwissenschaftlichen Studie aus diesem Jahr ist "woke" in Deutschland mittlerweile eine "Chiffre" ohne eindeutigen Bedeutungskern. Daher kommen Neugier und Erleichterung auf, wenn Neiman zu Anfang ihres Buchs eine Wortbestimmung ankündigt. Nur bleibt die leider vage und widersprüchlich. "Woke bezeichnet keine eigentliche Bewegung", schreibt sie - und dann unvermittelt und durchweg von der "Woke-Bewegung". Woke sei "vom Lobes- zum Schmähwort" geworden, heißt es richtig. In der Tat wandten in der Folge von Black Lives Matter manche den Ausdruck "woke", positiv besetzt, auf sich oder ihre Haltung an. Doch Karriere machte er erst, als Leute aus dem rechten und linken Spektrum diejenigen mit ihm beleidigten, die sie für zu links beziehungsweise nicht ausreichend links hielten. Es ist also längst keine affirmative und kollektive Selbstbezeichnung mehr. Doch als genau das verhandelt es Neiman nach kurzer Erwähnung der "Schmähwort"-Tradition - und setzt diese munter fort.
Neimans Bild der Woke-Bewegung ergibt sich aus verstreuten Urteilen und Polemiken: Woke reduziere Menschen "auf das Ausgegrenztsein", sei fixiert auf "Rechte ausgewählter Minderheiten", damit auf "Machtungleichheiten" und verliere die Gerechtigkeit aus dem Blick. Für Neiman ist Wokeness gebunden an Identitätspolitik; die nennt sie aber bevorzugt "Stammesdenken", das nur aus sei auf den Machtgewinn des eigenen "Stammes". Der werde allein durch die Kategorien gender und race bestimmt, und da Neiman die anscheinend als biologische deutet, hält sie "den" Woken Essenzialismus vor. Mehr oder minder abfällig labelt sie vertraute Empörungstrigger als "woke" - den Hang, den Opferstatus zur Qualifikation zu machen, Diskriminierungserfahrungen "zu einem Wald aus Traumata zu verdichten", die "Tendenz, alles und jeden zu dekolonialisieren" und Denkmäler umzustürzen, Dauerdiskussionen über Pronomen und das in Deutschland "amtlich abgesegnete" Verdikt, dass, wer nicht gendersensibel spricht, ein "unverbesserlicher Sexist" sei. Dass sie, abgesehen von diesem letzten Aspekt, deutsche und amerikanische Debatten durcheinanderwirft, macht ihre Zuschreibungen nicht präziser.
Das Fehlen von Nachweisen für ihre Behauptungen lässt diese auf perfide Weise als unangreifbare Schilderungen einer objektiven Realität erscheinen. Es hemmt Diskussionen. Denn wo soll man anfangen, wenn Neiman im Dunkeln lässt, wen oder was sie meint und woher sie das weiß? Damit, dass die ursprüngliche Idee der Identitätspolitik, wie sie das Combahee River Collective, eine Gruppe Schwarzer, lesbischer Feministinnen, in den Siebzigern formuliert hat, und das Engagement vieler derjenigen, die sich heute identitätspolitischen Anliegen verschreiben, nichts mit bloß partikularen Interessen und einer Abkehr von universellen Rechten zu tun hat? Dass, ganz im Gegenteil, diese Rechte erreicht werden sollen, indem man bewusst macht, wie sie Menschen mit bestimmten Identitäten besonders verwehrt bleiben? Dass Identitäten hier als das - bewegliche - Ergebnis sozialer Fremdzuschreibungen verstanden werden und es dabei nicht nur um die von Geschlecht und race geht, sondern etwa auch um die Klasse (ein Begriff, der in Neimans Buch gar nicht vorkommt)? Oder damit, dass deutsche Behörden niemanden, der das generische Maskulinum gebraucht, für sexistisch erklären?
Neiman ist sich sicher: All die Ideen, auf die wahre Linke bauten, lehnten jene, die woke seien, ab: Universalismus, Gerechtigkeit und Fortschritt. Woke sei deshalb nicht gleich links, weil es sich philosophisch anders begründe, auf Irrtümern, die Neiman vor allem auf den Einfluss von Carl Schmitt und Michel Foucault zurückführt. In einem kruden Kurzschluss behauptet sie, dass etwa Schmitts und Foucaults Machttheorien aus den Zwanziger-, Dreißiger-, Vierzigerjahren beziehungsweise Siebziger- und Achtzigerjahren recht ungefiltert nicht nur aktuelle Uniseminare, sondern den politischen Diskurs schlechthin indoktrinieren. Man atmete deren giftige Theorien gewissermaßen mit der Luft ein.
Es liegt nahe, dass Neiman die Vorstellung, Foucault sei "zum Paten der woken Linken geworden", von Omri Boehm übernimmt, der in "Radikaler Universalismus" (2022) raunt, dass postmoderne Ansätze "aus Paris" und mit ihnen eben auch die von Schmitt und Martin Heidegger im Rahmen von Postkolonialen Studien oder Critical Race Studies wieder auflebten. Dass die Kritik an den Theorien und der Person Foucaults gerade in den letzten Jahren enorm war, dass seine Ansätze, sofern sie akademisch aufgegriffen worden sind, in den vergangenen vier Jahrzehnten deutlich weiterentwickelt wurden und sich etwa die Critical Race Studies viel stärker auf Autoren wie Saidiya Hartman oder Frantz Fanon beziehen, scheint an Boehm und Neiman vorbeigegangen zu sein.
Deshalb unternimmt Neiman in ihrem Buch den ausschweifenden Versuch, insbesondere an Foucaults Schrift "Überwachen und Strafen" von 1975 und anhand von fast ebenso lang zurückliegenden Verwerfungen nachzuweisen, dass Foucault kolportiere, was "die" Wokeness philosophisch fundiere: den Glauben und das Streben nach Partikularismus und Machtinteressen sowie die Verneinung des Fortschritts. Und eine für Neiman unverzeihliche moralische Gleichgültigkeit.
Umso normativer ist Neimans Stimme in "Links woke", um nicht zu sagen: apodiktischer. Sie tritt auf als Bescheid wissende Autorität. Ihr selbstgewiss-polternder Ton wird dann besonders unangenehm, wenn das, was sie äußert, offenkundig falsch ist. Um hervorzuheben, dass viele in den USA nichts von deutschen Sozialleistungen wissen, schreibt sie zum Beispiel: "Den Amerikaner, der weiß, dass in Deutschland Eltern nach der Geburt ihres Kindes Anrecht auf sechzehn Monate bezahlte Elternzeit haben, muss ich erst noch finden." Diese Suche könnte dauern, da diese Elternzeit üblicherweise 14 Monate umfasst. Neiman neigt zu Totalaussagen. Zugleich beruhen all ihre Ausführungen auf Insinuationen und Suggestionen, auf Anspielungen und Verunklarungen, vorgebracht im Stil von Klartext-Prosa und im Namen eines ostentativen "wir", das aber nichts Inklusives hat.
Leider geht diese Vollmundigkeit mit einem frappierenden Kohärenzmangel einher, falschen grammatischen Bezügen, ständigen Sprüngen, argumentativen Lücken und einer dauernden Drift, von der die Trennung sämtlicher Ebenen aufgehoben wird. Das hat manchmal bloß komische Effekte, führt aber auch oft zu bedenklichen Entdifferenzierungen, wenn sich etwa auf einer kurzen Strecke Neimans Ressentiment über Blaubeerboxen mit der Aufschrift "The Berry that cares" und den Dixiklo-Namen "Wölkchen" verschiebt zu dem über "weichgezeichnete" Sprache, die Sklaven zu versklavten Personen mache.
Weniger schludrig als programmatisch scheint es hingegen zu sein, dass Neiman, die an einer Stelle vor dem "Missbrauch durch Sprache" warnt, schreibt: "Das Gegenstück zum Universalismus wird oft als identitäre Bewegung bezeichnet" - und damit die linke Identitätspolitik meint. Es entspringt offenbar ihrem wenig verhohlenen frivolen Gefallen daran, vermeintlich woke-linke Haltungen als quasi rechte auszuweisen. Fahrlässig wird es auch da, wo Auslassungen verzerrend wirken, etwa wenn die Aussage einer der Schöpferinnen des Begriffs "Identitätspolitik" so eingebettet wird, dass sie so klingt, als beschwere sie sich über die Verdrehung des Begriffs durch "die" Woken, obwohl das Originalzitat dies unbestimmt lässt.
In Gänze tritt die Absurdität des Buchs vielleicht an seinem bitteren Ende hervor, an dem sie sich für eine Allianz der Linken (der woken und der wahren) ausspricht angesichts der Bedrohung von rechts. Dazu bringt sie eine historische Analogie: Eine linke "Volksfront" hätte nach der Machtübergabe an die Nazis den Zweiten Weltkrieg verhindern können. Doch man habe "das Trennende" als zu groß empfunden. Dabei hätte es "neben den Unterschieden zwischen universalen linken Bewegungen und dem Stammesdenken des Faschismus . . . verblassen müssen, auch wenn die stalinistische kommunistische Partei unfähig war, das zu erkennen. Einen ähnlichen Fehler dürfen wir uns heute nicht leisten."
Um das kurz ins Heute zu übersetzen: Die woken Linken (verglichen mit den Stalinisten) mögen faschismusaffin sein in ihrem Stammesdenken, sollten aber begreifen, dass sie trotz allem noch mehr gemein haben mit den Linken, die sich, wie Neiman, dem Universalismus verschrieben hätten. Freundlicher lässt sich eine Einladung zur Kooperation kaum formulieren.
Hinter Neimans Streitschrift scheint leider weniger der Wunsch nach einer ergiebigen Auseinandersetzung und Annäherung unter Linken zu stehen, sondern eine sehr zeitgemäße Streitlust und das Bedürfnis nach Selbstvergewisserung eines Kreises von ähnlich Denkenden auf ähnlichem Erregungslevel, die sich ohnehin schon einig sind und die sich kaum aufs Außen, dafür umso mehr aufeinander beziehen. Das macht Susan Neimans Buch als Gegenwartsbeschreibung untauglich, aber unbedingt zu einem Symptom dieser Gegenwart. Auch weil es eine aktuell beliebte und erfolgreiche Art der Rede vorführt: eine, die erzeugt, was sie verdammt.
Susan Neiman: "Links ist nicht woke". Aus dem Englischen von Christiana Goldmann. Hanser Berlin, 176 Seiten
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Links ist nicht woke" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.