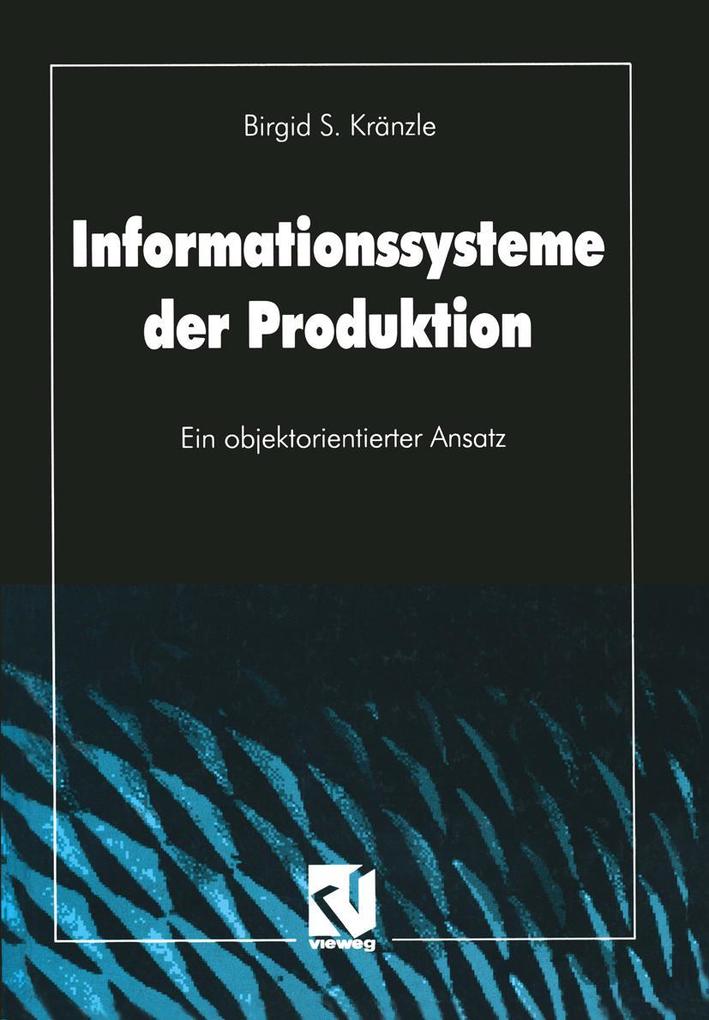
Zustellung: Di, 12.08. - Do, 14.08.
Versand in 2 Tagen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Diesem Buch liegen zwei Priimissen zugrunde, aus denen sich die Probiemstellung ableitet: Priimisse 1: Objektorientierte Datenbanksysteme finden zu nehmend Verbreitung und k6nnen Informationssysteme der Produktion wirkungsvoll verbessern. Priimisse 2: Informationssysteme k6nnen nicht nur fur Unter nehmen mit einem einzigen Typ von Herstellungsverfahren entworfen werden, sondern auch fur Unternehmen mit grundlegend unterschiedlichen Typen von Herstellungsverfah reno Prarnisse 1: Zu Priimisse 1: Ausgehend von der objektorientierten Program Objektorienlierte mierung wurden objektorientierte Datenmodelle konzipiert. Auf Dalenbanksy den Datenmodellen aufbauend wurden inzwischen zahlreiche sterne . . . objektorientierte Datenbanksysteme entwickelt wie GemStone, Iris, POSTGRES und Statice, die zum Teil noch in der Erprobung sind, zum Teil aber auch schon kommerziell angeboten werden (vgl. Koch und Fischer 1991, S. 113-133). Objektorientierte Da tenbanksysteme sollten nach Atkinson, Bancilhorn, DeWitt, Dit trich, Maier und Zdonik (990) 13 Eigenschaften enthalten, die von den Autoren als "Goldene Regeln" publiziert wurden. Die meisten kommerziellen objektorientierten Datenbanksysteme enthalten noch nicht aIle genannten Eigenschaften. Entwickler neuerer objektorientierter Datenbanksysteme orientieren sich je doch zunehmend an diesen Eigenschaften, so daIS in einigen Jahren sicher leistungsfiihige objektorientierte Datenbanksysteme neben oder anstelle relationaler Datenbanksysteme am Markt er haltlich und in Unternehmen im Einsatz sein werden.
Inhaltsverzeichnis
1 Die Gestaltung zukünftiger Informationssysteme der Produktion. - 1. 1 Problemstellung. - 1. 2 Aufbau der Arbeit. - 1. 3 Einordnung in CIM. - 1. 4 Unterstützung des Lesers. - 2 Der objektorientiert erweiterte Objekttypenansatz als Entwurfswerkzeug. - 2. 1 Die Konstruktionselemente des Objekttypenansatzes. - 2. 2 Die Konstruktionselemente des objektorientiert erweiterten Objekttypenansatzes. - 2. 3 Schnittstellen im Objekttypenansatz zur Sicht des Anwenders. - 2. 4 Der objektorientiert erweiterte Objekttypenansatz in den weiteren Kapiteln. - 3 Die relevanten Informationen der Produktion. - 3. 1 Die strategischen Aufgaben des Funktionsbereichs Produktion. - 3. 2 Die taktischen Aufgaben des Funktionsbereichs Produktion. - 3. 3 Die operativen Aufgaben des Funktionsbereichs Produktion. - 3. 4 Die Produktion im Verbund mit anderen Funktionsbereichen. - 4 Eine ganzheitliche und objektorientierte Informationsstruktur der Produktion. - 4. 1 Die Teilinformationsstruktur zu den Produkten. - 4. 2 Die Teilinformationsstruktur zu den Potentialfaktoren. - 4. 3 Die Teilinformationsstruktur zu den Produktionsfaktoren und Produkten. - 4. 4 Die Teilinformationsstruktur zur Organisation der Produktion. - 4. 5 Die Teilinformationsstruktur zur Kombination der Produktionsfaktoren bei der Leistungserstellung. - 4. 6 Die Teilinformationsstruktur zum Auftragsbezug. - 4. 7 Die ganzheitliche Informationsstruktur der Produktion. - 5 Die Input-Output-Modellierung von Herstellungsverfahren. - 5. 1 Grundlagen und Typologie der Herstellungsverfahren. - 5. 2 Die Grundtypen von Herstellungsverfahren in Input-Output-Graphen. - 5. 3 Input-Output-Graphen von Herstellungsprozessen. - 5. 4 Erweiterung um Rahmenbedingungen der Produktionsdurchführung. - 5. 5 Differenzierung der Produktionsfaktoren in Input-Output-Modellen. - 6 SpezifizierteTeilinformationsstruktur für unterschiedliche Typen von Herstellungsverfahren. - 6. 1 Spezifizierung des internen Objekttyps Herstellungsverhältnis. - 6. 2 Spezifizierung externer Objekttypen zur graphischen Ein-und Ausgabe. - 7 Die deterministische Bedarfsermittlung mit der objektorientierten Informationsstruktur. - 7. 1 Die Bedarfsrechnung an Input-Output-Modellen. - 7. 2 Die Bedarfsermittlung mit dem Objekttyp Herstellungsverhältnis. - 7. 3 Funktionsattribute zur Unterstützung der Bedarfsermittlung. - 8 Zusammenfassung und Ausblick. - Stichwortverzeichnis.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
01. Januar 1995
Sprache
deutsch
Untertitel
Ein objektorientierter Ansatz.
Softcover reprint of the original 1st edition 1995.
326 S.
Auflage
Softcover reprint of the original 1st edition 1995
Seitenanzahl
344
Autor/Autorin
Birgid S. Kränzle
Illustrationen
326 S.
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Abbildungen
326 S.
Gewicht
595 g
Größe (L/B/H)
244/170/19 mm
ISBN
9783528054595
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Informationssysteme der Produktion" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.










