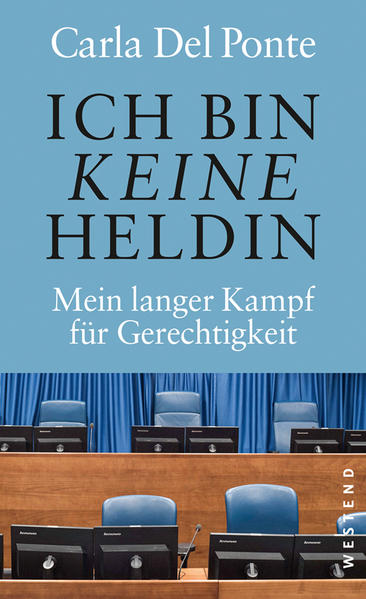
Zustellung: Mo, 12.05. - Mi, 14.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Carla Del Ponte fordert Gerechtigkeit. Wo wird das Völkerrecht aktuell gebrochen? Und welche Möglichkeiten hätte die UN einzugreifen? Wie und von wem wird Einfluss genommen auf Entscheidungen des Sicherheitsrates? Und macht sich die UN zu einem willfährigen Instrument mächtiger Länder? Carla Del Ponte, viele Jahre Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofes, berichtet von ihrer jahrelangen Arbeit als hochrangige UNO-Diplomatin und fordert in ihrem flammenden Plädoyer die Durchsetzung des Völkerrechts, notwendige Reformen der UN sowie eine aktive Rolle der EU.
Inhaltsverzeichnis
Mein Kampf für Gerechtigkeit 7
Der lange Weg nach Den Haag 17
Erste Schritte auf dem Weg zum Völkerrecht 18
Bankrotterklärung Klappe, die erste:
Der Erste Weltkrieg 21
Bankrotterklärung Klappe, die zweite:
Der Zweite Weltkrieg 24
Die UNO: Eine Weltorganisation als Neuanfang 25
Die Genfer Konvention: Schutz der Menschen
im Krieg 28
Der Europarat: Menschenrechte als Grundlage
für Frieden in Europa 30
Der permanente Internationale Strafgerichtshof 31
Keine Gerechtigkeit ohne politischen Willen 35
Kriegsverbrecher vor Gericht 37
Wie bestraft man Völkermord?
Die Prozesse von Nürnberg und Tokio 37
Das Jugoslawien-Tribunal:
Ein Meilenstein im Völkerrecht 40
Ruanda: 100 Tage Grauen 68
Das Völkerrecht hat politische Grenzen 86
Das Versagen der UNO 87
Triumph der Straflosigkeit in Syrien 93
Rückblick: Assads Syrien und die Proteste 2011 95
Eskalation zum internationalen Stellvertreterkrieg 100
Die Syrien-Kommission: Kampf gegen Windmühlen 105
Das makabre Spiel mit dem Giftgas 114
Die Kommission war eine Alibi-Veranstaltung 128
Wie die UNO in Syrien scheiterte 132
»America first«: Über die Relativität von Werten
und Normen 136
Wer bezahlt, befiehlt: Die Finanzierung der UNO 142
In der Grauzone: Das internationale Recht ist
nicht unabhängig 146
Raus aus der Grauzone! Neuordnung und Reformen 156
Anmerkungen 165
Der lange Weg nach Den Haag 17
Erste Schritte auf dem Weg zum Völkerrecht 18
Bankrotterklärung Klappe, die erste:
Der Erste Weltkrieg 21
Bankrotterklärung Klappe, die zweite:
Der Zweite Weltkrieg 24
Die UNO: Eine Weltorganisation als Neuanfang 25
Die Genfer Konvention: Schutz der Menschen
im Krieg 28
Der Europarat: Menschenrechte als Grundlage
für Frieden in Europa 30
Der permanente Internationale Strafgerichtshof 31
Keine Gerechtigkeit ohne politischen Willen 35
Kriegsverbrecher vor Gericht 37
Wie bestraft man Völkermord?
Die Prozesse von Nürnberg und Tokio 37
Das Jugoslawien-Tribunal:
Ein Meilenstein im Völkerrecht 40
Ruanda: 100 Tage Grauen 68
Das Völkerrecht hat politische Grenzen 86
Das Versagen der UNO 87
Triumph der Straflosigkeit in Syrien 93
Rückblick: Assads Syrien und die Proteste 2011 95
Eskalation zum internationalen Stellvertreterkrieg 100
Die Syrien-Kommission: Kampf gegen Windmühlen 105
Das makabre Spiel mit dem Giftgas 114
Die Kommission war eine Alibi-Veranstaltung 128
Wie die UNO in Syrien scheiterte 132
»America first«: Über die Relativität von Werten
und Normen 136
Wer bezahlt, befiehlt: Die Finanzierung der UNO 142
In der Grauzone: Das internationale Recht ist
nicht unabhängig 146
Raus aus der Grauzone! Neuordnung und Reformen 156
Anmerkungen 165
Produktdetails
Erscheinungsdatum
31. Mai 2021
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
176
Autor/Autorin
Carla Del Ponte
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
236 g
Größe (L/B/H)
204/124/19 mm
Sonstiges
Großformatiges Paperback. Klappenbroschur
ISBN
9783864891137
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
"Carla Del Ponte, die ehemalige Chefanklägerin des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag, erhebt ihre Vorwürfe diesmal gegenüber der Weltgemeinschaft. ... minutiös wie in einem Schlussplädoyer legt sie dar, dass wir in Sachen internationaler Justiz schon einmal weiter waren."
titel, thesen, temperamente
"Ein wichtiges, ein lehrreiches Buch."
Süddeutsche Zeitung"
"In ihrem Buch gibt sie Einblicke in ihre Arbeit - und vor allem in die Schwierigkeiten, die ihr als Chefanklägerin und Kommissionsmitglied begegneten ... lesenswert."
Frankfurter Allgemeine Zeitung"
"Mutig, gradlinig und gefürchtet ... In ihrem aktuellen Buch rechnet die streitbare Anwältin mit der internationalen Politik ab."
Deutschlandfunk Kultur "Im Gespräch"
"Carla Del Ponte warnt davor, dass das internationale Recht zerfällt."
Der Spiegel
"Ihr neuestes Buch ist eine Anklage gegen UNO und Großmächte."
Der Tages-Anzeiger
"Sachlich, detailliert, glaubwürdig ... Carla Del Ponte will zeigen, dass internationales Recht unumgänglich ist und sich die kritisch beschriebene UNO, in der sehr oft ungeeignete Personen eingesetzt würden, reformieren muss."
Weltwoche
"Carla Del Ponte nimmt kein Blatt vor den Mund ... Sie vermittelt einmalige Einblicke."
Deutschlandfunk "Andruck"
"Del Ponte untertreibt, wenn sie sagt, sie sei keine Heldin. Schurken haben bei ihr nichts zu lachen. Um sie vor Gericht zu bringen, kämpft die ehemalige Schweizer Bundesanwältin verbissen und heldenhaft. ... Del Pontes Buch ist wichtig und lehrreich."
Sonntagszeitung
"Die ehemalige Chefanklägerin spricht über den syrischen Diktator Assad und die Untätigkeit der UNO."
Luzerner Zeitung
titel, thesen, temperamente
"Ein wichtiges, ein lehrreiches Buch."
Süddeutsche Zeitung"
"In ihrem Buch gibt sie Einblicke in ihre Arbeit - und vor allem in die Schwierigkeiten, die ihr als Chefanklägerin und Kommissionsmitglied begegneten ... lesenswert."
Frankfurter Allgemeine Zeitung"
"Mutig, gradlinig und gefürchtet ... In ihrem aktuellen Buch rechnet die streitbare Anwältin mit der internationalen Politik ab."
Deutschlandfunk Kultur "Im Gespräch"
"Carla Del Ponte warnt davor, dass das internationale Recht zerfällt."
Der Spiegel
"Ihr neuestes Buch ist eine Anklage gegen UNO und Großmächte."
Der Tages-Anzeiger
"Sachlich, detailliert, glaubwürdig ... Carla Del Ponte will zeigen, dass internationales Recht unumgänglich ist und sich die kritisch beschriebene UNO, in der sehr oft ungeeignete Personen eingesetzt würden, reformieren muss."
Weltwoche
"Carla Del Ponte nimmt kein Blatt vor den Mund ... Sie vermittelt einmalige Einblicke."
Deutschlandfunk "Andruck"
"Del Ponte untertreibt, wenn sie sagt, sie sei keine Heldin. Schurken haben bei ihr nichts zu lachen. Um sie vor Gericht zu bringen, kämpft die ehemalige Schweizer Bundesanwältin verbissen und heldenhaft. ... Del Pontes Buch ist wichtig und lehrreich."
Sonntagszeitung
"Die ehemalige Chefanklägerin spricht über den syrischen Diktator Assad und die Untätigkeit der UNO."
Luzerner Zeitung
 Besprechung vom 13.07.2021
Besprechung vom 13.07.2021
Gegen den "Triumph der Straflosigkeit"
Die frühere Jugoslawien-Chefanklägerin Carla Del Ponte klagt wieder an
Was macht einen Menschen zum Helden? Muss er großen Mut zeigen? Das Wohl von anderen über das eigene stellen? Das Böse bekämpfen?Carla Del Ponte, frühere Chefanklägerin des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, will den Heldenstatus für sich jedenfalls nicht in Anspruch nehmen - auch wenn sie auf bemerkenswerte Erfolge wie die Verhaftung des früheren serbischen Staatsoberhaupts Slobodan Milosevic und zahlreicher anderer Kriegsverbrecher zurückblicken kann und ihrer Arbeit zeitweise nur unter Polizeischutz nachgehen konnte.
Der Titel ihres Buches lautet dennoch: "Ich bin keine Heldin - Mein langer Kampf für Gerechtigkeit". Die mittlerweile 74 Jahre alte Del Ponte klagt darin die internationale Strafjustiz und die Vereinten Nationen an und wirft ihnen vor, Menschen- und Völkerrechte nicht adäquat zu schützen und durchzusetzen. "Die UNO hat versagt - und ihr Mandat, für Frieden und Stabilität zu sorgen, nicht erfüllt", schreibt sie. Die Justiz sei zu abhängig von der Politik, und dieser fehle aufgrund von Einzelinteressen zu oft der Wille.
Die 1947 in der Schweiz geborene Del Ponte beruft sich dabei auf ihre jahrelangen Erfahrungen in der internationalen Strafjustiz. Nach einem Studium des internationalen Rechts war sie zunächst als Staatsanwältin des Kantons Tessin und später als Bundesanwältin der Schweiz tätig, bis sie 1999 als Chefanklägerin an die Internationalen Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien sowie für Ruanda berufen wurde. Nach acht Jahren in diesem Amt gab sie Ende 2007 den Posten in Den Haag ab und wurde in Argentinien Botschafterin für ihr Heimatland. 2011 wurde sie pensioniert, wurde jedoch noch im selben Jahr Mitglied einer UN-Kommission, die Menschenrechtsverletzungen im Bürgerkrieg in Syrien untersuchte. Nach sechs Jahren warf sie hin: Obwohl die Berichte der Kommission ihrer Ansicht nach mehr als genug Material boten, beauftragte der UN-Sicherheitsrat den Internationalen Strafgerichtshof nie mit Ermittlungen. "Ein Triumph der Straflosigkeit", schreibt Del Ponte.
In ihrem Buch gibt sie Einblick in ihre Arbeit - und vor allem in die Schwierigkeiten, die ihr als Chefanklägerin und Kommissionsmitglied begegneten. Immer wieder sei ihre Behörde bei den Ermittlungen gegen "Gummiwände" gelaufen: Staaten, die trotz öffentlicher Zusagen nicht kooperierten - eigene Befugnisse hat der Gerichtshof in Den Haag kaum -, ein zu geringes Budget, um umfassend gegen alle Verdächtigen ermitteln zu können, und Druck der geldgebenden Staaten, wenn die Ermittlungen in eine unerwünschte Richtung gingen. So erzählt Del Ponte, wie die USA sie zur Persona non grata erklärten, als sie Vorwürfen gegen die NATO im Jugoslawien-Krieg nachgehen wollte. In Ruanda sei sie ebenfalls von den Amerikanern ausgebremst worden, als sie 13 mutmaßlich von Tutsi verübte Massaker untersuchen wollte.
Überhaupt sind es die größeren Mitgliedstaaten, die Del Ponte in die Pflicht nimmt. Es sind die Staaten, die durch ihren ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat großen Einfluss haben - wie Russland, das wiederholt Resolutionen zu Syrien blockiert hat. Aber auch den USA, die bis heute das Abkommen zum Internationalen Gerichtshof nicht ratifiziert haben, wirft Del Ponte zu wenig Engagement vor. Ein Einsatz der Vereinigten Staaten hätte zumindest Ermittlungen gegen den IS in Syrien ermöglichen können, mutmaßt die frühere Chefanklägerin. Auch die dringend nötige Reform der UN könne nur auf Initiative der USA gelingen.
Mit ihrer Kritik an dem Staatenbund und dem Ruf nach Reformen ist Del Ponte freilich nicht allein. So hatte etwa Bundeskanzlerin Merkel anlässlich des 75. UN-Jubiläums im vergangenen Jahr mangelnden Gemeinschaftssinn beklagt. Doch kaum jemand findet so klare Worte wie Del Ponte, die schon immer als unbequem galt und sich noch nie groß Sorgen gemacht hat, wem sie auf die Füße treten könnte. Die Untersuchungskommission in Syrien bezeichnet sie etwa als "Alibi-Kommission", den Mitarbeitern der UN-Zentrale in New York wirft sie vor, Zeit und Geld mit Schwätzchen und ergebnislosen Meetings zu verplempern.
Als ehemalige Staatsanwältin weiß Del Ponte, wie sie überzeugen kann. Sie setzt kaum Wissen voraus, sondern führt zunächst in die Grundlagen des Völkerrechts, die internationale Strafjustiz und historische Begebenheiten ein. Dabei verzichtet sie auf Fachbegriffe, fasst sich stets kurz und verliert sich nie auf Nebenschauplätzen, sondern führt anhand ihrer Erlebnisse konsequent vor, wie abhängig die internationale Strafjustiz von Einzelinteressen ist - und plädiert dabei immer wieder für eine konsequente Durchsetzung des Völkerrechts, um Opfern Gerechtigkeit zu geben und weitere Täter abzuschrecken. So schildert Del Ponte ein Gespräch mit einer Frau aus Bosnien, die im Jugoslawien-Krieg mehrfach vergewaltigt und deren drei Kinder ermordet wurden. Der Täter wurde zwar gefasst, doch sie hatte kein Vertrauen in die nationale Justiz. "(Sie) hat mich weinend darum gebeten, dass (der Täter) vor den Internationalen Gerichtshof kommt." In Den Haag wurde er zu 27 Jahren Haft verurteilt.
Natürlich ist Carla Del Ponte eine Heldin, ist man nach der Lektüre geneigt zu sagen. Ihre immer wieder durchschimmernde Selbstgerechtigkeit ist die größte Schwäche des Buches, macht aber ihren Kampf für die Gerechtigkeit anderer nicht weniger lesenswert.
JULIA ANTON.
Carla Del Ponte: "Ich bin keine Heldin". Mein langer Kampf für Gerechtigkeit.
Westend Verlag, Frankfurt 2021. 176 S., br.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 23.04.2022
Bericht der ehemaligen Chefanklägerin des Int. Strafgerichtshofs über ihr Wirken, (Miss-)Erfolge und massiv ausbremsende politische Willkür
am 27.06.2021
Regt zum Nachdenken an
In diesem Buch berichtet Carla Del Ponte von ihrer Arbeit als Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofes für die Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien sowie für den Völkermord in Ruanda in Den Haag in den Jahren 1999 bis 2007.
Sie schildert Triumphe und Niederlagen, schildert, welche Prügel ihr zwischen die Füße geworfen wurden, wenn es um US-Militäraktionen ging. Denn die USA war (ist?) als größter Geldgeber des Internationalen Strafgerichtshofs für Kriegsverbrechen nicht wirklich daran interessiert, die eigenen Truppen in einem schlechten Licht zu sehen.
Von den 161 Kriegsverbrecher die Carla Del Ponte aufspüren konnte, wurden 91 Personen vor Gericht gestellt und 63 davon wurden dann auch tatsächlich verurteilt. Trotz dieses Erfolgs, sieht sie sich selbst nicht als Heldin. Ihr war es wichtig, den Opfern eine Stimme zu geben.
Fazit:
Ein eindringliches Buch, das so manche Frage aufwirft. Gerne gebe ich hier 5 Sterne.









