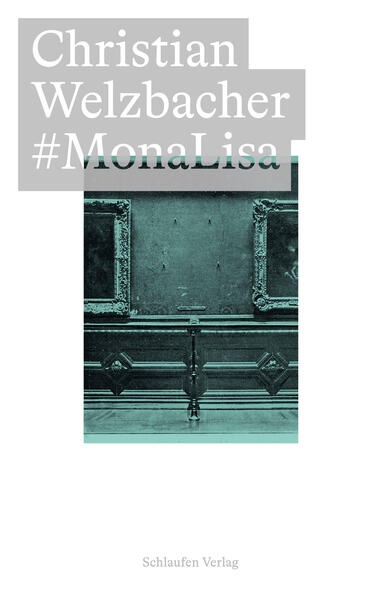Besprechung vom 16.04.2025
Besprechung vom 16.04.2025
Selfies im Louvre
Christoph Welzbacher sieht sich an, wie ein Bild fotografiert wird
Der Blick auf Leonardo da Vincis "Mona Lisa" im Pariser Louvre ist für die meisten der beständig in die Salle des États strömenden Betrachter versperrt durch gezückte Smartphones. Ziel der Begegnung mit Da Vincis Gemälde, so diagnostiziert der Kunsthistoriker Christian Welzbacher, sei weniger ein ästhetisches Versinken als vor allem die Botschaft "Ich war da!" an die digitale Followerschaft durch die Inszenierung vor der Smartphone-Innenkamera und das anschließende Teilen des Selfies in den sozialen Netzwerken. Da das materielle Gemälde nach seiner Diagnose im Bilderspektakel verloren geht, ist es auch konsequent, dass sich der Autor in seinem Essay "#MonaLisa" weniger auf das Gemälde als auf den Hashtag konzentriert.
Welzbacher nimmt das Geschehen in der Salle des États zum Leitfaden einer Beschreibung des Rezeptionsverhaltens von Museumsbesuchern und begibt sich auf die Suche nach der von solcher Praxis aufgelösten Aura. Verglichen wird von ihm das tatsächliche Verschwinden der "Mona Lisa", die 1911 entwendet und erst 1914 wieder zurückgebracht wurde, mit ihrem "Verlust" durch den Fokus auf das per Smartphone medial ausgesendete "Ich war da!"
Welzbacher skizziert daraufhin die Geschichte der Kunstform Fotografie, welche in einer Verschiebung der Authentizität weg von den Motiven der Darstellung und hin zu ihren Mitteln resultiert. Damit begräbt er auch nachvollziehbar die Annahme, Fotografie könne bloße Abbildung von Realität sein. Mit dem Begriff des "Framing" legt er schließlich dar, inwiefern mediale Verweisstrukturen - etwa die Selbstdarstellung als kulturaffiner Städtetourist im Fall der fotografierten "Mona Lisa" - die Verbindung zum ursprünglichen Kontext (da Vinci, Renaissance, Sfumato) kappen und für eine Neubewertung öffnen. Dieser "Medienreflex" ist für den Autor die Ursache, warum die Mona Lisa als fotografiewürdig empfunden wird, ohne begründen zu können, wieso dem eigentlich so ist. Etwas überzogen leitet er aus solcher Medialisierung bereits den Tod des Arguments ab.
Die massive kulturindustrielle Ausschlachtung der "Mona Lisa", die mit ihrem Diebstahl einsetzt, mündet für Christian Welzbacher nicht nur in ihrer Reproduktion auf allen möglichen Souvenirartikeln, sondern führt ihn auch auf das nicht unbedingt originelle Fazit dieses zwischen Kunstgeschichte und Feuilleton-Soziologie changierenden Essays, "dass die Menschen keinen Blick mehr für das Kunstwerk" haben. FLORIAN HEIMHILCHER
Christian Welzbacher: "#MonaLisa". Über die Verwertung der Wirklichkeit: Fotografie, Reproduktion, (Bild-)Medien.
Schlaufen Verlag, Berlin 2024. 128 S., Abb., br.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.