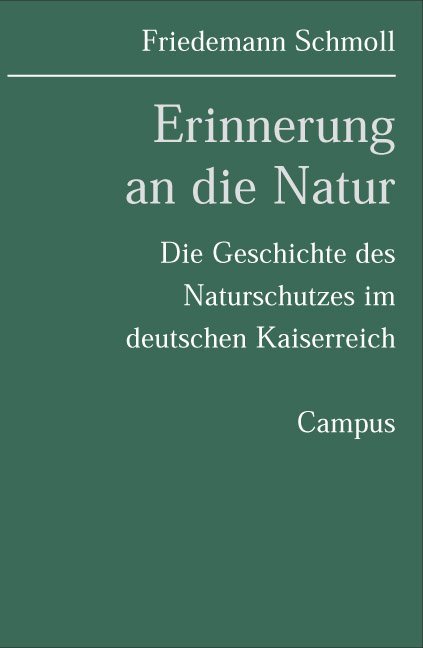Mit der Industrialisierung wurde Natur von der bedrohenden zur bedrohten Größe. Die Gründungswelle von Naturschutzorganisationen im Kaiserreich zeigt, dass die Naturfrage für immer mehr Menschen zu einer Frage des Gemeinwohls wurde. Der Autor schildert die Geschichte des frühen Naturschutzes und dessen Widersprüchlichkeit: Während Natur in Schutzgebieten als unantastbar ausgewiesen wurde, entfalteten sich außerhalb industrielle Systeme als Verursacher der Natur- und Umweltschädigungen.
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Geleitwort 9
Einführung 11
1. "Die Kultur als Hauptfeind der Natur": Zeitdiagnosen und Wirklichkeitsbeschreibungen 14
2. Selbstfindungsliteratur, Modernisierungstheorie,
Umweltgeschichte: Zum Stand der Forschung 26
3. Zur kulturellen Logik der Naturbewahrung 51
ERSTER TEIL: DIE NEUERSCHAFFUNG DER WELTNATUR UND LANDSCHAFT IM ZEITALTER DER INDUSTRIALISIERUNG
1. Der Weg aus der Natur 61
2. Bevölkerung 63
3. Landwirtschaft 65
4. Wald- und Forstwirtschaft 69
5. Die großen Städte 71
6. Energie/Luftverschmutzung 75
7. Verkehr 78
8. Wasser 81
9. Abfall 87
10. Zusammenfassung 89
ZWEITER TEIL: NATURBEWAHRUNG UND KULTURELLES GEDÄCHTNIS
1. Heilige Bäume 93
2. Merkwürdigkeiten: Baumgeschichten zwischen
Ressourcennutzung und Naturbewahrung 100
2. 1 Gottfried Kellers "Die Leute von Seldwyla": Die Zerstörung
der Natur und der Verlust von Heimat 100
2. 2 Forstwirtschaft und Waldromantik: Zur Entzauberung
und Wiederverzauberung des Waldes 104
2. 3 Sichten, Inventarisieren, Schützen: Die systematische Erfassung
der forstbotanischen Merkwürdigkeiten 107
2. 4 Träume des Ursprungs: Wildnis als Leitbild bei Wilhelm Heinrich Riehl 111
3. Ursprung und "Eigenart": Staat und Naturschutz in Preußen und im Deutschen Reich 113
3. 1 "Gefährdung der ursprünglichen Natur
durch die fortschreitende Kultur": Hugo Conwentz,
Wilhelm Wetekamp und die Gründung der
"Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege" in Preußen 113
3. 2 Natur und Zeit: Zur Allianz von Naturbewahrung und Geschichtsbewußtsein 121
3. 3 Relikte, Lebensräume, Landschaften: Zur Differenzierung
des Krisenbewußtseins in der Naturdenkmalpflege 138
3. 4 Ästhetik als Versöhnung: Naturdenkmalpflege und Industriegesellschaft 144
3. 5 Netzwerke des Naturschutzes: Aus der Arbeit der
"Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege" 1906-1918 148
3. 6 "Konwentzioneller" Naturschutz und
"Naturdenkmälerchensarbeit": Zeitgenössische Kritik am staatlichen Naturschutz 150
3. 7 Das Tabu des Eigentums: Zum Scheitern der Initiative
für ein preußisches Gesetz der Naturdenkmalpflege 155
3. 8 Erhalten und Gestalten: Die staatliche Organisation
des Naturschutzes außerhalb Preußens 161
3. 9 Der Schutz natürlicher "Eigenart": Nationale und internationale Natur 171
4. Vereine und Verbände - Facetten der privaten Naturschutzarbeit im Kaiserreich 179
4. 1 Staatliche Verpflichtung und gesellschaftliche Selbstorganisation 179
4. 2 Selbstbildung und politische Partizipation: Zur Soziologie des Vereinswesens 181
4. 3 Wissenschaft, Kulturkritik, soziales Engagement:
Programmatische Akzente und historische Traditionen
bürgerlicher Vereinskultur 182
4. 4 Jenseits von Klasse und Geschlecht? Natur und Gesellschaft 184
4. 5 Zur gesellschaftlichen Bedeutung der Naturschutzverbände im Kaiserreich 190
4. 6 Heimat, Region, Vaterland: Natur und Nationsbildung 193
5. Profile und Portraits 196
5. 1 Landschaft als sozialer und ästhetischer Raum:
Der "Verschönerungsverein für das Siebengebirge" und
der "Verein zur Rettung des Siebengebirges" 1869-1922 197
5. 2 Die Natur in der Stadt im Schnittfeld ökonomischer und
öffentlicher Interessen: Der Münchner "Isartalverein" von 1902 203
5. 3 Kultivierung und Erhaltung der alpinen Natur: Der "Verein
zum Schutze und Pflege der Alpenpflanzen" von 1900 208
5. 4 Die Reservation unantastbarer Natur:
Der "Verein Naturschutzpark" von 1909 212
5. 5 Das Scheitern einer Sammlungsbewegung:
Der "Bund zur Erhaltung der Naturdenkmäler" von 1909 224
6. Zusammenfassung 230
DRITTER TEIL: MENSCH UND TIER
1. Zwischen Ausbeutung und Anbetung - Beziehungsgeschichten zwischen Mensch und Tier 237
2. Bedroht, verfolgt, ausgestorben - die Tierwelt und der Naturschutz 243
3. Identifikation und Indikation: Die Vögel und die Vogelschutzbewegung 249
3. 1 Traditionen und Legitimationen: Gefiederte Freunde
und nützliche Helfer 253
3. 2 Der bürgerliche Verein: Zur Institutionalisierung
des Vogelschutzes 263
3. 3 Konfliktfelder und Problembewußtsein - Strategien, Konzepte
und Handlungsfelder des organisierten Vogelschutzes 271
3. 4 Utilitarismus oder Selbstzwecklichkeit - Standpunkte
der Vogelschutzbewegung 289
4. Vom Verzehr zum Verzicht - der Vogelfang und ein modernes Nahrungstabu 293
4. 1 Naturnutzung versus Naturbewahrung - die Etablierung
eines modernen Nahrungstabus 294
4. 2 Skizzen zur Geschichte des Vogelfangs in Deutschland 301
4. 3 Nutzen, Schönheit, Moral - Bedingungen des Tabuisierungsprozesses und
klassifikatorische Kriterien der Naturbewahrung 337
5. Zusammenfassung 379
VIERTER TEIL: HEIMAT UND LANDSCHAFT[. . .]