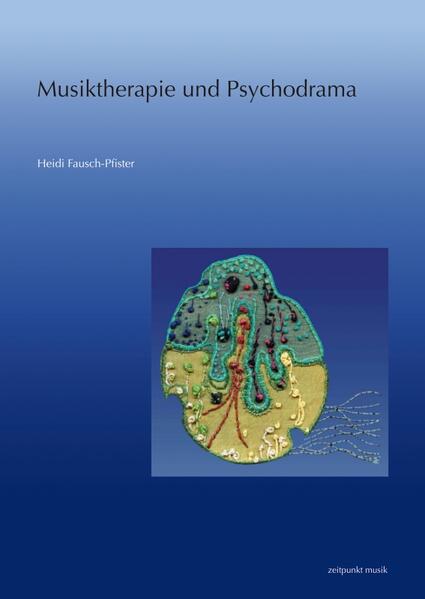Dabei ist, bei aller Konkretheit der Darstellungen von therpeutischen Situationen und Mitteln in gebotener Kürze, die Gefahr von vereinfachenden Kochrezepten vermieden. Klare Vorstellungen zu dem, was mit den jeweiligen Mitteln in der geschilderten Situation erreicht werden soll, und die unbefangene Nutzung der von den beiden Konzepten bereitgestellten Instrumente sollen besonders hervorgehoben werden. Sowohl psychotherapeutische / musiktherpeutische Anfänger als auch Erfahrene werden das Büchlein mit Gewinn nutzen können.
von: Dr. Helmut Röhrborn
In: Musiktherapeutissche Umschau 2017
-----------------------------------------------------
Ein durchaus interessantes Buch, das viele Ideen und Anregungen bietet, wie das Potential der Instrumente weiters genutzt werden kann. Fraglich bleibt, ob es ohne psychodramatischen Hintergrund in die musiktherapeutische Praxis übernommen werden kann.
Von Susanne Winter
In: Österreichische Berufsverband der MusiktherapeutInnen. Mitteilungsblatt 3-12, S. 12.
--------------------------------------
Das Buch ist auf jeden Fall gerade dem täglich praktizierende Musik- und Tanztherapeuten wärmstens zu empfehlen. Allerdings sollte ihm gleichzeitig auch angeraten sein, Inhalte aus verschiedenen theoretischen Positionen kritisch zu betrachten und sich seines eigenen professionellen Standorts bewusst zu werden. Sonst könnte es passieren, dass die so effizienten Methoden im Integrationsfeld von Musiktherapie und Psychodrama zum bloßen Vollzug von Rezeptologie verknappen und damit an der Individualität des Patienten sowie am feinen Beziehungsgewebe von Mensch und Musik vorbeischleifen. Und das wäre gewiss nicht im Sinne der Autorin, deren Vita durch eine immense Breite an Praxis- und Lehrerfahrung besticht.
Von Prof. Dr. Dr. Dr. Wolfgang Mastnak
In: Musik-, Tanz- und Kunsttherapie 2/12, S. 109-110.
--------------------------------------
Das Buch ist wohl in erster Linie für MusikthrapeutInnen geschrieben, die ihr methodisches Repertoire erweitern oder auch die Nachhaltigkeit ihrer Interventionen mit psychodramatischen Mitteln verstärken wollen. Sie gewinnen mit dieser Arbeit nicht nur eine gute Einführung in das Psychodrama und einen ersten Einblick in die Möglichkeiten des Psychodramas im musiktherapeutischen Rahmen, sondern bereits fundierte und sehr anschaulich dargestellte methodische Grundlagen für ihre Arbeit. (. . .) Das Buch ist aber auch für Studierende von besonderem Interesse, die die Nützlichkeit von Morenos Psychodrama für eine psychodynamisch orientierte Musiktherapie kennenlernen wollen und hier eine theoretisch kompetente Darstellung der Bezüge zwischen Musiktherapie und Psychodrama finden. Das die Autorin für beide Richtungen in der Fachliteratur recht bewandert ist zeigt nicht nur das umfangreiche Literaturverzeichnis, das in ausgewogenem Verhältnis psychodramatische und musiktherapeutische Quellen berücksichtigt, sondern auch die hervorragende Integration dieser Quellen in die theoriedarstellenden Passagen.
Prof. Dr. Wolfgang Krieger
In: socialnet (2010). S. 1-4.
------------------------------------
Die Autorin veranschaulicht diese Wirkung mit eindrücklichen Praxisbeispielen aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Neurologie und Therapien mit Erwachsenen, welche differenziert analysiert werden. Verschiedene psychodramatische Techniken und Instrumente ergänzen die musiktherapeutische Interventionspraxis. Es wird erläutert, welche vertiefenden Funktionen psychodramatische Instrumente und Techniken im musiktherapeutischen Prozess übernehmen können. Sie wirken besonders fruchtbar bezüglich der Intensivierung und Strukturierung des Prozesses sowie der Fokussierung von Themen und des Transfers des Gelernten ins Leben und von Problemen des Lebens in die Therapie. Die Umsetzung in die Praxis wird mit Spielvorschlägen und methodischen Hinweisen unterstützt. Das Buch ist eine interessante Lektüre für Studierende der Musik- und Kunsttherapie, Therapeuten, Pädagogen, Musiklehrer und interessierte Laien.
In: Not durch Hirnverletzung, Schlaganfall oder sonstige erworbene Hirnschäden. 1/2013. S. 51.
------------------------------------
Heidi Fausch hat als Musiktherapeutin sich vor Jahren zusätzlich zur Psychodramaleiterin ausgebildet. Heute kombiniert sie beide Methoden und legt hier einen auch theoretisch gut fundierten Praxisbericht vor.
Das Buch hält sich in seinem Aufbau an das Theoriegebäude von Jakob Morenos Psychodrama, sein Persönlichkeitsmodell, seine Theorie der Beziehung und seine Strukturen im Ablauf von psychotherapeutischen Sitzungen. Die Grundlagen der Musiktherapie werden aber natürlich auch gründlich erklärt und es ist erstaunlich, wie viele Parallelen Heidi Fausch zwischen
den bei den erlebnisorientierten Therapierichtungen ausmachen kann. Dieser Aufbau macht das Buch sehr lesbar, die Vignetten und Perlen aus dem riesigen Erfahrungsschatz der Autorin werden theoretisch verortet und nachvollziehbar, und die praktizierte Methodenkombination bekommt einen wissenschaftlich fundierten Boden.
Für viele Psychotherapeuten ist Psychodrama ausschliesslich eine Gruppentherapiemethode. Dem ist aber nicht so! Sowohl die reinen Psychodramatherapeuten wie auch die Autorin selbst brauchen die Methode immer mehr auch in Einzel- und Paartherapien, Die Interaktionspartner - innere Persönlichkeitsanteile oder reale Personen aus dem Leben der Patienten - werden dann eben durch Puppen, oder bei Heidi Fausch durch Musikinstrumente, dargestellt. Und gerade durch die Wahl von Musikinstrumenten bekommen rein kognitiv nicht fassbare Gefühle und Irritationen plötzlich ein Symbol und nach der Arbeit auf der Symbolebene wird ein Transfer in den Alltag besprechbar.
Sicher, das Buch bringt keine statistischen Goldstandardbeweise, dass diese Methodenkombination klinisch wirksam ist, und leider fehlen auch Überlegungen zu Indikation und Kontraindikation, wobei letzteres eigentlich meine einzige kleine Kritik ist. Aber die Liebe der Autorin zu ihren Patienten und ihre Freude am gemeinsamen kreativen Tun sind auf jeder Seite spürbar.
Das Buch ist ein Mutmacher in einer Zeit, wo alles evidence based sein soll und ein Nicht-Verhaltenstherapeut oder ein Nicht-Psychopharmakaspezialist immer wieder Angst haben muss, als unwissenschaftlicher Scharlatan abqualifiziert zu werden. Das Ziel unserer Arbeit als Psychotherapeuten soll ja nicht nur eine «Goldstandardgesundheit» sein -, jeder Patient müsste dann
genaue Kriterien erfüllen, um «geheilt» zu sein -, sondern auch eine «Regenbogenstandardgesundheilt»: Jeder soll möglichst so leben können, wie es seinem Charakter und seinen Möglichkeiten entspricht.
Gerold Roth, Zürich
In: Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie. 163 (2012) 1. S. 44-45.