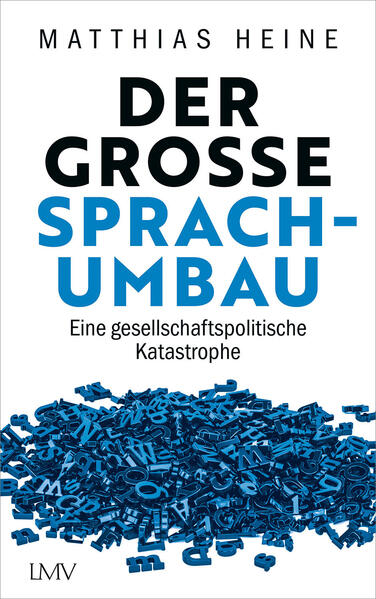
Zustellung: Do, 17.07. - Sa, 19.07.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Die deutsche Sprache ist in nie gekanntem Maße zum politischen Kampfplatz geworden. Es geht längst nicht mehr um einzelne Wörter, es geht um die gesamte Struktur des Deutschen, die Aktivisten umbauen wollen, um so die Gesellschaft in ihrem Sinne zu verändern. Die Angreifer treten wie gewohnt im Namen des Fortschritts auf - speziell eine Linke, deren Unbehagen an der deutschen Sprache, an allem Deutschen, bis zum Hass reicht. Der Journalist und Linguist Matthias Heine benennt die Akteure und beschreibt die Methoden und Motive der Sprach- und Weltveränderer. Und er legt die Verbindungen zu einer »deutschen« Linken offen, die sich als »Internationale der Diskriminierten« neu zu erfinden sucht. "Und als ich die deutsche Sprache vernahm, Da ward mir seltsam zu Muthe; Ich meinte nicht anders, als ob das HerzRecht angenehm verblute."Heinrich Heine (1797-1856)
Produktdetails
Erscheinungsdatum
17. Februar 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
240
Autor/Autorin
Matthias Heine
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Abbildungen
0 Abb.
Gewicht
332 g
Größe (L/B/H)
211/133/23 mm
Sonstiges
Klappenbroschur
ISBN
9783784437309
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 23.05.2025
Besprechung vom 23.05.2025
Die Tochterin hat nicht viele Geschwister
Eine gesellschaftliche Katastrophe? Matthias Heine knöpft sich die Freunde des Genderns und anderer Sprachumbauten vor
Donald Trump hat die Diskriminierung abgeschafft. Was klingt wie Fake News, stimmt tatsächlich, allerdings bezieht es sich natürlich nicht auf eine unter Trump vollzogene Beseitigung gesellschaftlicher Ungerechtigkeiten, sondern allein auf das Wort. "Discrimination", "discriminated", "discriminatory" nämlich zählen zu den mehr als zweihundert Begriffen, die Regierungsmitarbeiter laut der "New York Times" in offiziellen Erklärungen und Dokumenten nicht mehr oder nur noch eingeschränkt verwenden dürfen. Das Ziel dieser Vorgaben ist eine Umerziehung: Ein Unrecht, das nicht benannt werden darf, soll durch aggressive Sprachpolitik als eines erscheinen, das es gar nicht gibt.
Der "Welt"-Redakteur Matthias Heine ist bei seiner Zeitung unter anderem für Sprachkritik zuständig, weshalb es ihm oblag, diesen Aspekt des Trumpschen Kulturkampfes in einem Artikel zu kommentieren. Er schrieb darin von einer "politischen Gegenoffensive", die "außergewöhnlich breit" ausfalle. Sprich: Die anderen haben halt angefangen. Nun zählen im Sündenregister des amerikanischen Präsidenten die neuen Sprachverbote noch zu den lässlicheren; angesichts des Tempos, in dem seine Bewegung Staat und Gesellschaft umkrempelt und die Freiheit nur noch den genau Gleichdenkenden zugesteht, würde einen schon interessieren, ob in bestimmten Medienhäusern am bewährten Geschäftsprinzip, grundsätzlich linksgrüne Gefahren großzuschreiben, wenigstens leise Zweifel aufkommen.
Auch Matthias Heines eigenes neues Buch wirkt ein wenig aus der rechtsautoritär geprägten Zeit gefallen, wendet es sich doch gegen eine "merkwürdige Allianz aus linken, grünen und kapitalistischen Fortschrittshysterikern", welche die gute alte deutsche Sprache malträtiere. In all den mal kleineren, mal größeren Auswüchsen einer, so Heine, "modernen Weltverbesserungsgrammatik" aber nichts Geringeres als "eine gesellschaftliche Katastrophe" zu sehen, wie der Untertitel seines Buches lautet, das drückt, angesichts der weltpolitischen Katastrophen unserer Gegenwart, neben ausgeprägtem Verkaufswillen auch mangelndes Sprachgefühl aus.
Das verwundert, weil Heine sein Metier eigentlich beherrscht. Er hat schon über die deutsche Sprache geschrieben, als sich Germanisten das Terrain noch nicht mit Genderwissenschaftlern teilen mussten, und er kennt sich bestens aus. Auch in seinem Buch erzählt er in einem umfangreichen historischen Exkurs erst einmal, wie die deutsche Rechtschreibung überhaupt zu einer wurde, die sich nach Regeln richtet, und welche Kämpfe schon früher ausgefochten wurden. Martin Luther, Johann Christoph Gottsched, Martin Opitz, Konrad Duden, die Brüder Grimm und Theodor Siebs werden gewürdigt. Mit der gebotenen Ausführlichkeit schildert er auch, wie es zu der alles in allem verkorksten Rechtschreibreform von 1996 kam, die mehrere Rollen rück- und vorwärts zur Folge hatte und selbst vielen professionell Schreibenden schließlich die Sicherheit raubte. Für Heine ist diese Reform "die Urszene einer Politik- und Expertenverdrossenheit", deren Muster sich vielfach wiederholt habe: "Die Politik beschließt etwas, das so eigentlich kaum jemand will, das aber ihre Berater für sinnvoll halten."
Den neueren Formen der Sprachkritik, schreibt Heine, liege "ein Unbehagen an der Muttersprache" zugrunde, "das es so intensiv und vielfältig nur in Deutschland" gebe. "Die Wurzeln dieser Angst liegen in der Humboldtschen Vorstellung, Sprache präge und begrenze das Denken gerade unentrinnbar. Diese Überschätzung der Sprache liegt auch der spezifisch im deutschsprachigen Raum wirksamen historischen Sprachkritik zugrunde, für die Namen wie Karl Kraus oder Victor Klemperer oder Titel wie ,Aus dem Wörterbuch des Unmenschen' stehen." Wenn allerdings Heine, der sich, wie gesagt, selbst als Sprachkritiker betätigt, die Sprache für überschätzt hält, träfe das dann nicht auch auf deren - von ihm als Katastrophe bezeichneten - Umbau zu?
Punkt für Punkt und Komma für Komma arbeitet Heine die sprachpolitischen Streitfelder unserer Zeit ab: den Kampf gegen die Vorherrschaft des vermeintlich diskriminierenden generischen Maskulinums ebenso wie die vermeintlich integrative "leicht verständliche Sprache", die er in unguter Tradition ("Kolonial-Deutsch") als Ausdruck "paternalistischer Herablassung" einordnet. Dem Gendern wiederum, das eigentlich mehr Gleichheit schaffen soll, hält er mit Recht entgegen, dass es gerade "zu einer permanenten Betonung von Geschlechterdifferenzen" führe. Heines Behauptung indes, "immer häufiger" würden abstruse Gender-Formen verwendet wie "Gästin, Mitgliederin und Tochterin", hält einer näheren Betrachtung nicht stand. Die Gästin beispielsweise fand sich schon 1830 im "Deutschen Wörterbuch" der Grimms, und für die "Tochterin" fördert die Suche im F.A.Z.-Zeitungsartikelarchiv aus den vergangenen zwei Jahrzehnten ganze zwei Treffer zutage: Es handelt sich um zwei Texte der "Welt", die sich empören über ebenjene "Tochterin" - welche man getrost als Phantomwort bezeichnen darf.
Mit polemischer Schärfe schilt Heine die Sprachreformer als Ignoranten, denen die "unendlich komplexe Struktur" der deutschen Sprache ein Gräuel sei wie alles, "was nicht so übersichtlich ist wie die Schaltkreise ihrer eigenen Mittelmäßigkeit". Er zieht den Vergleich zu Orwells "Neusprech", um ihn - Heine ist kein Steinzeitkrieger - am Ende doch zu relativieren: Wir lebten "nicht in einer Sprachdiktatur. Niemand foltert uns - außer mit schlechtem Deutsch. Wir stehen nicht unter der Fuchtel eines einzigen Großen Bruders, sondern werden nur gegängelt von einem Heer kleiner besserwisserischer Brüderchen, Schwesterchen und anderer nonbinärer Geschwister." Apropos: Der gesellschaftliche Wandel bei den Geschlechtsidentitäten erzürnt Heine offenkundig noch mehr als der Sprachumbau, wie einige überflüssige Seitenhiebe gegen Transfrauen belegen ("geschminkte Männer mit Perücken", "bärtige Penisträger").
Bei einem Buch, das sich mit Sprache befasst, ist es wohlfeil und doch unerlässlich, auf sprachliche Korrektheit zu achten. Also denn: Es gibt mindestens einen falsch verwendeten Konjunktiv ("gäbe"/"gebe"), einen "dass"/"das"-Fehler, und in den Namen der Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt fügt Heine gleich zwei h ein, die dort nicht hingehören. An anderer Stelle erwähnt er den Illustrator Walter Trier, der "den ikonischen Umschlag für Erich Kästners Buch ,Emil und die Detektive' mit dem Jungen hinter der Litfaßsäule" entwarf, und hier ist unklar, ob ein "dem"/"den"-Tippfehler vorliegt oder eine falsche Erinnerung: Hinter der Litfaßsäule nämlich stehen zwei Jungen. Sollten sich auch in dieser Rezension sprachliche Fehler finden, so bitten wir vorsorglich um Nachsicht, auch wenn in diesem Fall nicht wir alleine schuldig wären - sondern auch die unendlich komplexe Struktur der deutschen Sprache. JÖRG THOMANN
Matthias Heine: "Der große Sprachumbau". Eine gesellschaftspolitische Katastrophe.
Langen Müller Verlag, München 2025.
235 S., br.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.








