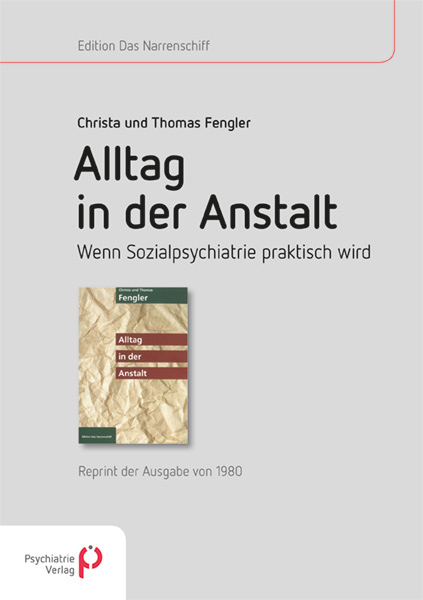
Zustellung: Fr, 16.05. - Mo, 19.05.
Versand in 4 Tagen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Dieses Buch ist ein Reprint der Ausgabe von 1980. Anstalten dienen der Reglementierung psychischer und sozialer Unordnung, der Bändigung von Spontanität, kurz: der Dressur. Anstalten haben ihre eigene innere Ordnung, deren oberstes Leitprinzip das reibungslose Funktionieren ist. Christa und Thomas Fengler spürten 1980 dem Alltagsleben solcher Anstalten nach. Sie taten das am Beispiel einer psychiatrischen Klinik. Sie hätten ebensogut eine Justizvollzugsanstaltr, ein Internat, vielleicht sogar ein Warenhaus auswählen können. Wer in der Psychiatrie zu Hause ist, wird sich rasch auf vertrautem Boden fühlen - aber auch wer in anderen großen Institutionen arbeitet, lebt oder sich ausbilden lässt, wird seinen Alltagserfahrungen in diesen Geschichten voller soziologischer Erkenntnisse wiederbegegnen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort (Klaus Dörner) 5
Vorbemerkung 17
Teil A
'Sicherheit' und 'geordnete Verhältnisse' - eine Ethnographie
1. Einleitung 21
2. Objektschutz und Schutz vor Objekten 26
3. 'Auf die Patienten eingehen' 35
4. Kontrolle als Fürsorge 39
5. Raumordnung und Sicherheit 45
Die offenen Kanäle 47
Mitpatienten und Sicherheit 49
Öffentlichkeit und Zugänglichkeit 50
Bettenverteilung 51
Drinnen und draußen 54
6. Entschärfungspraktiken 63
Fixieren 63
Trennen 66
Medikamente 67
Teil B
Die Sozialstruktur der Station als Werk der Mitglieder
1. Unsere theoretische Perspektive: Die soziale Welt von einem Hilfsmittel der Untersuchung in ihren Gegenstand verwandeln 77
2. Krank oder nicht krank - Wie wird Verantwortlichkeit festgestellt? 86
Die alltagspraktische Theorie sozialer Abweichung 88
Das Personal als praktischer Theoretiker der Verantwortlichkeit 91
3. Der methodische Entzug von Glaubwürdigkeit 102
Äußerungen von Patienten wie 'Behauptungen behandeln' 102
'Gute Gründe' für den Entzug von Glaubwürdigkeit 106
Praktiken der Überprüfung 112
4. Die Loyalitätsmaxime 117
Die dokumentarische Methode der Interpretation 119
Der vorausschauend-rückschauende Charakter der dokumentarischen Methode der Interpretation 132
Ein erster Blick auf die Reflexivität praktischer Erklärungen 143
5. Wozu Medikamente? 148
Die Diskussion 148
Praktische Arbeitsinteressen und Wirklichkeitssicht 155
6. Noch einmal 'Sicherheit' 164
'Unruhe im Personal' als Konsequenz und die Konsequentialität des Motivs
'Unruhe im Personal vermeiden' 170
Über den erfolgreichen Umgang mit sicherheitsbezogenen praktischen Erklärungen 175
Die 'Praxis' als Entscheidungsinstanz 175
'Wir müssen es riskieren' 177
'Es soll nur eine Ausnahme sein' 178
'Anordnung von oben' 179
7. "Das tun wir gern, wenn wir Zeit haben" - Die Analyse einer unangefochtenen praktischen Erklärung 181
Routinearbeiten des Pflegepersonals 182
Was formuliert und bewirkt der Satz "Das tun wir gern, wenn wir Zeit haben"? 187
Ausnahmen 192
Ein Fall von Überzeugung 193
Ein Dilemma sozialpsychiatrischer Praxis 195
8. Was heißt hier 'Gleichbehandlung'? 199
Gleichbehandlung als Gegebenheit des Settings 201
Gleichbehandlung aus der Perspektive des Pflegepersonals 205
Das Motiv: Unruhe unter den Patienten vermeiden 205
Das Motiv: Zwietracht innerhalb des Personals vermeiden 208
Gleichbehandlung aus der Perspektive des therapeutischen Personals 211
9. Regeln und Regelgebrauch - Die Bedeutung der 'praktischen Umstände' 216
'Soziale Ordnung' von einem Problem des Soziologen in ein Problem der Mitglieder verwandeln 216
Kompetenter Regelgebrauch als interpretativer Prozeß 219
Der buchstäbliche und der intelligente Gebrauch von Regeln - Von der Notwendigkeit 'mitzudenken' 220
Es hängt immer davon ab 226
Wer? 227
Wann? 235
10. Über den Unterschied zwischen 'praktischer' und 'wirklicher' Überzeugung 240
Der Adressat hält die praktische Erklärung für falsch und wird dennoch überzeugt 241
Der Adressat hält die praktische Erklärung für unwahr - das Problem der 'Manipulation' 245
Teil C
Die Organisation von 'Krankengeschichten'
Einleitung 255
I. Wie kommt der Arzt zu einer Diagnose - das Kongruenzphänomen
1. Die Wirklichkeit ist nicht identisch mit einer Darstellung der Wirklichkeit - ein Paradox 261
2. Stimmt die Darstellung mit dem Wissen des Hörers überein? 266
'Wie sind Sie hierhergekommen?' - Die Folgen einer harmlosen Frage 267
Die 'Bedingung der Möglichkeit' von Objekten 270
'Unmögliche' Ereignisse 272
Die Relativität des Realen 279
3. Ist die Darstellung in sich stimmig? 282
4. Stimmen die Darstellungen der verschiedenen Berichterstatter überein? 296
Die 'Unterstellung von Krankheit' 296
Der 'Beweis des Gegenteils' 301
5. Diagnostik als Gestaltwahrnehmung 306
Das Krankheitsbild als Gestaltzusammenhang 307
Das Wahrgenommene ist immer schon gestaltet 314
Diagnostische Wahrnehmung als Prozeß der Erfüllung 317
II. Psychiatrische Therapie - Wie wird das gemacht?
1. Praktiken der Veränderung 322
Veränderung aus Prinzip 322
Der manipulative Verweisungshorizont eines Falles 324
Medikamente 325
Drinnen 329
Draußen 331
2. Das fehlende Krankheitsbewußtsein der Patienten als praktische Gegebenheit psychiatrischer Therapie und wie die Therapeuten mit ihr fertig werden 337
Das fehlende Krankheitsbewußtsein als fundamentale Struktur 337
Zwei Methoden 'praktischer' Überzeugung 345
Wenn. . . dann. . . 347
'Lernprozeß' oder 'Erpressung' 354
Objektivierungspraktiken 358
Schlußbemerkung 368
Anmerkungen 372
Bibliographie 388
Vorbemerkung 17
Teil A
'Sicherheit' und 'geordnete Verhältnisse' - eine Ethnographie
1. Einleitung 21
2. Objektschutz und Schutz vor Objekten 26
3. 'Auf die Patienten eingehen' 35
4. Kontrolle als Fürsorge 39
5. Raumordnung und Sicherheit 45
Die offenen Kanäle 47
Mitpatienten und Sicherheit 49
Öffentlichkeit und Zugänglichkeit 50
Bettenverteilung 51
Drinnen und draußen 54
6. Entschärfungspraktiken 63
Fixieren 63
Trennen 66
Medikamente 67
Teil B
Die Sozialstruktur der Station als Werk der Mitglieder
1. Unsere theoretische Perspektive: Die soziale Welt von einem Hilfsmittel der Untersuchung in ihren Gegenstand verwandeln 77
2. Krank oder nicht krank - Wie wird Verantwortlichkeit festgestellt? 86
Die alltagspraktische Theorie sozialer Abweichung 88
Das Personal als praktischer Theoretiker der Verantwortlichkeit 91
3. Der methodische Entzug von Glaubwürdigkeit 102
Äußerungen von Patienten wie 'Behauptungen behandeln' 102
'Gute Gründe' für den Entzug von Glaubwürdigkeit 106
Praktiken der Überprüfung 112
4. Die Loyalitätsmaxime 117
Die dokumentarische Methode der Interpretation 119
Der vorausschauend-rückschauende Charakter der dokumentarischen Methode der Interpretation 132
Ein erster Blick auf die Reflexivität praktischer Erklärungen 143
5. Wozu Medikamente? 148
Die Diskussion 148
Praktische Arbeitsinteressen und Wirklichkeitssicht 155
6. Noch einmal 'Sicherheit' 164
'Unruhe im Personal' als Konsequenz und die Konsequentialität des Motivs
'Unruhe im Personal vermeiden' 170
Über den erfolgreichen Umgang mit sicherheitsbezogenen praktischen Erklärungen 175
Die 'Praxis' als Entscheidungsinstanz 175
'Wir müssen es riskieren' 177
'Es soll nur eine Ausnahme sein' 178
'Anordnung von oben' 179
7. "Das tun wir gern, wenn wir Zeit haben" - Die Analyse einer unangefochtenen praktischen Erklärung 181
Routinearbeiten des Pflegepersonals 182
Was formuliert und bewirkt der Satz "Das tun wir gern, wenn wir Zeit haben"? 187
Ausnahmen 192
Ein Fall von Überzeugung 193
Ein Dilemma sozialpsychiatrischer Praxis 195
8. Was heißt hier 'Gleichbehandlung'? 199
Gleichbehandlung als Gegebenheit des Settings 201
Gleichbehandlung aus der Perspektive des Pflegepersonals 205
Das Motiv: Unruhe unter den Patienten vermeiden 205
Das Motiv: Zwietracht innerhalb des Personals vermeiden 208
Gleichbehandlung aus der Perspektive des therapeutischen Personals 211
9. Regeln und Regelgebrauch - Die Bedeutung der 'praktischen Umstände' 216
'Soziale Ordnung' von einem Problem des Soziologen in ein Problem der Mitglieder verwandeln 216
Kompetenter Regelgebrauch als interpretativer Prozeß 219
Der buchstäbliche und der intelligente Gebrauch von Regeln - Von der Notwendigkeit 'mitzudenken' 220
Es hängt immer davon ab 226
Wer? 227
Wann? 235
10. Über den Unterschied zwischen 'praktischer' und 'wirklicher' Überzeugung 240
Der Adressat hält die praktische Erklärung für falsch und wird dennoch überzeugt 241
Der Adressat hält die praktische Erklärung für unwahr - das Problem der 'Manipulation' 245
Teil C
Die Organisation von 'Krankengeschichten'
Einleitung 255
I. Wie kommt der Arzt zu einer Diagnose - das Kongruenzphänomen
1. Die Wirklichkeit ist nicht identisch mit einer Darstellung der Wirklichkeit - ein Paradox 261
2. Stimmt die Darstellung mit dem Wissen des Hörers überein? 266
'Wie sind Sie hierhergekommen?' - Die Folgen einer harmlosen Frage 267
Die 'Bedingung der Möglichkeit' von Objekten 270
'Unmögliche' Ereignisse 272
Die Relativität des Realen 279
3. Ist die Darstellung in sich stimmig? 282
4. Stimmen die Darstellungen der verschiedenen Berichterstatter überein? 296
Die 'Unterstellung von Krankheit' 296
Der 'Beweis des Gegenteils' 301
5. Diagnostik als Gestaltwahrnehmung 306
Das Krankheitsbild als Gestaltzusammenhang 307
Das Wahrgenommene ist immer schon gestaltet 314
Diagnostische Wahrnehmung als Prozeß der Erfüllung 317
II. Psychiatrische Therapie - Wie wird das gemacht?
1. Praktiken der Veränderung 322
Veränderung aus Prinzip 322
Der manipulative Verweisungshorizont eines Falles 324
Medikamente 325
Drinnen 329
Draußen 331
2. Das fehlende Krankheitsbewußtsein der Patienten als praktische Gegebenheit psychiatrischer Therapie und wie die Therapeuten mit ihr fertig werden 337
Das fehlende Krankheitsbewußtsein als fundamentale Struktur 337
Zwei Methoden 'praktischer' Überzeugung 345
Wenn. . . dann. . . 347
'Lernprozeß' oder 'Erpressung' 354
Objektivierungspraktiken 358
Schlußbemerkung 368
Anmerkungen 372
Bibliographie 388
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
26. März 2014
Sprache
deutsch
Auflage
Reprint der Ausgabe von 1980
Seitenanzahl
390
Reihe
Edition Das Narrenschiff
Autor/Autorin
Thomas Fengler, Christa Fengler
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
510 g
Größe (L/B/H)
22/156/215 mm
Sonstiges
Großformatiges Paperback. Klappenbroschur
ISBN
9783884146132
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Alltag in der Anstalt" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.












