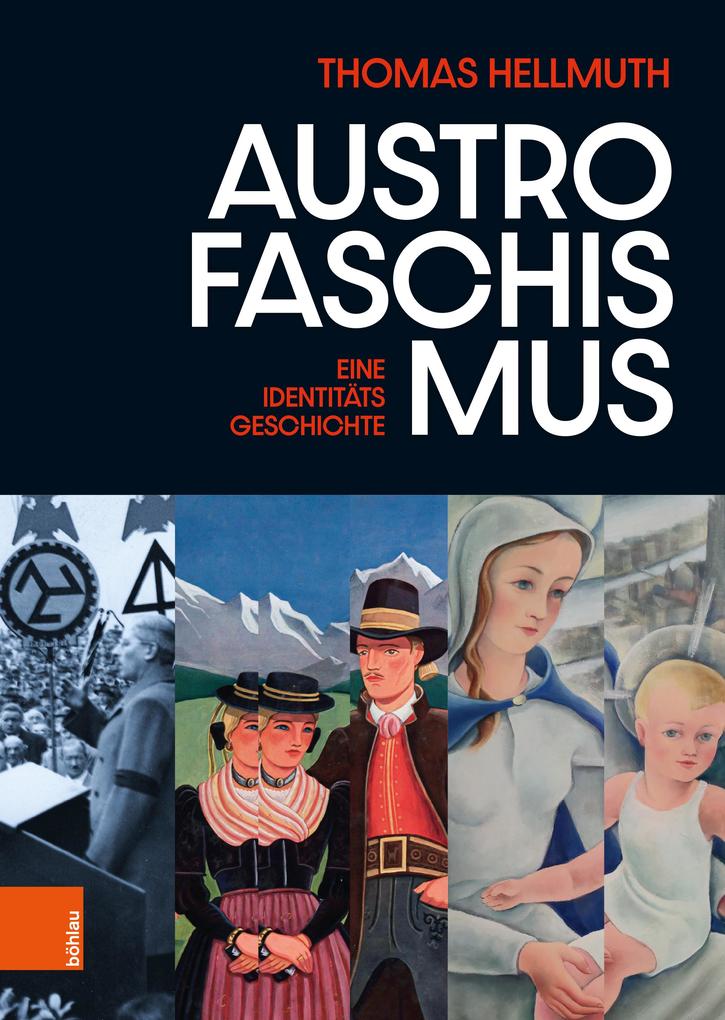Besprechung vom 28.01.2025
Besprechung vom 28.01.2025
Österreichs gemilderter Faschismus?
"Austrofaschismus" wird die Zeit von 1933 bis 1938 in Österreich genannt. Thomas Hellmuth zeigt, dass die Diktatur in dem Land nicht erst mit Hitlers Einmarsch begann.
Austrofaschismus ist ein geläufiger Begriff für die Jahre zwischen 1933 und 1938 in Österreich. In jener Zeit herrschte in Wien ein autoritäres Regime unter den christlichsozialen Kanzlern Engelbert Dollfuß und Kurt Schuschnigg. Zugleich ist Austrofaschismus ein politischer Kampfbegriff der Nachkriegszeit. Denn mit ihm wird gerne von interessierter Seite suggeriert, dass eine "faschistische" Zeit kontinuierlich bis zur Befreiung durch die alliierten Truppen am Ende des Zweiten Weltkriegs gedauert habe. Wer in Österreich vor einem Mahnmal für "Opfer des Faschismus 1933-1945" steht, kann davon ausgehen, dass es unter politischer Ägide der SPÖ errichtet wurde. So auch im Internet, etwa auf der Internetseite "dasrotewien.at", auf welcher Gedenkstätten, die sich auf die Zeit vor und nach 1938 beziehen, ohne Unterschied aufgelistet werden. Als hätten der Einmarsch der Wehrmacht auf Befehl Adolf Hitlers und die Machtübernahme der Nationalsozialisten in Wien nicht einen Bruch mit dem vorherigen Regime bedeutet. Österreich unter Dollfuß und Schuschnigg stand in scharfer Gegnerschaft zum Nationalsozialismus in Deutschland.
Seine Protagonisten bekamen es zu spüren. Dollfuß wurde 1934 im Zuge eines - noch gescheiterten - nationalsozialistischen Putschversuchs ermordet. Schuschnigg wurde nach dem Einmarsch Hitlers im KZ inhaftiert. Politisch aufgeladen ist die Benennung dieser Epoche deshalb, weil nach dem Krieg die Österreichische Volkspartei (ÖVP) in großen Teilen ihres Personals und in ihrer christdemokratisch-konservativen Ausrichtung trotz bewusster Neugründung an die Christlichsoziale Partei anknüpfte. Bis vor wenigen Jahren hing sogar ein Ölporträt von Dollfuß im Saal des ÖVP-Parlamentsklubs, also im Fraktionszimmer. Erst die Renovierung des Parlamentsgebäudes bot der ÖVP, damals unter Sebastian Kurz, eine Gelegenheit, den anstößigen Wandschmuck halbwegs diskret ins Museum zu entsorgen.
Denn das ist auch in der ÖVP (inzwischen) klar: Es kann keinen Zweifel am diktatorischen Charakter jenes Regimes geben. 1933 hat die von der christlichsozialen Partei geführte Regierung Dollfuß im Zusammenspiel mit Präsident Wilhelm Miklas das Parlament ausgeschaltet. Oppositionelle Parteien, die sozialdemokratische wie die nationalsozialistische, wurden verboten. Wer sich weiter betätigte, dem drohte Gefängnis. Der von Teilen der SPÖ ausgehende Aufstand im Februar 1934 wurde mit militärischer Gewalt niedergeschlagen, seine Anführer wurden standrechtlich hingerichtet.
Doch angesichts anderer Regime im Europa der Dreißigerjahre, vor allem des nationalsozialistischen Deutschlands, gab es Zeitgenossen, die es als eine "österreichisch gemilderte und keineswegs terroristische Spielart des Faschismus" empfanden - so formulierte es der Schriftsteller Carl Zuckmayer, der vor den Nazis fliehen musste. Ebenso wie Stefan Zweig, der Autor der "Schachnovelle", die dieser Tage am Burgtheater in einer brillanten Ein-Mann-Inszenierung auf die Bühne gebracht wird. Sein Protagonist ist ein Rechtsanwalt, der dem Schuschnigg-Regime nahestand und dann von der Gestapo mit Psychoterror an den Rand des Wahnsinns getrieben wird. Gerade diese Figur ist es, die den österreichischen Historiker Thomas Hellmuth zum scharfen Widerspruch reizt.
Hellmuth rügt, in der "Schachnovelle" entstehe "der Eindruck, als ob die bürgerlich-liberale Demokratie in Österreich nicht bereits mit dem austrofaschistischen System, sondern erst mit dem sogenannten Anschluss durch das nationalsozialistische Deutschland im März 1938 geendet hätte". Diese Darstellung entspreche der offiziellen österreichischen Erinnerungskultur seit 1945, Zweig habe diese in seinem vor 1942 geschriebenen Buch vorweggenommen: die "Opferthese", die "Österreich zum Opfer des Nationalsozialismus stilisierte und jegliche Mitverantwortung ausschloss". Diese "Nebel" zu lichten, hat sich Hellmuth in seinem Buch "Austrofaschismus. Eine Identitätsgeschichte" vorgenommen. Das ist beileibe nicht das erste Werk über diese Zeit, auch nicht das erste mit dieser Zielrichtung.
Aber sein breiter ideengeschichtlicher Ansatz, der auch Kunst, Medien, Film et cetera aufgreift, ermöglicht aufschlussreiche Ein- und Durchblicke. Und natürlich wird eine aktuelle Studie des historischen österreichischen Faschismus in einer Zeit Aufmerksamkeit finden, in der der Chef der rechten Partei FPÖ, Herbert Kickl, sich anschickt, ins Wiener Bundeskanzleramt einzuziehen. Wo Hellmuth seinerseits ideengeschichtlich herkommt, wird schon dort klar, wo er die Zeit nach Aufklärung, Industrialisierung und Säkularisierung charakterisiert: "Das Zeitalter des Kapitalismus war gekommen und die Klassengesellschaft prägte das soziale Zusammenleben." Aus dieser Warte beschreibt er kenntnisreich, quellengestützt und anschaulich (wenngleich mit den Lesefluss hemmenden und bisweilen anachronistischen Genderdoppelpunkten) die Wurzeln und Ausprägungen des "Austrofaschismus".
Unter Bezug auf die monarchische Vergangenheit, ohne aber nach einer Restitution der Habsburger zu streben, spannen die Christlichsozialen ein gedankliches Garn aus Katholizismus und universaler Mission eines "wahren Deutschtums". An die Stelle des Individualismus, der den Einzelnen zum Teil einer Masse macht, sollte die "gottgewollte" Gliederung treten, angefangen mit der Familie. Berufsstände, in denen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf derselben Seite stehen statt im Klassenkampf entzweit. Bauer und Knecht, aus dem gleichen Topf essend. Die päpstlichen Sozialenzykliken, vor allem "Quadragesimo Anno" von 1931, waren wichtige Inspirationsquellen.
Allerdings war das Konstrukt des "Ständestaats", wie Hellmuth überzeugend zeigt, völlig verkopft und verzopft. Niemand konnte es wirklich nachvollziehen. Und in der Praxis widersprach es nicht nur sich selbst, sondern auch den päpstlichen Lehrschreiben, auf die es sich doch stützen wollte. Äußerlich lehnten sich die Inszenierungen an Mussolinis Italien und Hitlers Deutschland an: Massenaufmärsche, Fahnen, das "Kruckenkreuz". Aber anders als jenen, die sich als modern, technikaffin und gesellschaftlich umstürzend verstanden, "haftete dem Austrofaschismus vor allem der Mief der Jahrhunderte an". Wobei Hellmuth auch auf Ausreißer hinweist, etwa in einer Zeitschrift, die notabene "Moderne Welt" hieß.
Die rechten europäischen Diktaturen der Zwischenkriegszeit - Italien, Ungarn, Deutschland, Österreich, Spanien - haben einige Merkmale, die den gemeinsamen Ordnungsbegriff des Faschismus sinnvoll machen. Hellmuth nennt den Antiliberalismus, Antisozialismus, Antimarxismus, die Idee der "Volksgemeinschaft" und "Bewegung" statt einer Partei, Rassismus und Antisemitismus, eine imperialistische Ausrichtung, zur Schau gestellte Modernität bei gleichzeitigem Antimodernismus und als Wichtigstes den Führerkult. Nicht alle hatten alles oder nicht in gleicher Ausprägung. Hellmuth führt Unterschiede und Gegensätze auf, zwingt sie aber in seinen Schlussfolgerungen teilweise wieder zusammen. Als wissenschaftliche Bezeichnung ist "Austrofaschismus" dennoch treffend, in der politischen Arena bleibt es vor allem ein Kampfbegriff. STEPHAN LÖWENSTEIN
Thomas Hellmuth: Austrofaschismus. Eine Identitätsgeschichte.
Böhlau Verlag, Wien 2024. 224 S.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.