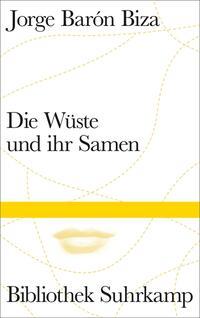Besprechung vom 12.10.2025
Besprechung vom 12.10.2025
Wie monströse Väter Söhne beschädigen
"Unten leben" und "Die Wüste und ihr Samen" sind in Lateinamerika Kultromane. Nun erscheinen sie endlich auf Deutsch.
Von Hernán D. Caro
Zwei Romane aus Lateinamerika, "Unten leben" und "Die Wüste und ihr Samen", die seit einigen Jahren als Kultbücher gelten und nun auf Deutsch erschienen sind, blicken in den Abgrund.
Das erste, 2019 erschienen, ist ein monumentales Buch - sowohl im Umfang als auch in seiner thematischen Bandbreite. Sein Autor, Gustavo Faverón Patriau, peruanischer Schriftsteller und Literaturprofessor in den Vereinigten Staaten, gilt - aufgrund seines sprachlichen Talents, der Verweise auf reale wie erfundene Autoren und seiner Vorliebe für verschlungene Handlungen, die so schlüssig sind wie die in Kriminalromanen - als Nachfolger von Jorge Luis Borges und Roberto Bolaño, zweien der bedeutendsten Schriftsteller der spanischen Sprache.
Der Roman erzählt vom Leben des psychisch gestörten US-amerikanischen Underground-Filmregisseurs - und mutmaßlichen Serienmörders - George W. Bennett. Darüber hinaus ist es eine Untersuchung des Modus Operandi der Militärdiktaturen, die in den Siebziger- und Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts in mehreren Ländern Südamerikas herrschten und unter denen Tausende Menschen gefoltert und getötet wurden. Ein düsterer Bildungs- und Schelmenroman sowie eine heftige Abrechnung - die in vielen Momenten auch komisch ist, denn ja, auch schwarzer Humor gehört wesentlich zum Roman.
Zu Beginn des Buches glauben oder eher fürchten wir, Zeugen von Bennetts Vorbereitung der Entführung und Ermordung einer unschuldigen Frau zu werden. Doch schlägt die Handlung plötzlich eine andere Richtung ein. Fragen nach Georges wahren Plänen und Motiven drängen sich auf. Im Laufe der Erzählung erfahren wir - immer aus der Perspektive verschiedener Figuren, die mit dem merkwürdigen Protagonisten in irgendeiner Verbindung stehen - von seiner traumatischen Kindheit und Jugend: Er ist der Sohn eines CIA-Agenten, der die südamerikanischen Diktaturen über Jahre hinweg leidenschaftlich beim Bau geheimer Folterzentren und bei der Etablierung staatlicher Terrorapparate beriet.
Am Ende des Romans haben wir George auf einer langen Reise durch Südamerika begleitet. Wir sind mit ihm in albtraumhafte unterirdische Gefängnisse hinabgestiegen, haben den verstörten und verstörenden Erzählungen nihilistischer Dichter gelauscht, denen alter Nazis, die in Südamerika als zivilisierte Folterer leben, und denen der von ihnen zerstörten Frauen. Wir sind von einem labyrinthischen, intensiven, brillanten Buch überrollt worden. Und haben die Hoffnung, dass Georges Mordpläne gelingen könnten.
Im Gegensatz zur kosmischen Ambition von "Unten leben" ist das Thema von "Die Wüste und ihr Samen", 1998 erstmals auf Spanisch erschienen, eine intimere, doch keineswegs weniger bedrohliche Form des Schreckens - jene nämlich, die im Innern einer Familie entstehen kann.
Dieser Roman ist der einzige, den der argentinische Journalist und Übersetzer Jorge Barón Biza geschrieben hat. Und bereits in den ersten Zeilen offenbart sich die ganze Grausamkeit, von der das Buch handelt. Der Erzähler, ein Mann namens Mario, berichtet, wie sein Vater am Tag der Scheidung von Eligia, Marios Mutter, ihr Säure ins Gesicht schüttet und sie dadurch für immer entstellt. Unmittelbar danach nimmt sich der Vater - ein exzentrischer Millionär und Politiker, Autor pornographischer Romane - durch einen Kopfschuss das Leben.
Es folgt eine Chronik der Zeit, die Mario an der Seite seiner Mutter im Krankenhaus verbringt, zunächst in Córdoba, Argentinien, später in Mailand. Mario beschreibt detailliert die Stadien der fortschreitenden Zerstörung und schließlich der chirurgischen Rekonstruktion - die notwendigerweise unvollkommen bleibt - von Eligias Gesicht. Gleichzeitig erzählt er von seinem Abstieg in Apathie und Alkoholismus.
Fast zwei ganze Jahre wohnen Mutter und Sohn in der Mailänder Klinik. Mario beobachtet die Arbeit der Chirurgen - der Chefarzt, mit seiner grotesken Rhetorik und seiner Gleichgültigkeit gegenüber den Patienten, erinnert an Dr. Behrens, den Leiter des Lungensanatoriums in Thomas Manns "Zauberberg" -, liest seiner Mutter vor und betrinkt sich nahezu jeden Abend in einer kleinen, schäbigen Bar. Dort begegnet er einer Prostituierten namens Dina, mit der er eine Art Freundschaft beginnt.
Während die Beschreibungen von Eligias Gesicht und Marios Sucht stets anschaulich sind, scheinen die übrigen Figuren und Situationen aus einem Traum zu stammen. Das ist kein Zufall, sondern Beleg für die tiefe Entfremdung des Erzählers vom Rest der Welt. Besonders beklemmend zeigt sich diese Entfremdung in der Beziehung zwischen Mutter und Sohn: Eine echte Nähe zwischen beiden entsteht nie. Und fast könnte man glauben, das Verhältnis zu Dina könnte Mario verändern, retten. Doch auch diese Beziehung endet mit Gewalt. Es ist, als wollte Mario sich an seinem Vater rächen, indem er dessen Schicksal nachahmt.
"Die Wüste und ihr Samen" hat zwei aufeinanderfolgende Enden. Beim ersten kehren Mario und Eligia nach Argentinien zurück. Die italienischen Ärzte haben gute Arbeit geleistet, die jedoch ständiger Optimierung bedarf. Die Mutter scheint sich wieder in die Gesellschaft integrieren zu können. Es vergehen vierzehn Jahre. Dann folgt das zweite, wahre Ende: Eines Tages, unerwartet, springt Eligia aus dem Fenster ihrer Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt lebt ihr Sohn dauerhaft in der Hölle des Alkoholismus.
Kritische Leser könnten die Handlung des Romans als wenig plausibel empfinden. Dabei erzählt er wahre Begebenheiten. Marios Geschichte ist die des Autors Jorge Barón Biza und seiner Familie. Und ein drittes Ende fehlt im Buch: 2001, zwei Jahre nach der Veröffentlichung, die in Argentinien ein Erfolg war, nahm sich der Autor selbst das Leben. Einige Jahre zuvor hatte seine jüngere Schwester ebenfalls Selbstmord begangen. Diese Fakten sind nicht Teil des Buches, wohl aber der Tragödie, von der es erzählt.
Hinsichtlich ihres Stils, ihrer Handlung und ihrer narrativen Ansprüche könnten "Unten leben" und "Die Wüste und ihr Samen" kaum unterschiedlicher sein. Aber mindestens zwei wesentliche Aspekte verbinden sie. Es handelt sich einerseits um Romane über monströse Väter und, vor allem, über zutiefst beschädigte Söhne. An einer Stelle von "Die Wüste und ihr Samen" erzählt Mario von einer Begegnung mit einem alten kanadischen Paar, das ihn fragt, ob er verheiratet sei, eine Verlobte habe. "Nein", antwortet er. "Ich hatte keine guten Vorbilder." Dies könnte die prägnante Formulierung des dunklen Funkens sein, der beide Geschichten antreibt.
Andererseits eint diese Romane die entschlossene Bereitschaft, dem Horror direkt ins Auge zu blicken, über ihn nachzudenken, ihn zu zeigen. Es ist leichter, erträglicher, den Blick von der Brutalität abzuwenden. Doch die Gewalt ist da. So wird die Lektüre dieser schonungslosen und aufwühlenden Werke fast zu einem notwendigen Akt der Kühnheit.
Gustavo Faverón Patriau, "Unten leben". Aus dem Spanischen von Manfred Gmeiner. Droschl, 600 Seiten, 34 Euro
Jorge Barón Biza, "Die Wüste und ihr Samen". Aus dem Spanischen von Frank Wegner. Suhrkamp, 268 Seiten
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.