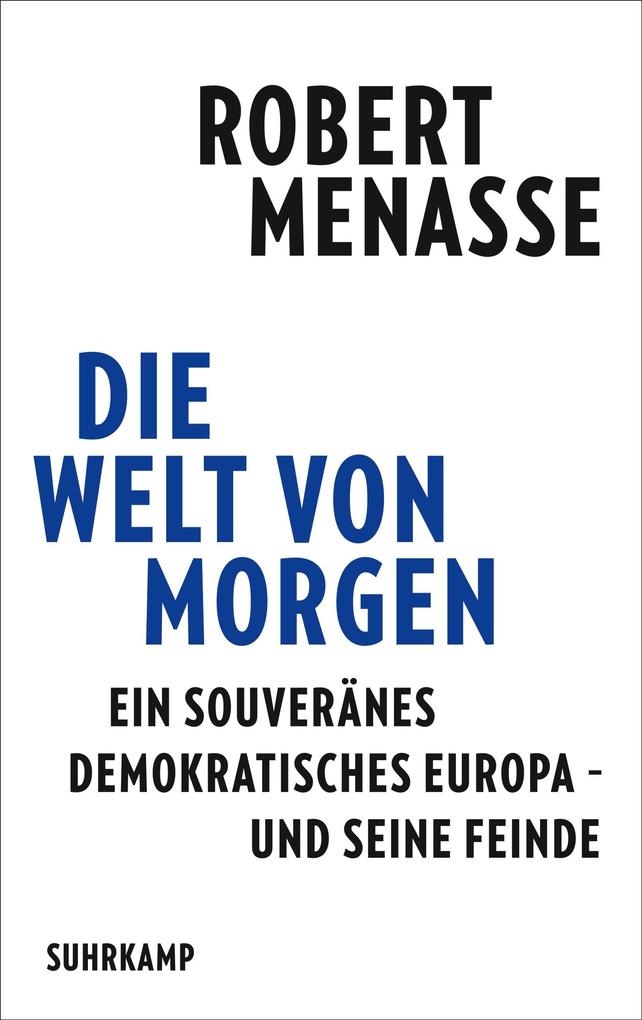Besprechung vom 17.09.2024
Besprechung vom 17.09.2024
Die EU als Vielvölkerstaat
Robert Menasse konzentriert sich in seinem neuen Buch auf den Nationalismus und neue Spielarten der Demokratie in Europa. Gegenwärtige Gesellschaften, beobachtet der Autor, hätten keine politischen Visionen mehr, auf die sie hinarbeiten. Lösungsvorschlag: die EU als "Vielvölkerstaat", der in Regionen untergliedert ist. Als historische Folie dient ihm das Habsburgerreich. Die Kapitel springen, ohne einem thematischen Bogen untergeordnet zu sein, von einem Aspekt zum nächsten. Dabei bedient sich Menasse einer betont lässigen Sprache, er stellt plakative Fragen ("Es soll Zeiten gegeben haben, da beruhte Kritik auf Analyse, ihr Besteck war Theorie und Methode. Weiß das niemand?") und behauptet Dinge auf Grundlage anekdotischer Evidenz (italienische Fußballfans sollen zum Beispiel, anders als deutsche, keine nationalistischen Tendenzen aufweisen). Da hilft es nicht viel, dass zwischendurch immer wieder triftige Feststellungen aufblitzen, etwa jene, die politische Rechte werde vor allem von der Mitte und nicht von den Rändern getragen.
Hinzu kommt die gedankliche Unschärfe. So skizziert Menasse zunächst seinen Wohnsitz im österreichischen Waldviertel, um dann zu schildern, wie er dort bei der Gartenarbeit eine Kröte erschlagen hat. Mit dieser Anekdote möchte er die Eigenarten sozialer und politischer Ängste aufzeigen, wobei dem Leser eher solche Einlassungen auffallen: "Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus." Dass dem Essay Potential innegewohnt hätte, zeigt Menasse, wenn er auf konkrete Missstände im Zusammenhang mit der EU hinweist, sowohl auf institutioneller Ebene wie auch im Selbstverständnis, das sich im Reden über die Union manifestiert. Solche Passagen werden jedoch vom Ballast der Anekdoten und Exkurse erstickt. ROBIN PASSON
Robert Menasse: "Die Welt von morgen". Ein souveränes demokratisches Europa - und seine Feinde.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2024.
192 S., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.