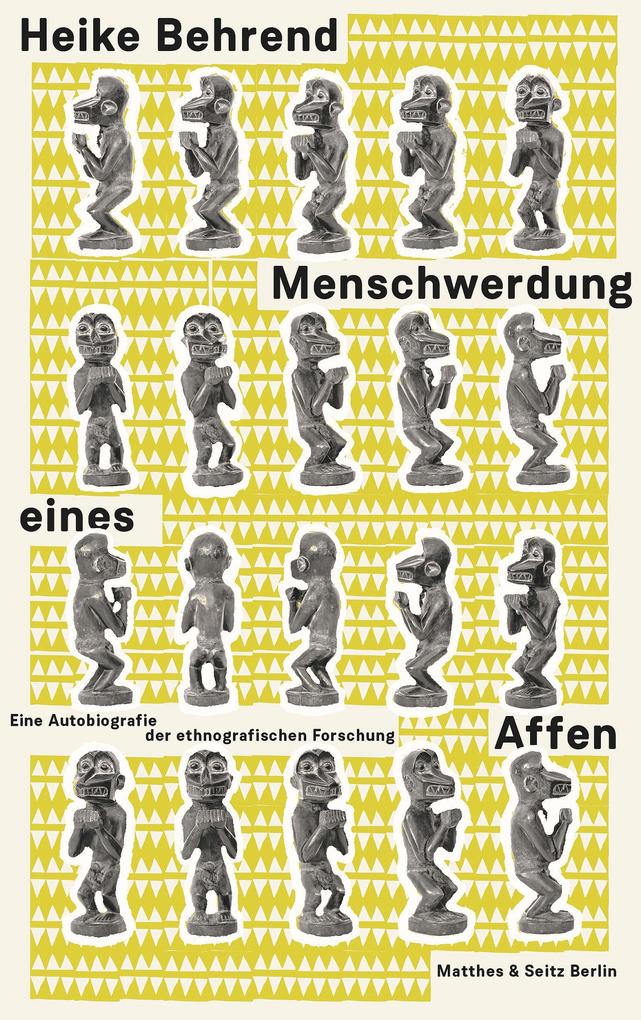Besprechung vom 11.10.2025
Besprechung vom 11.10.2025
Im Paradiesgarten war freie Liebe nicht vorgesehen
Rückkehr einer Ethnologin, die in Ostafrika ihre Erfahrungen mit der Sendung durch höhere Mächte machte, zur Heimatforschung: Heike Behrend folgt dem Leben Gustaf Nagels, des Propheten vom Arendsee, und behält dabei
souverän mehrere Fäden der Darstellung in der Hand.
Von Sonja Asal
Von Sonja Asal
Gustaf Nagel, der in den lebensreformerisch gestimmten Jahren nach der Jahrhundertwende als Wanderprediger, Naturapostel und Dichter von sich reden machte, war ein Genie der Selbstvermarktung. Auf Postkarten, deren Auflagen oft in die Tausende gingen, posierte er nur mit einer lendenschurzartigen Hose bekleidet, die seinen muskulösen Körper sehen lässt. Zunehmend feminin wirkte er, als er sich später entschied, knöchellange, meist weiße Kleider zu tragen. Immer sind seine Posen mit selbst erdachten Insignien wie Stern oder Liebesapfel sorgfältig arrangiert. Oft handelt es sich um Studioaufnahmen, manchmal zeigen sie ihn in seinem Paradiesgarten, vor dem selbst erbauten Tempel oder der Allee aus phallischen Säulen.
Die Ethnologin Heike Behrend nimmt in ihrem Buch Dutzende dieser Bilder zum Ausgangspunkt, um das Porträt nicht nur eines Mannes, sondern auch einer ganzen Epoche zu entwerfen, die durchzogen war von Energien, die auf Transformation drängten. Behrend folgt diesen Energien mit einer Beobachtungsgabe, die geprägt ist von einem feinen Sensorium für Selbst- und Fremdzuschreibungen, den Erfahrungen eines ganzen Forscherinnenlebens, auf das sie in ihrer vor vier Jahren mit dem Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse ausgezeichneten Autobiographie "Menschwerdung eines Affen" zurückblickte (F.A.Z. vom 10. Oktober 2020).
Was sie beschreibt, ist zunächst eine "zögerliche Verwandlung". Eine einzige Fotografie zeigt Nagel in bürgerlicher Kleidung, mit Hut und Jackett. Vielleicht hatte er zu diesem Zeitpunkt, da war der 1874 Geborene vierzehn Jahre alt, schon seine kaufmännische Lehre angefangen. Nichts deutet darauf hin, dass er nur anderthalb Jahre später die angestrebte Laufbahn aufgeben musste, geplagt von Hautausschlag, chronischen Katarrhen und einer Reihe weiterer unklarer Beschwerden, für die die Sprache der Jahrhundertwende das Wort Nervosität bereithielt.
Zwischen dem angehenden Kaufmann und dem Naturapostel liegen Jahre der mehr oder minder erfolglosen Therapieversuche. Schließlich überzeugte Nagels Mutter ihren Sohn davon, sich den natürlichen Reizen von kaltem Wasser und frischer Luft auszusetzen, mit denen Sebastian Kneipp so erfolgreich war. Zur gleichen Zeit empfing er gottgesandte Träume, die in die gleiche Richtung wiesen.
Nagels Verwandlung war unter den Vertretern der Lebensreform kein Einzelfall. Nicht selten stand am Anfang die Geschichte einer Genesung wie bei Karl Wilhelm Diefenbach, dem Urvater aller Kohlrabi-Apostel. Doch Behrend schreibt keine Geschichte der Lebensreform, zumal Nagel, wie sie selbst sagt, in diesem Zusammenhang bereits gründlich erforscht ist. Ihr Vorhaben ist weitaus komplexer. Es reflektiert sowohl ihre eigene Familiengeschichte als auch das Wissen aus ihren ethnographischen Studien in Ostafrika. Sie nennt es einen Umweg, über den sie zurück an den Arendsee gelangte. Dort besitzt ihre Familie ein Ferienhaus, das ihr Großvater einst gekauft hatte. Als kleines Mädchen war sie selbst dort, bevor die Familie in den Fünfzigerjahren in den Westen rübermachte. Das Zurückkommen verlief nicht ohne Überraschungen. Auch manche Verhaltensweisen der Bewohner der Altmark musste sie erst verstehen lernen und mit ihren eigenen Erwartungen abgleichen. Zum Beispiel, dass "Heimat" ein kontaminierter Begriff sei. Das galt in keiner Weise für die engagierten Menschen vor Ort, die sich dafür einsetzen, den von Nagel angelegten Garten und die Reste der Bauwerke zu erhalten. Ihnen, die nichts dabei finden, sich Heimatforscher zu nennen, gilt ein langer Abschnitt des Buches. Denn dass Behrend es überhaupt schreiben konnte, verdankt sie nicht zuletzt einer lokalen Sammlerin und deren Archiv zu einer Figur, die in die offiziellen Archive allenfalls als Objekt von Strafverfolgung oder Psychiatrisierung Eingang fand. In einer psychiatrischen Anstalt starb Nagel denn auch 1952.
Die Vielzahl an Ebenen und Kontexten handhabt Behrend souverän in ihrer essayistischen, immer glasklaren Darstellung. Neben ihren detaillierten Bildinterpretationen lässt sie historische Bezüge und theoretische Überlegungen leichthändig mitlaufen, die sich an keiner Stelle mit großer erklärender Geste in den Vordergrund drängen.
Behrend nimmt Nagels Zeit seines Lebens artikulierten Anspruch ernst, als Werkzeug Gottes zu agieren. Den Blick dafür schärfte sie während ihrer ethnographischen Arbeit in Ostafrika. Dort ist sie, wie sie schreibt, "immer wieder Propheten begegnet, die - von Gottheiten oder Geistern ergriffen - in schlimmen, katastrophischen Zeiten, die alle verlässlichen Voraussetzungen des Lebens erschütterten, nach Auswegen suchten". Und alle diese Propheten "stellten die je vorherrschende gesellschaftliche Ordnung radikal in Frage".
Eine Provokation für seine Zeit war Nagel in jedem Fall, und daher ist Behrends Buch neben vielem anderem auch eine minutiöse Studie über Zugehörigkeit und Ausgrenzung. Nachdem er seine eigene Lebensweise vollständig umgestellt hatte und in einer - wenn auch stilvoll dekorierten - Erdhöhle wohnte, begann er, sich selbst in Zeitungsannoncen als Naturheilkundigen zu empfehlen. Die Behörden reagierten mit Verwarnungen, seine Mitmenschen verspotteten ihn und zerstörten sogar seine Behausung. Nach dem Tod seiner Mutter zerbrach schließlich auch das Verhältnis zu seinem Vater, der ihn entmündigen ließ.
Nagel verließ Arendsee in einer Bewegung, die halb Flucht vor dem Vater und der drohenden Einweisung in eine Irrenanstalt, halb Wanderschaft mit unklarem Ziel war. Schließlich führte sie ihn durch Deutschland, die Schweiz, Italien und Ägypten bis nach Palästina. Auf dieser Reise begann Nagel, das Medium der Fotografie gezielt einzusetzen. Behrend sieht daher in ihm einen spezifisch modernen Propheten, der selbst über die Sichtbarkeit seiner Person bestimmt. Im Gegensatz zu anderen Zeitgenossen hatte er keine feste Gefolgschaft, auch wenn seine Vorträge oft große Menschenmengen anzogen. Nun sicherte er sich mit dem Verkauf der Postkarten eine andere Art der Gefolgschaft, seine Käufer und Kunden. So wurde die Fotografie zu seiner primären Einkommensquelle.
Das Kaufmännische, merkt Behrend an, blieb in Nagel weiterhin aktiv und trieb ihn zu immer neuen kommerziellen Unternehmungen an. Nachdem seine Entmündigung 1903 aufgehoben wurde, betrieb er zunächst mehrere Jahre lang ein Sonnen- und Brausebad. 1910 konnte er schließlich das Seegrundstück erwerben, auf dem er eigenhändig seinen Paradiesgarten errichtete, eine Gartenanlage mit Bauten in der Form von Grotten und Höhlen und schließlich einem Tempel. Den Eingang bewachte ein Kassenhäuschen.
Behrend zeigt, wie Nagels gesamtes Leben in einer permanenten Spannung nicht nur zwischen seiner Berufung und den gesellschaftlichen Erwartungen verlief, die ihn immer wieder Diskriminierung und Verfolgung aussetzten. Bei aller Randständigkeit seiner Lebensweise vertrat er für seine Zeit konventionelle oder sogar konservative Positionen. Stellenweise wird Behrends neutrale Haltung dadurch auf eine harte Probe gestellt. Dann behilft sie sich mit sanfter Ironie. Das gilt zumal für Nagels Vorstellungen von Ehe und Sexualität. So sehr der "Maulwurf des Geschlechtstriebs" ihn seit seiner Pubertät quälte, war für ihn im Gegensatz zu anderen Lebensreformern die freie Liebe keine Option. Sexualität sollte idealerweise in der Ehe stattfinden. Behrend formuliert vorsichtig: "Gustafs Übernahme von weiblicher Kleidung und femininen Posen ging jedoch im Alltagsleben nicht mit einer Auflösung der Geschlechterhierarchie einher." Nagel war dreimal verheiratet, dreimal wurden die Ehen geschieden.
Schließlich wurde Nagel explizit politisch und gründete eine eigene Partei, die "deutsch-kristliche folkspartei". Sie war antisemitisch, deutschnational und gänzlich erfolglos. Trotz seiner politischen Positionen hielt er sich aber mit Kritik an den Nationalsozialisten nicht zurück. 1943 wurde er als "Volksschädling" nach Dachau verbracht. Schon Jahre zuvor hatte er sich, in der ihm eigenen Orthographie, einmal als wahrer Prophet erwiesen und vor einer "sündflut" gewarnt, "wo kein mensch mehr in deutschland zu finden war, man konnte keinem mer zuwinken, man sa sie noch wie mitferbrandt in den wolken dafon zihen".
Heike Behrend: "Gespräche mit einem Toten". Gustaf Nagel, Prophet vom Arendsee.
Matthes & Seitz Verlag, Berlin 2025.
312 S., Abb., geb.,
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.