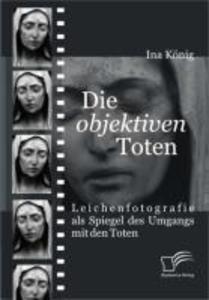Das Leben der Menschen wird durch den Tod begrenzt. Es wird oft darüber gesprochen und geschrieben, welche Konsequenzen dies für das Handeln des Einzelnen hat oder haben sollte. Dieses Wissen um den Tod bleibt für die Menschen meist abstrakt.
Wie steht es jedoch um die Konfrontation mit dem konkreten Toten? Auf der Leinwand fließt häufig Blut, das explizit gezeigt wird und nicht selten sterben Protagonisten. In dieser Richtung kann den geübten Zuschauer nur noch wenig schockieren. Doch wie sieht es mit den Bildern von realen Toten aus; von toten Menschen, die dem Betrachter im Leben nahe standen?
Viele Menschen finden den Gedanken, eine Fotografie von ihren toten Angehörigen zu machen befremdlich, wenn nicht sogar schockierend. Konfrontiert mit der Tatsache, dass es im 19. und frühen 20. Jahrhundert gängige Praxis war, eine letzte Fotografie von einem Toten zu machen und diese zum Beispiel an prominenter Stelle im Haus aufzustellen, lässt viele zuerst danach fragen, wann dieser Brauch ein Ende gefunden habe.
Doch das Fotografieren der Toten dauert an. Es ist jedoch von einem sozial akzeptierten, offen praktizierten Brauch der Vielen zu einem persönlichen, fast schon geheim gehaltenen Ritual der Wenigen geworden. Warum ist das so?
Die Arbeit " zeichnet sich durch die Beschäftigung mit einem Thema aus, welches so detailliert von noch keinem anderen europäischen Forscher aufgegriffen wurde. Die wenigen Informationen, die es hin und wieder zu dem Thema gibt, wurden von der Autorin gesammelt und zu einem neuen Panorama mit neuen Einblicken in Vergangenheit und Gegenwart der Menschen zusammengestellt.
Inhaltsverzeichnis
1;Inhaltsverzeichnis;3 2;Einleitung;5 3;I Die Entdeckung der Fotografie;11 3.1;1 Vom Stellvertreter zum Abbild eines Menschen: Der Bildhunger wächst;11 3.1.1;Das Bild als Stellvertreter;11 3.1.2;Technische Hilfsmittel in der Bildherstellung;14 3.2;2 Der Tod und die Fotografie;18 3.2.1;Die Bedeutung der Porträtfotografie;18 3.2.2;Die Bedeutung des letzten Gesichtsausdrucks;19 3.2.3;Die Totenfotografie;21 3.2.4;Totenfotografie im Zwielicht;27 4;II Die Veränderung der Einstellung zum Tod;31 4.1;1 Medikalisierung Die Veränderung der Einstellung zum Sterben;31 4.1.1;Die Neudefiniton des menschlichen Körpers seit der Aufklärung;31 4.1.2;Das Streben nach einem sauberen Tod;33 4.1.3;Die Medikalisierung des Lebens und die Ausblendung des Todes;35 4.1.4;Die Mentalität des Vorbeugens;38 4.2;2 Trauerkultur Die Einstellung zu den Toten ändert sich;43 4.2.1;Die Macht der Toten über die Lebenden;43 4.2.2;Der Umgang mit den Toten;44 4.2.3;Ausprägung der Trauer;47 4.2.4;Der Wandel der Friedhofskultur;49 4.2.5;Der Tod als Projektionsfläche;55 5;III Die Rückkehr der Leichen- und Totenfotografie in dieÖffentlichkeit;57 5.1;1 Künstler des 20. Jahrhunderts und ihr Blick ins Leichenschauhaus;57 5.1.1;Andres Serrano: The Morgue;57 5.1.2;Jeffrey Silverthorne: Morgue Work;59 5.1.3;Rudolf Schäfer: Der Ewige Schlaf. Visages de morts;62 5.1.4;Resümee;62 5.2;2 Neues Interesse am Thema Tod in den Medien;65 5.2.1;Pathologie: Der Tote als Träger von Zeichen;65 5.2.2;Fiktion und Realität: Der Tote im Kontext von familiär betriebenenBestattungsinstituten;67 5.2.3;Kontroverse: Das Thema Sterbehilfe in Kinoproduktionen;69 5.2.4;Nachleben: Das Post-Mortem-Zeitalter im Kino;70 5.2.5;Die einsamen Toten: Eingehendere Berichterstattung;71 5.2.6;Vermenschlichung: Bestattung von Tieren;72 5.3;3 Zurück zu den Wurzeln der Totenfotografie?;74 5.3.1;Elizabeth Heyert: The Travelers;74 5.3.2;Beate Lakotta und Walter Schels: Noch mal leben vor dem Tod. WennMenschen sterben;75 5.3.3;Resümee;77 5.4;4 Private Totenfoto
grafie im halböffentlichen Raum;80 5.4.1;Fazit;81 6;Anhang;88 7;Bibliographie;88