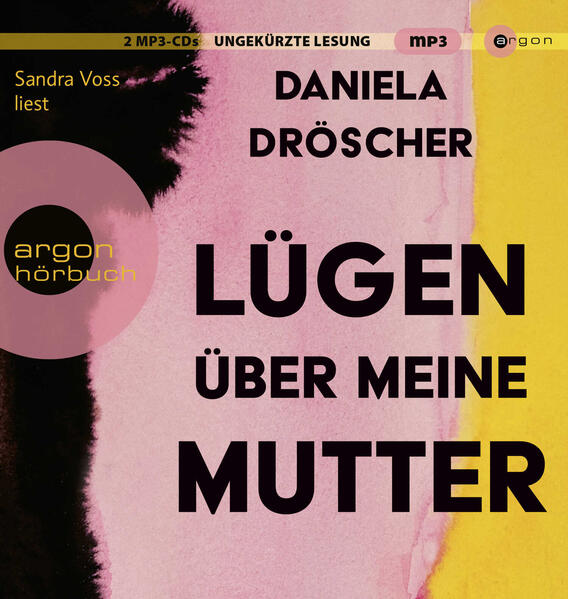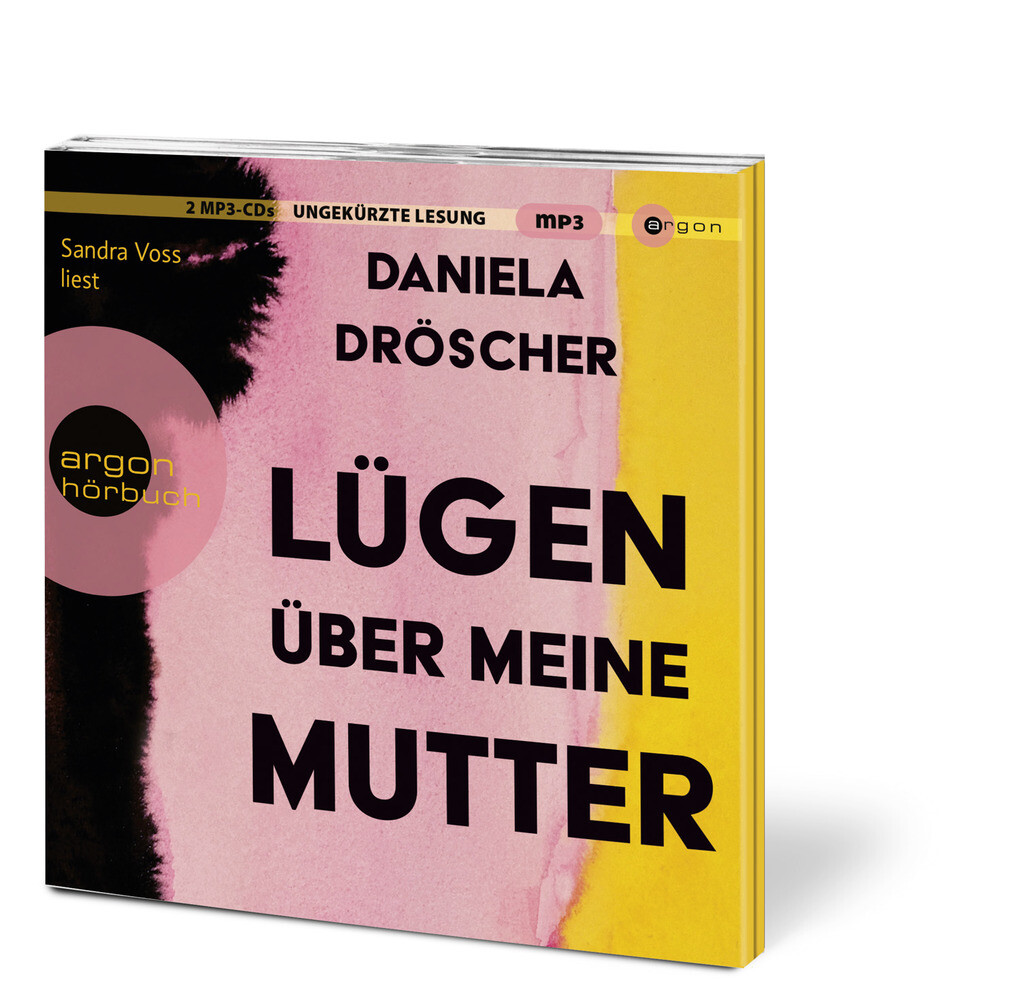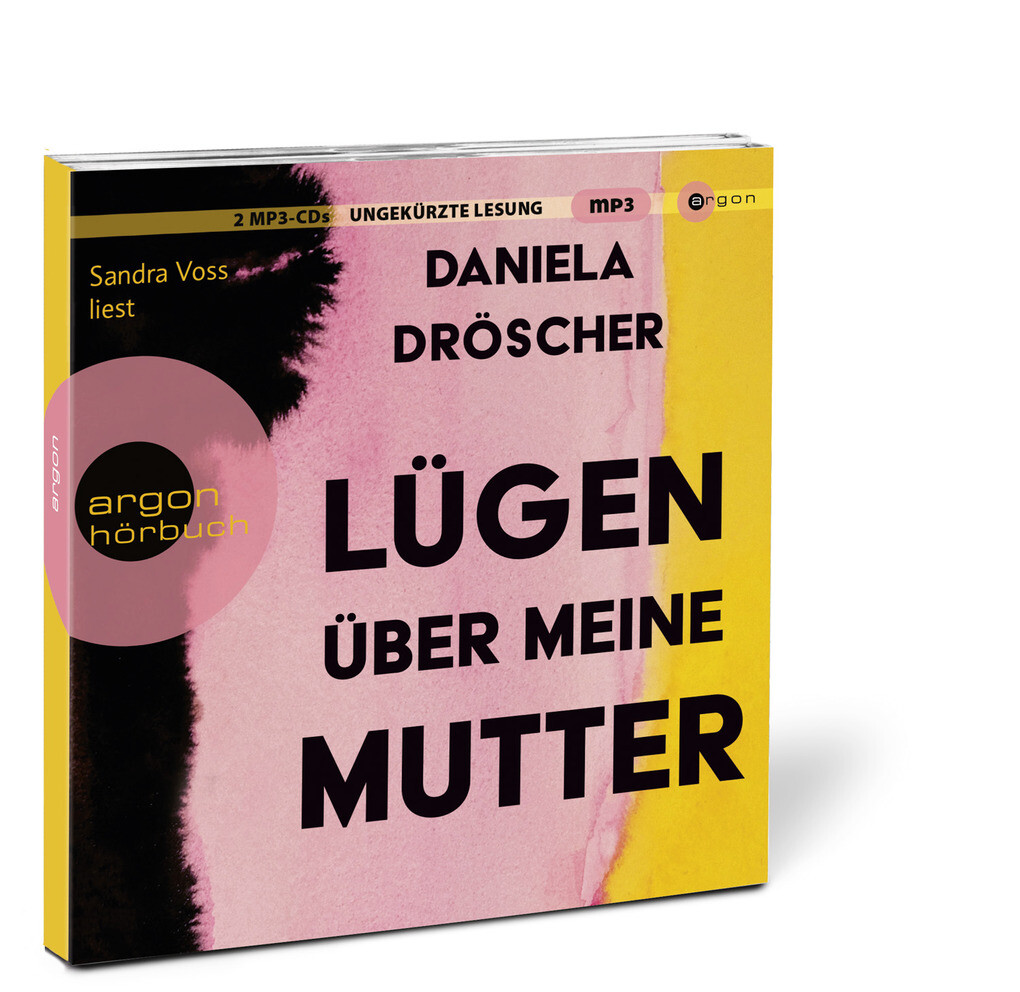Besprechung vom 14.08.2025
Besprechung vom 14.08.2025
Was lässt sich auf Papier wagen?
Das Kind aus dem Vorgängerbuch ist erwachsen geworden: Daniela Dröscher folgt dessen Werdegang im neuen Roman "Junge Frau mit Katze".
Über Daniela Dröschers neuen Roman "Junge Frau mit Katze" lässt sich kaum schreiben, ohne an den erfolgreichen Vorgänger mit dem genialen Titel "Lügen über meine Mutter" zu erinnern, der 2022 auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stand. Dieser autofiktionale Roman spielte in den Achtzigerjahren im Hunsrück, Dreh- und Angelpunkt darin ist das Übergewicht der Mutter, das der Vater - durch und durch Patriarch - für alles Übel verantwortlich macht. Das Aufregende an dem Buch war neben dessen "dicker Heldin", wie klug und messerscharf Dröscher über Klassenzugehörigkeit und Scham schrieb. Sie selbst sagte einmal in einem Interview, es habe den Umweg über Frankreich und Didier Eribon gebraucht, um hierzulande einen Stein von den Zungen zu lösen und die Herkunftsfrage auf das Soziale zu wenden.
In "Junge Frau mit Katze" ist das Kind von damals erwachsen geworden. Die Ich-Erzählerin lebt mit einem Kater namens Sir Wilson in einer Dachgeschosswohnung, hat Literaturwissenschaft studiert und eine Doktorarbeit geschrieben, die sie noch verteidigen muss. Sie schickt sich an, eine akademische Laufbahn einzuschlagen, doch da kommt ihr der eigene Körper in die Quere. Dieser Körper gehört allerdings nicht nur ihr, sondern existiert stets im Körperschatten der übermächtigen Mutter.
Zu Beginn des Krankheitsmarathons quält die Erzählerin eine Kehlkopfentzündung, die sich nicht niederringen lässt. Bald kommen neue Beschwerden hinzu, Herz und Haut spielen verrückt. Diese Körperrebellion widerfährt Ela nicht zum ersten Mal, vielmehr ist sie eine geübte Kranke: "So viele Stunden, Tage und Wochen hatte ich bereits zwischen meinen vier Wänden zugebracht, im Bett mit den absonderlichsten Malaisen. Krank zu sein gehörte zu meinem Leben wie für andere das Atmen. Was hatte ich nicht alles schon gehabt: Eileiterentzündungen, immer wieder eine heftige Allergie gegen Textilfarben, Noro-Virus-Infektionen und ein Zwölffingerdarmgeschwür."
In der Verlagsankündigung heißt es über Elas Geschichte: "Alles ist schwierig, bevor es leicht wird." Für den Leser bedeutet dies, dass er die Erzählerin über sehr viele Seiten hinweg und ohne größeren Spannungsbogen auf ihrer Ärzte-Odyssee begleitet. Dass die Erschöpfung, die sich über Elas Körper und Seele legt, nicht auch den Leser infiziert, liegt am lakonischen Dröscher-Sound, der gekonnt Poesie und Witz verbindet. Die Erzählerin ist außerdem eine scharfe Beobachterin des Gesundheitssystems. In einer Szene trifft sie ausgerechnet auf jenen Arzt, der sie einst untersucht und eine falsche Diagnose gestellt hatte. Auch dieses Mal fertigt er die Erzählerin barsch ab, als wäre der weibliche Schmerz bloß Ausdruck einer Hysterie, an der sich andere die Zähne ausbeißen sollen: ",Tja', sagt der Arzt, ,wenn es Ihnen den Hals zuschnürt, Sie einen Ball spüren, wie Sie sagen - dann sind Sie von oben bis unten voll mit Metastasen.' 'Bitte was?' Er sah mich herausfordernd an. 'Ich meine, gute Frau, Sie legen die Hand auf den Unterleib und wollen mir erzählen, Sie hätten Halsschmerzen? Sie haben, mit Verlaub, Probleme. Und zwar ganz gewaltige.'"
Gleichwohl ist man zunehmend dankbar für jede Arzt- und Krankheitspause, die einem der Roman gönnt. Bei aller Faszination für Körperlichkeit hätte man auf die detailreiche Beschreibung einer Darmreinigung gut verzichten können. Besonders interessant wird es dafür, sobald es um die akademische Beschäftigung der Erzählerin mit dem "falschen Japaner" George Psalmanazar, einem Mann des achtzehnten Jahrhunderts, geht (Dröschers Roman "Die Lichter des George Psalmanazar" von 2009 ist gerade unter dem Titel "Der falsche Japaner" neu erschienen). Dieser gerissene Hochstapler gab sich als Ureinwohner Formosas aus und erfand sogar ein eigenes Alphabet. Mit dieser Kühnheit schaffte er es bis nach Oxford in den Kreis der Gelehrten. Für Psalmanazar war das Schreiben Anker und Zufluchtsort, und diese existenzielle Bedeutung hat das Schreiben als Instrument der Selbstfindung auch für die Erzählerin. Auf dem Papier kann sie das "Unmögliche wagen". Sie schreibt sich aus der akademischen Welt hinaus und in eine schriftstellerische hinein.
Wie das Vorgängerbuch über die Mutter ist "Junge Frau mit Katze" reich an philosophischen Reflexionen und Intertextualität. Dass sich dahinter bisweilen ein selbstironischer Kommentar verbirgt - nach dem Motto: Zeige deine akademische Klasse -, ist unwahrscheinlich. Eher handelt es sich um Gesten der Selbstvergewisserung. Die Kapitelüberschriften zitieren - wenig originell - Buchtitel berühmter Autorinnen, in deren Werk Körperlichkeit, seelische Leiden oder Mutter-Tochter-Beziehungen eine Rolle spielen, darunter Siri Hustvedt ("Die zitternde Frau"), Sylvia Plath ("Lady Lazarus"), Ottessa Moshfegh ("Mein Jahr der Ruhe und Entspannung") und Deborah Levy ("Heiße Milch").
Dröschers bevorzugte Gewährsfrau ist Virginia Woolf: "Ich überlegte, was ich lesen könnte. Vielleicht Virginia Woolf, die ewige Patientin? Niemals zuvor hatte jemand so beherzt über Krankheit geschrieben." Im Laufe des Romans spricht die Erzählerin nur noch von Virginia wie von einer guten alten Freundin. Einmal fragt sie: "'Und jetzt, Virginia?' 'Was jetzt?'" Doch selbst mit Virgina ist eben nicht immer ein "Blumentopf zu gewinnen".
Dass sich am Ende des Romans im Leben der Erzählern alles auf wundersame Weise fügt und eine zarte Liebe lockt, liest sich dann doch allzu brav, als schiele Dröscher auf ein Publikum, das Happy Endings liebt - die Krankheit als Erweckungserlebnis, nach deren Überwindung ein geläutertes Ich steht. Die Botschaft lautet: Es gibt keinen gesunden Körper im falschen akademischen Leben. Der Leser bekommt die Neuerfindung zigfach ausbuchstabiert: "Jede einzelne meiner Episoden war für mich die Geburt eines anderen Selbst. Nie sagt der Körper so deutlich 'ich' wie in den Momenten, in denen er um seine Existenz fürchten muss." Einen magischen Moment darf Ela zu guter Letzt noch mit ihrer Mutter (um etliche Kilo und Sorgen leichter) beim gemeinsamen Bad im Ladies' Pond erleben. Zwei Körper können nun endlich die ersehnte Nähe zulassen.
Wer nach der Lektüre dieses Romans wehmütig Richtung Bücherregal blickt, wo "Lügen über meine Mutter" steht, der kann sich zumindest damit trösten, dass nächstes Jahr die Verfilmung von Daniela Dröschers Bestseller in die Kinos kommt. MELANIE MÜHL
Daniela Dröscher:
"Junge Frau mit Katze". Roman.
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2025.
320 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.