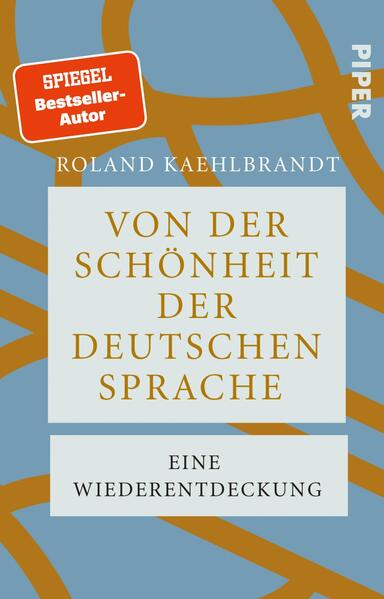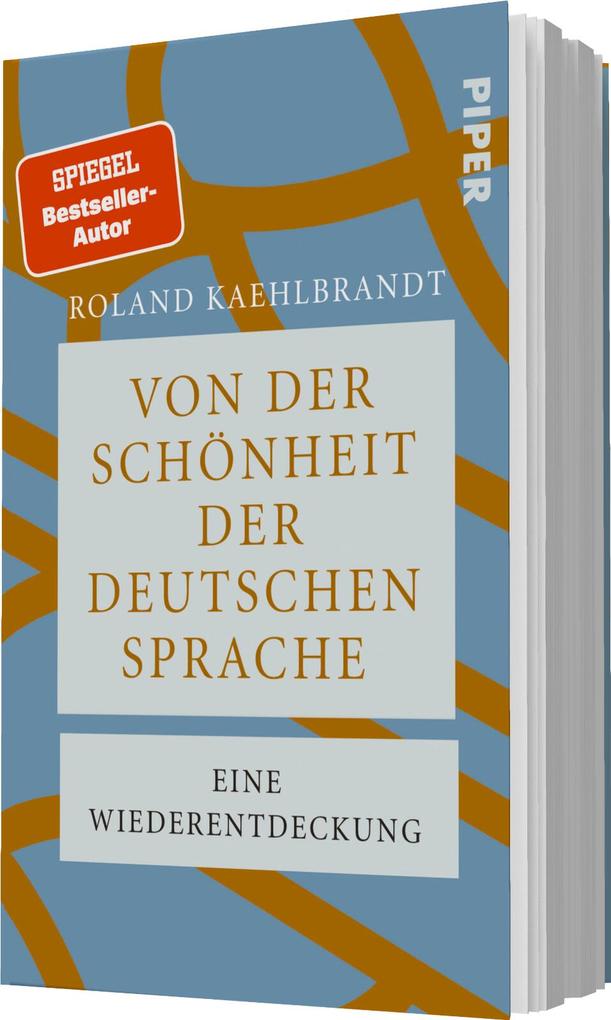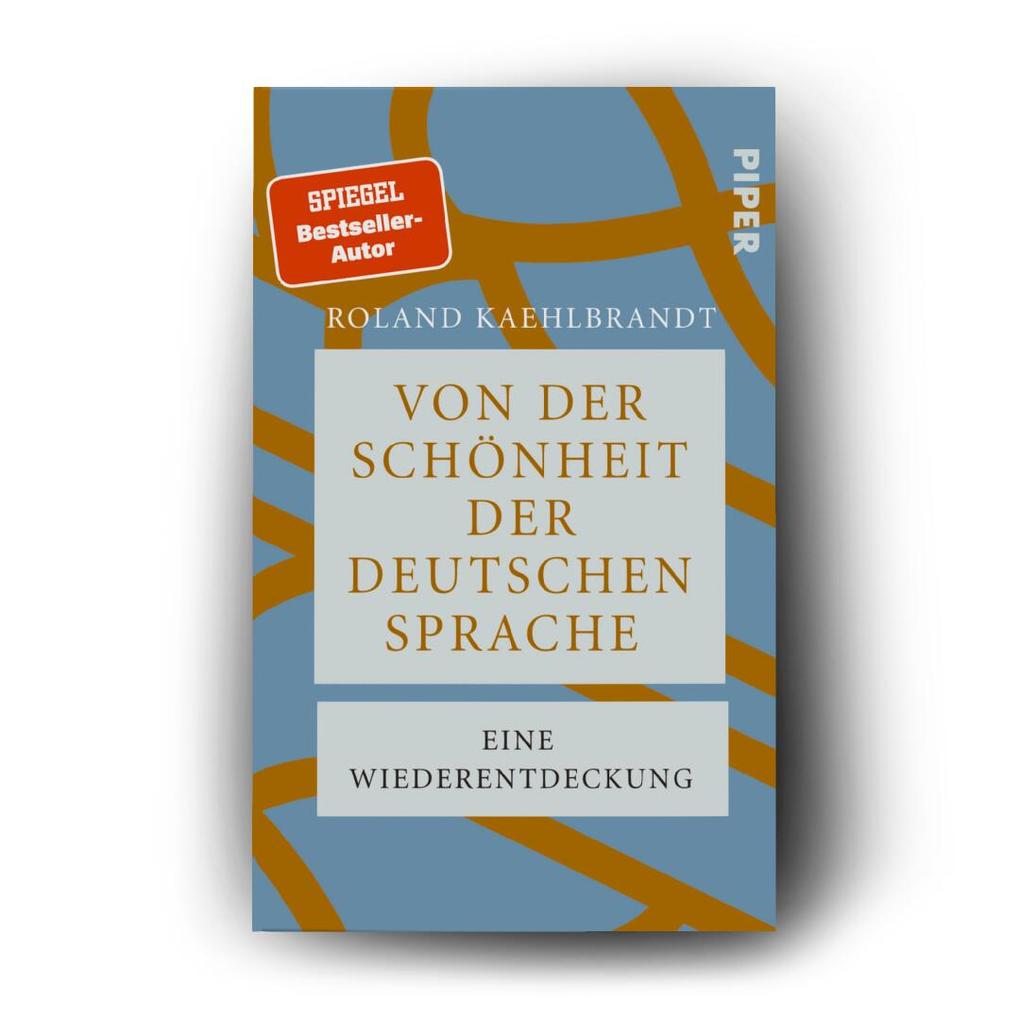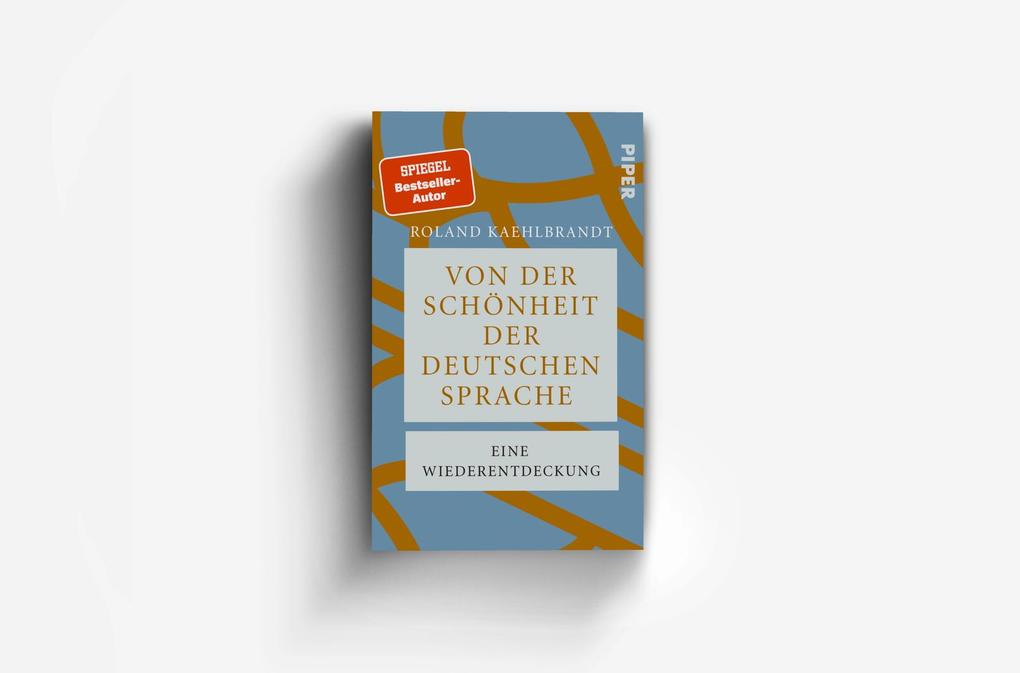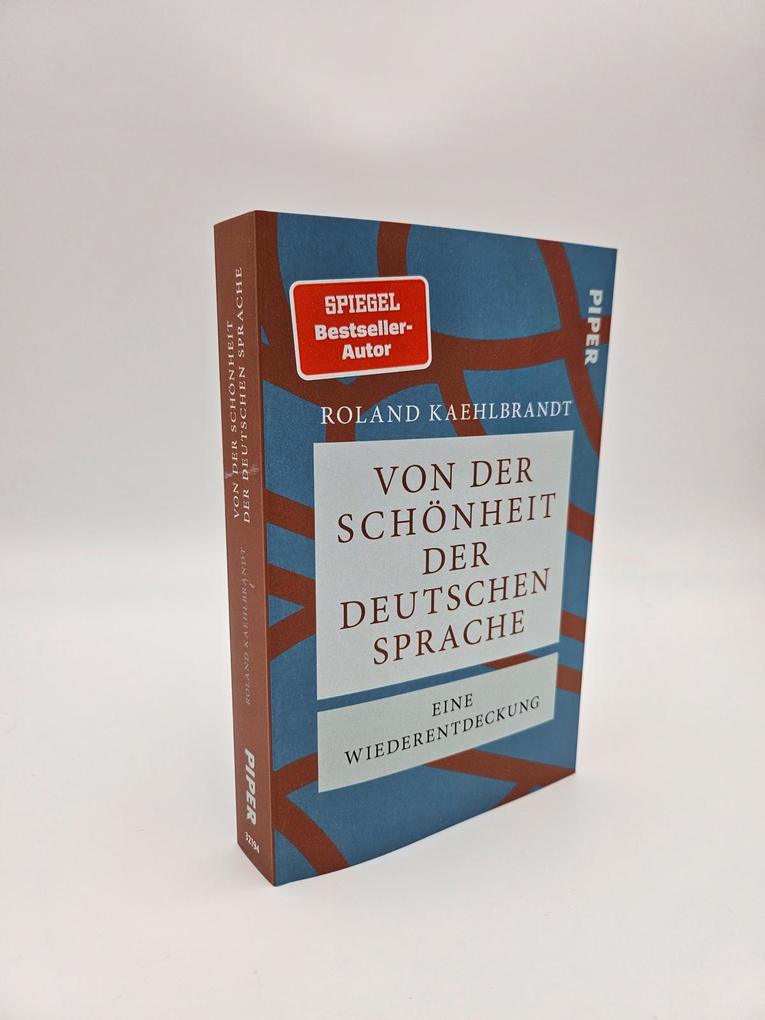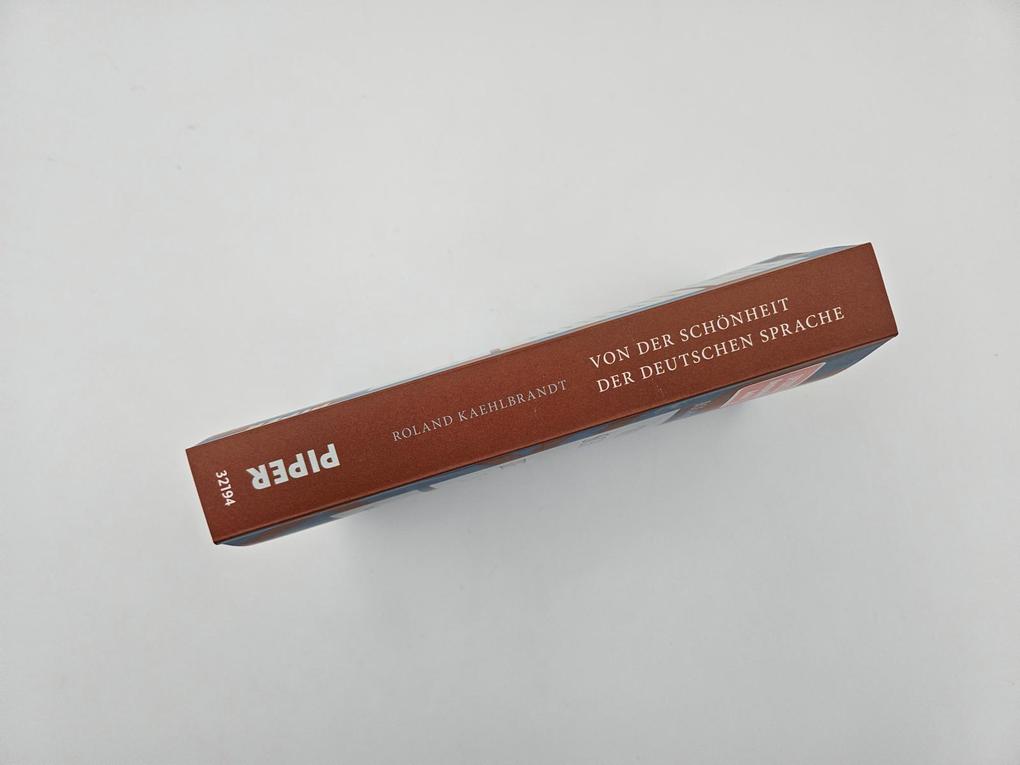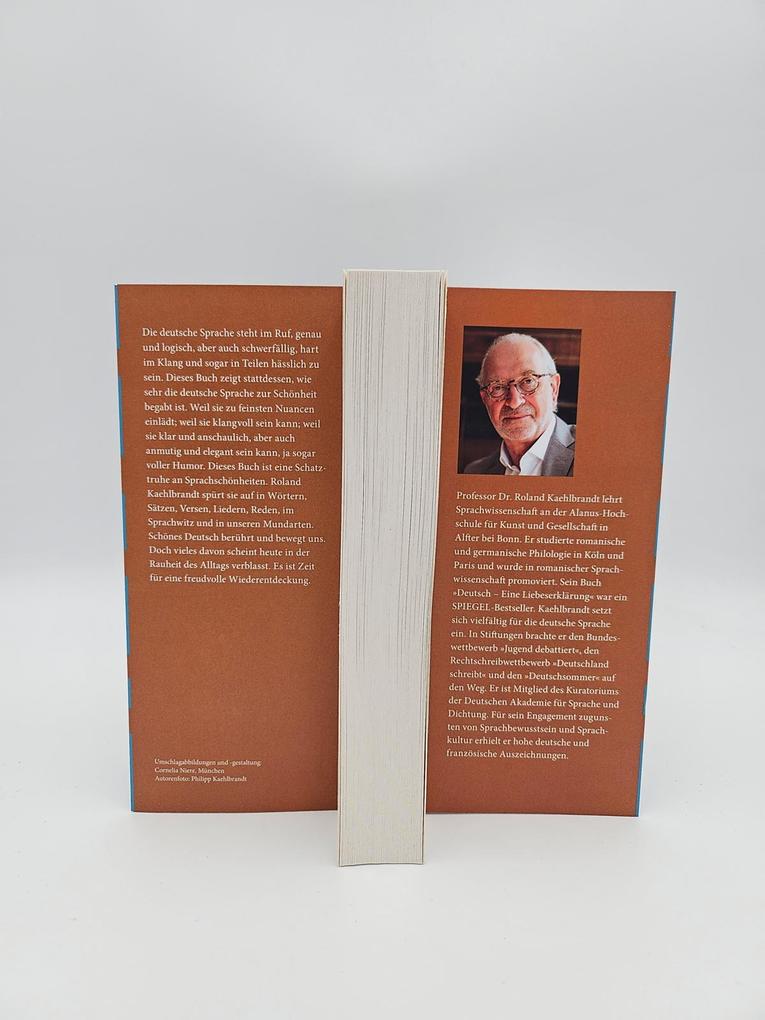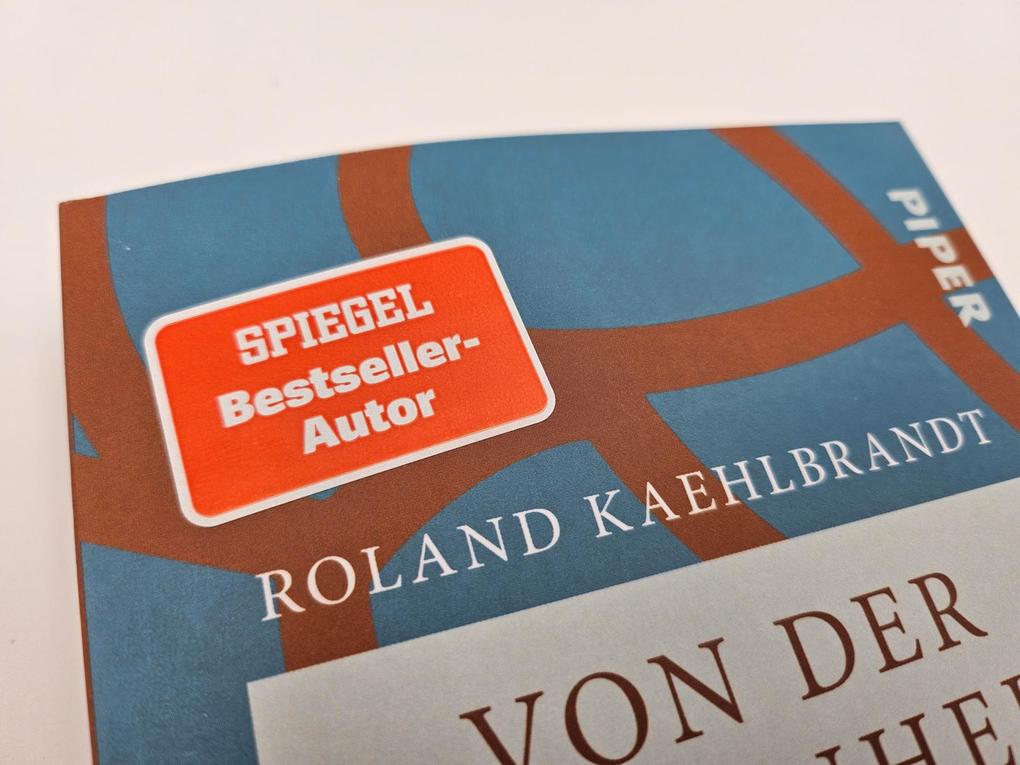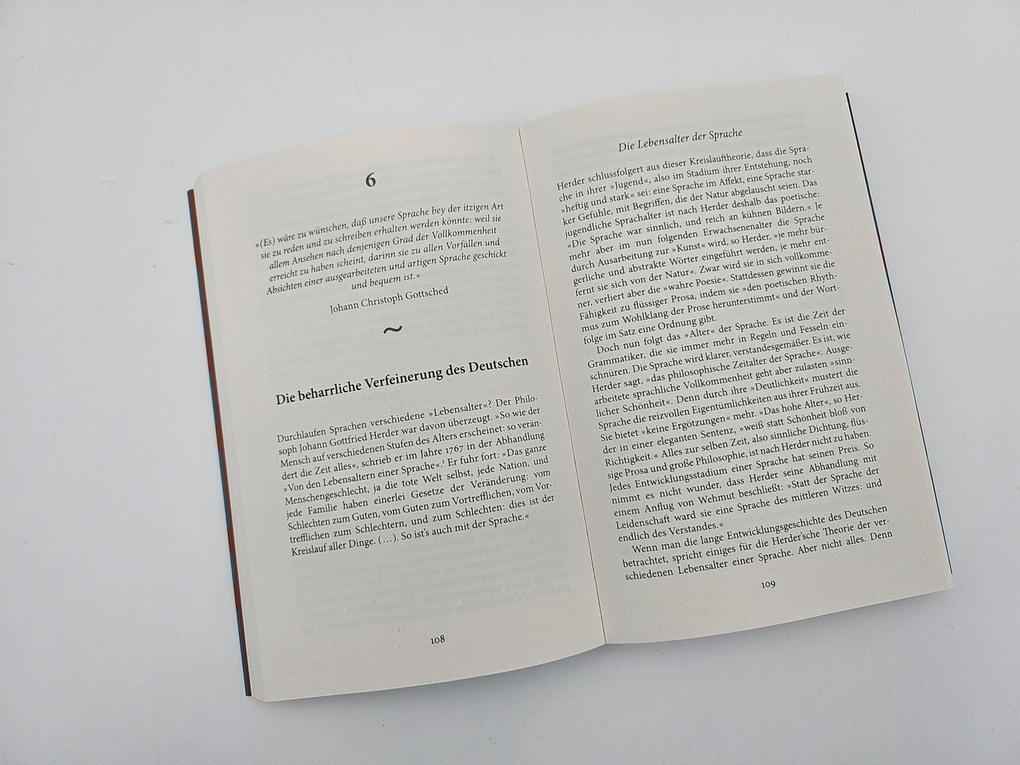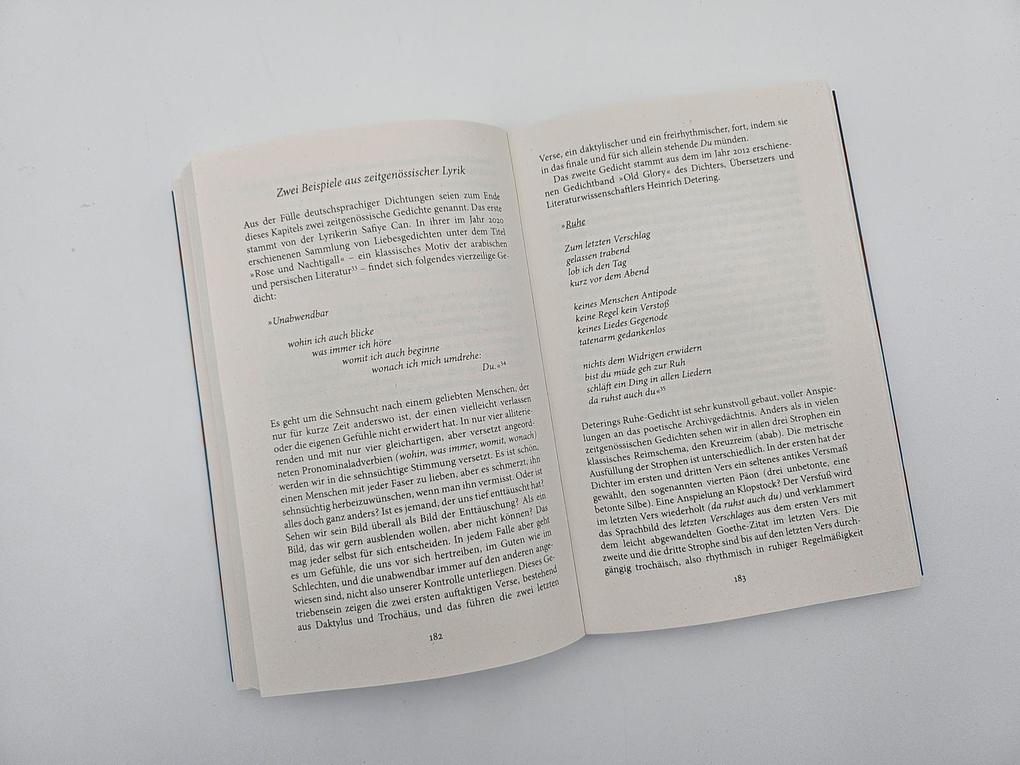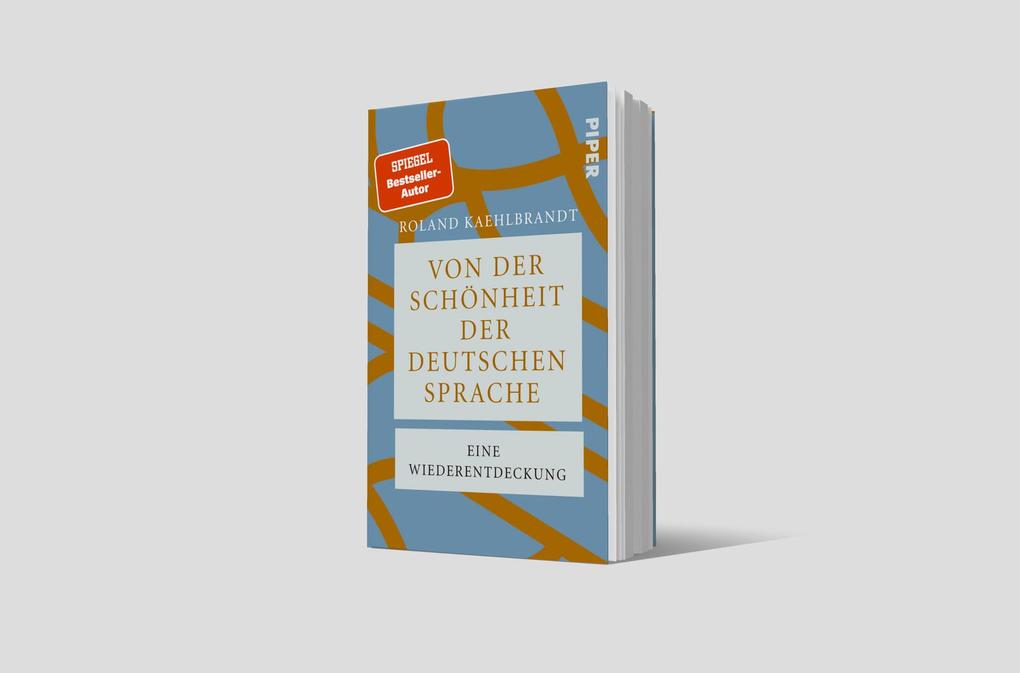Besprechung vom 25.10.2025
Besprechung vom 25.10.2025
Gelobt seien die Komposita
Antipharmakon gegen Verhunzungen aller Art: Roland Kaehlbrandt widmet sich in einnehmender Weise Schönheiten der deutschen Sprache.
Süß" nennt der argentinische Dichter Jorge Luis Borges das Deutsche. In seinem Gedicht "Al idioma alemán"/"An die deutsche Sprache" rühmt er "die verflochtene Liebe der zusammengesetzten Wörter" und ihre "offenen Vokale und Laute", die für den griechischen Hexameter ebenso geschaffen seien, wie sie das "Raunen von Wäldern und von Nächten" wiederzugeben vermöchten. Solcher Lobpreis ist selten. Charakteristisch für den Ruf des Deutschen in der Welt sind eher negative Bewertungen. Mark Twain spottete über die grammatischen Vertracktheiten der "schrecklichen deutschen Sprache". Voltaire sah, wie sein Bewunderer Friedrich der Große, im Deutschen lediglich eine Sprache für Soldaten, Pferde und die Gasse. Für seinen Roman "Candide" erfand er Ortsnamen wie "Valdberghoff-trarbk-dikdorf", um so die vermeintlich konsonantengesättigte Hässlichkeit der Sprache vorzuführen. Solche Urteile zeugen zwar mindestens so sehr von den Voreingenommenheiten ihrer Urheber wie von den realen Eigenschaften des Deutschen, haben sich aber gleichwohl als langlebig erwiesen. Mehr als alles andere schädigte schließlich der bellende Hetz- und Befehlston der Nationalsozialisten die Reputation des Deutschen. Charlie Chaplins abgehackt brüllende Hitler-Karikatur ("Demokratsie Schtonk! Liberty Schtonk! Free Sprekken Schtonk!") reduziert die bedrohliche Lächerlichkeit dieser Sprechweise auf ihre akustische Essenz.
Dem Zerrbild vom harten, misstönenden, ungeschmeidigen Deutsch setzt Roland Kaehlbrandt ein Porträt entgegen, das eine zur Schönheit begabte Sprache zeigt, beweglich und nuancenreich, bildkräftig, klangvoll und mit dem Potential zur Eleganz. Dafür unternimmt er ausgedehnte Streifzüge durch die Landschaften der Wissenschaftssprache, der politischen Rede, des Humors und vor allem der Literatur samt ihrem klingenden Teil, den Volks- und Kunstliedern, Opernarien, Schlagern, Chansons und Popsongs.
Geschrieben ist das Buch in einem angenehm lesbaren Stil, der dem Thema Ehre macht. Da Schönheit sich nur schwer definieren lässt und erst im Auge des Betrachters oder im Ohr des Hörers sinnfällig wird, präsentiert der Autor eine ausgiebige Leistungsschau deutscher Sprachästhetik. Dazu gehören nicht nur die Wortschmiedewerke Goethes (freundfeierlich, wonneschaurig) oder Klopstocks (flammenverkündend, stillanbetend) und lyrische Meisterwerke wie Matthias Claudius' "Abendlied" (Der Wald steht schwarz und schweiget) oder Rilkes "Herbsttag" (Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, und auf den Fluren laß die Winde los). Auch die zwar nicht überragende, aber doch solide Qualität zeitgenössischer Populärsprachkultur kommt durch Künstler wie Herbert Grönemeyer (Du hast jeden Raum / Mit Sonne geflutet), Udo Lindenberg (Hinterm Horizont geht's weiter) oder den Poetry-Slammer Timo Brunke (Ja, ihr hört es, eher würden wir sterben / Als nicht mehr für die Verben zu werben!) zu ihrem Recht und bezeugt, dass dem Deutsch der Gegenwart Vitalität und Musikalität nicht abhandengekommen sind.
Die Lyrik, deren Reime, Metren und Strophenformen die Sprache selbst in ihrer Stofflichkeit zur Sprache bringen, nimmt im Buch naturgemäß einen großen Raum ein, aber auch die Prosa kommt nicht zu kurz, wobei mancher Leser die eine oder andere (Wieder-)Entdeckung machen könnte. Dem Rezensenten ging es so mit Peter Weiss' Kindheitserinnerungen "Abschied von den Eltern". Aus ihnen zitiert Kaehlbrandt eine Passage, deren hyperrealistische Wachtraum-Sprache einen Sog entfaltet, der den Wunsch nach der Lektüre des ganzen Buchs weckt. Mit "Schwarzen Löchern" und "Dunkelwolken", "Roten Riesen", "Weißen Zwergen", dem "Kugelhaufen" und dem "Quantenschaum" kommen auch die poetischen Seiten der deutschen Wissenschaftssprache zum Klingen, das in Zeiten der englisch dominierten "Global science" aber wohl eher ein Verklingen ist.
Der Autor belässt es nicht bei der Demonstration sprachlicher Schönheiten, sondern untersucht auch, welche Mittel und Mechanismen ihnen zugrunde liegen. Dazu gehört zum Beispiel die Möglichkeit, Komposita zu bilden - Borges' "verflochtene Liebe der zusammengesetzten Wörter" -, die einfache Substantive zum "Abendhauch", zum "Schilfgeflüster" oder zur "Wintersonnenwende" verschmelzen und so einen schier unerschöpflichen Nuancenreichtum erzeugen. Viel sprachästhetisches Potential bietet auch die relativ freie Wortstellung des Deutschen, die fein differenzierte Perspektivierungen und Gewichtungen erlaubt. Diese Beweglichkeit ist möglich, weil im deutschen Satz die Beziehungen zwischen den Wörtern durch die Deklination der Substantive, Artikel und Pronomen und durch die drei Genera angezeigt werden. So konnte Luther, frei von einer starren Subjekt-Prädikat-Objekt-Abfolge, an den Anfang des "Alten Testaments" den Anfang setzen und das göttliche Subjekt erst nach dem Verb einführen: "Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde." Der Schöpfungsakt als fundamentale Setzung all dessen, was folgt, kommt so auch im Satzbau unmittelbar zum Ausdruck.
Und wie verhält es sich mit dem deutschen Klang? Dass man die Deutschen im Ausland "für grobe brummende Leute" hielte, "die mit röstigen Worten daher grummen und mit harten Geleute von sich knarren", hatte schon im 17. Jahrhundert der Sprachgelehrte Justus Georg Schottel beklagt. Kaehlbrandt verweist die dahinter stehende Vorstellung von der knarzenden Konsonantenüberfülle des Deutschen ins Reich der Legende. Deren Zahl liegt kaum über der des wegen seines Wohlklangs gefeierten Italienischen, und an Vokalen weist das Deutsche sogar doppelt so viele auf. Allerdings haben die Silben im Deutschen öfter einen konsonantischen Abschluss als im Italienischen. Kaehlbrandt hebt die besonderen lautmalerischen und rhythmischen Qualitäten hervor, die diese phonetische Eigenschaft mit sich bringt, und führt als Gewährsmann Richard Wagner an, der in einem schönen Sprachbild den Konsonanten zum "Gewand des Vokals" erklärte.
In einer Zeit, in der die Sprache zum Objekt eines politisch korrekten Putzwahns geworden ist und Genderer die Verbesserung der Welt durch die Vergeschlechterung der Grammatik propagieren, steht das Thema der Sprachschönheit unter Eskapismusverdacht. Doch das Gegenteil ist der Fall: Sprachliche Schönheit bereichert nicht nur, sie hat auch eine politische, eine subversive Qualität, weil sie einen Gegenpol bildet zu den sprachideologisch und bürokratisch bedingten Verhunzungen der Sprache, die durch diesen Kontrast umso schärfer sichtbar werden. Roland Kaehlbrandt spricht das in seinem Buch nicht aus. Er zeigt es. WOLFGANG KRISCHKE
Roland Kaehlbrandt: "Von der Schönheit der deutschen Sprache". Eine Wiederentdeckung.
Piper Verlag, München 2025. 320 S.,
br.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.