Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale
NEU: Das Hugendubel Hörbuch Abo - jederzeit, überall, für nur 7,95 € monatlich!
Jetzt entdecken
mehr erfahren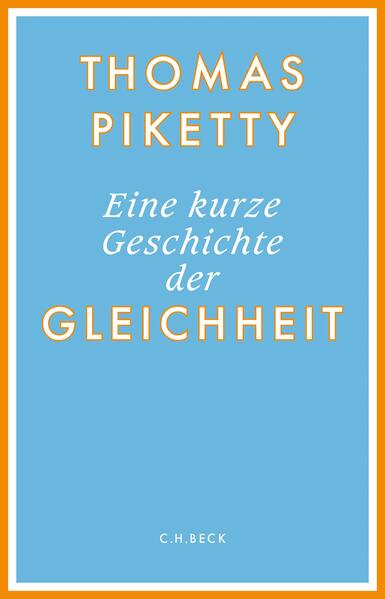
Zustellung: Di, 02.09. - Do, 04.09.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
DAS NEUE GROSSE BUCH DES BESTSELLER-AUTORS THOMAS PIKETTY
Mit seinen voluminösen Bestsellern «Das Kapital im 21. Jahrhundert» und «Kapital und Ideologie» hat Thomas Piketty eine internationale Debatte über die Ursachen sozialer Ungleichheit in Gang gebracht. Sein neues Buch ist eine bewusst komprimierte Weltgeschichte der sozialen Konflikte und Konstellationen und zugleich eine Lektion in globaler Gerechtigkeit: das eine Ökonomie-Buch, das wirklich jeder gelesen haben sollte.
Thomas Piketty hat mit seinen Büchern die soziale Ungleichheit wieder zurück ins Zentrum der politischen Debatten gebracht. Er sieht und benennt den Fortschritt in der Geschichte, und er zeigt uns, mit welchen Mitteln er erzielt wurde. Aber zugleich verwandelt er die historischen Einsichten in einen Aufruf an uns alle, den Kampf für mehr Gerechtigkeit energisch fortzusetzen, auf stabileren historischen Fundamenten und mit einem geschärften Verständnis für die Machtstrukturen der Gegenwart. Denn auf dem langen Weg zu einer gerechteren Welt stellt sich für jede Generation die Frage, ob sie ein neues Kapitel der Gleichheit aufschlägt - oder eines der Ungleichheit.
Mit seinen voluminösen Bestsellern «Das Kapital im 21. Jahrhundert» und «Kapital und Ideologie» hat Thomas Piketty eine internationale Debatte über die Ursachen sozialer Ungleichheit in Gang gebracht. Sein neues Buch ist eine bewusst komprimierte Weltgeschichte der sozialen Konflikte und Konstellationen und zugleich eine Lektion in globaler Gerechtigkeit: das eine Ökonomie-Buch, das wirklich jeder gelesen haben sollte.
Thomas Piketty hat mit seinen Büchern die soziale Ungleichheit wieder zurück ins Zentrum der politischen Debatten gebracht. Er sieht und benennt den Fortschritt in der Geschichte, und er zeigt uns, mit welchen Mitteln er erzielt wurde. Aber zugleich verwandelt er die historischen Einsichten in einen Aufruf an uns alle, den Kampf für mehr Gerechtigkeit energisch fortzusetzen, auf stabileren historischen Fundamenten und mit einem geschärften Verständnis für die Machtstrukturen der Gegenwart. Denn auf dem langen Weg zu einer gerechteren Welt stellt sich für jede Generation die Frage, ob sie ein neues Kapitel der Gleichheit aufschlägt - oder eines der Ungleichheit.
- Ein ökonomischer Crashkurs - von Thomas Piketty
- Die Quintessenz aus «Kapital im 21. Jahrhundert» und «Kapital und Ideologie»
Inhaltsverzeichnis
Danksagungen
Einführung
Kapitel 1
Der lange Weg zur Gleichheit: Erste Anmerkungen
Kapitel 2
Die allmähliche Dekonzentration von Macht und Eigentum
Kapitel 3
Das Erbe der Sklaverei und des Kolonialismus
Kapitel 4
Die Frage der Wiedergutmachung
Kapitel 5
Revolutionen, Status, Klassen
Kapitel 6
Die große Umverteilung, 1914 1980
Kapitel 7
Demokratie, Sozialismus und progressive Einkommensteuer
Kapitel 8
Reale Gleichheit gegen Diskriminierung
Kapitel 9
Auswege aus dem Neokolonialismus
Kapitel 10
Für einen demokratischen, ökologischen sowie ethnisch und kulturell diversen Sozialismus
Einführung
Kapitel 1
Der lange Weg zur Gleichheit: Erste Anmerkungen
Kapitel 2
Die allmähliche Dekonzentration von Macht und Eigentum
Kapitel 3
Das Erbe der Sklaverei und des Kolonialismus
Kapitel 4
Die Frage der Wiedergutmachung
Kapitel 5
Revolutionen, Status, Klassen
Kapitel 6
Die große Umverteilung, 1914 1980
Kapitel 7
Demokratie, Sozialismus und progressive Einkommensteuer
Kapitel 8
Reale Gleichheit gegen Diskriminierung
Kapitel 9
Auswege aus dem Neokolonialismus
Kapitel 10
Für einen demokratischen, ökologischen sowie ethnisch und kulturell diversen Sozialismus
Produktdetails
Erscheinungsdatum
30. März 2023
Sprache
deutsch
Untertitel
Originaltitel: Une brève histoire de l'égalité.
mit 41 Grafiken und Tabellen.
Seitenanzahl
264
Autor/Autorin
Thomas Piketty
Übersetzung
Stefan Lorenzer
Illustrationen
mit 41 Grafiken und Tabellen
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
französisch
Produktart
gebunden
Abbildungen
mit 41 Grafiken und Tabellen
Gewicht
479 g
Größe (L/B/H)
217/145/26 mm
ISBN
9783406790980
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Shortlist für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2022
Platz 3 der Sachbuch-Bestenliste von ZEIT, ZDF und Deutschlandfunk im September 2021: Das Standardwerk für jeden, der die Ursachen von Ungleichheit verstehen will.
Wer sich von dem oft klassenkämpferischen Duktus nicht abschrecken lässt, für den enthält das Buch aber durchaus Interessantes und teils Lehrreiches. Piketty zeichnet mit einer Fülle interessanter Daten die großen Linien der historischen Entwicklung nach.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Tillmann Neuscheler
Ein fulminanter historischer Crashkurs von der französischen Revolution bis zur Gegenwart. "
NZZ, Guido Schätti
Thomas Piketty hat ein Buch vorgelegt, das zur drängendsten Frage unserer Tage einiges zu sagen hat. Und man würde sich wünschen: Möge die Ampel, mögen Olaf Scholz und Christian Lindner irgendwie dazu kommen, dieses Buch zu lesen
Der Freitag, Pepe Egger
Piketty macht deutlich, dass das Problem der kolonialen Schuld angegangen werden muss, auch mit wirtschaftlichen Reparationen, schließlich profitieren die einstigen Sklavenhalter und Kolonisatoren bis heute.
Merkur, William Davies
Provokation für die ordnungspolitische Debatte Piketty legt Finger in die Wunden einer deformierten Marktwirtschaft, die Wohlfahrt mit Shareholder-Value verwechselt. Gut zu lesen ist Best of Piketty` auch.
Handelsblatt, Hans-Jürgen Jakobs
Eine Kurzfassung seiner Standardwerke . . . und mehr als das. . . Er sieht die Geschichte trotz aller Ungerechtigkeiten als Entwicklung hin zu mehr Gleichheit.
Falter, Markus Marterbauer
Ein Lichtstrahl in der Düsternis. Seine Umbaupläne sind radikal, ja, aber nicht gewaltsam. Sie machen etwas Hoffnung auf mehr Gleichheit in Frieden.
Hohe Luft, Tobias Hürter
Eine bündige, aber zugleich detaillierte und historisch aufgeschlüsselte Betrachtung der Frage, was Gleichheit eigentlich bedeutet; und was man aus der Jahrhunderte währenden Geschichte dieses - oft auch erfolgreichen - Kampfs für die Gegenwart und die kommenden Krisen lernen kann.
Deutschlandfunk, Jens Balzer
Erfrischend eingängig geschrieben. Der Ökonom verwendet eine Menge Theorieanstrengung auf die Entwicklung von Ideen, wie die Menschheit allen Herausforderungen zum Trotz voranschreiten könnte auf dem Weg zu einem lebenswerteren Leben für alle.
WDR 5, Günther Kaindlstorfer
Spannender Einstieg in Pikettys Werk.
Hörzu
Piketty stellt erneut die ihm eigene, schlichtweg beneidenswerte Fähigkeit unter Beweis, seine Analysen und Thesen in einer verständlichen Sprache vorzustellen.
Soziopolis, Hartmut Kaelble
In seinem Buch zeigt der Ökonom Thomas Piketty, dass die Ungleichheit im Laufe der Geschichte zurückgegangen ist, aber auch, dass man sie nur erfolgreich bekämpfen kann, wenn man die Mechanismen versteht, die ihr zugrunde liegen. "
Le Monde, Antoine Reverchon
Thomas Piketty entwickelt eine Position, die über die rein wirtschaftliche Frage hinausgeht und den Weg zur Gleichheit, der ein Kampf` bleibt, in eine umfassendere Perspektive rückt. "
Libération
Warum ist das Werk so durchschlagend? Weil Piketty einige Annahmen der liberalen Ökonomie zertrümmert. Angefangen mit der Idee, dass Ungleichheit ein notwendiges Übel sei.
philosophie magazine
" Best of Piketty"
marktundmittelstand, Thorsten Giersch
Platz 3 der Sachbuch-Bestenliste von ZEIT, ZDF und Deutschlandfunk im September 2021: Das Standardwerk für jeden, der die Ursachen von Ungleichheit verstehen will.
Wer sich von dem oft klassenkämpferischen Duktus nicht abschrecken lässt, für den enthält das Buch aber durchaus Interessantes und teils Lehrreiches. Piketty zeichnet mit einer Fülle interessanter Daten die großen Linien der historischen Entwicklung nach.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Tillmann Neuscheler
Ein fulminanter historischer Crashkurs von der französischen Revolution bis zur Gegenwart. "
NZZ, Guido Schätti
Thomas Piketty hat ein Buch vorgelegt, das zur drängendsten Frage unserer Tage einiges zu sagen hat. Und man würde sich wünschen: Möge die Ampel, mögen Olaf Scholz und Christian Lindner irgendwie dazu kommen, dieses Buch zu lesen
Der Freitag, Pepe Egger
Piketty macht deutlich, dass das Problem der kolonialen Schuld angegangen werden muss, auch mit wirtschaftlichen Reparationen, schließlich profitieren die einstigen Sklavenhalter und Kolonisatoren bis heute.
Merkur, William Davies
Provokation für die ordnungspolitische Debatte Piketty legt Finger in die Wunden einer deformierten Marktwirtschaft, die Wohlfahrt mit Shareholder-Value verwechselt. Gut zu lesen ist Best of Piketty` auch.
Handelsblatt, Hans-Jürgen Jakobs
Eine Kurzfassung seiner Standardwerke . . . und mehr als das. . . Er sieht die Geschichte trotz aller Ungerechtigkeiten als Entwicklung hin zu mehr Gleichheit.
Falter, Markus Marterbauer
Ein Lichtstrahl in der Düsternis. Seine Umbaupläne sind radikal, ja, aber nicht gewaltsam. Sie machen etwas Hoffnung auf mehr Gleichheit in Frieden.
Hohe Luft, Tobias Hürter
Eine bündige, aber zugleich detaillierte und historisch aufgeschlüsselte Betrachtung der Frage, was Gleichheit eigentlich bedeutet; und was man aus der Jahrhunderte währenden Geschichte dieses - oft auch erfolgreichen - Kampfs für die Gegenwart und die kommenden Krisen lernen kann.
Deutschlandfunk, Jens Balzer
Erfrischend eingängig geschrieben. Der Ökonom verwendet eine Menge Theorieanstrengung auf die Entwicklung von Ideen, wie die Menschheit allen Herausforderungen zum Trotz voranschreiten könnte auf dem Weg zu einem lebenswerteren Leben für alle.
WDR 5, Günther Kaindlstorfer
Spannender Einstieg in Pikettys Werk.
Hörzu
Piketty stellt erneut die ihm eigene, schlichtweg beneidenswerte Fähigkeit unter Beweis, seine Analysen und Thesen in einer verständlichen Sprache vorzustellen.
Soziopolis, Hartmut Kaelble
In seinem Buch zeigt der Ökonom Thomas Piketty, dass die Ungleichheit im Laufe der Geschichte zurückgegangen ist, aber auch, dass man sie nur erfolgreich bekämpfen kann, wenn man die Mechanismen versteht, die ihr zugrunde liegen. "
Le Monde, Antoine Reverchon
Thomas Piketty entwickelt eine Position, die über die rein wirtschaftliche Frage hinausgeht und den Weg zur Gleichheit, der ein Kampf` bleibt, in eine umfassendere Perspektive rückt. "
Libération
Warum ist das Werk so durchschlagend? Weil Piketty einige Annahmen der liberalen Ökonomie zertrümmert. Angefangen mit der Idee, dass Ungleichheit ein notwendiges Übel sei.
philosophie magazine
" Best of Piketty"
marktundmittelstand, Thorsten Giersch
 Besprechung vom 12.09.2022
Besprechung vom 12.09.2022
Pikettys Traum vom Mindesterbe
Über die Geschichte der Gleichheit
Drei Bücher von monumentalem Umfang hat der französische Starökonom Thomas Piketty in den vergangenen beiden Jahrzehnten vorgelegt: Zuerst im Jahr 2001 ein Buch über die Ungleichheit in Frankreich ("Les hauts revenus en France au XXe siècle"), dann 2013 sein wohl bekanntestes Buch "Das Kapital im 21. Jahrhundert" und schließlich 2020 "Kapital und Ideologie". Die Bücher sind jeweils um die 1000 Seiten lang, was viele Leser abschreckt. Weil Piketty das selbst eingesteht, hat er nun - wie er selbst sagt - eine Art Resümee seiner Arbeit auf knapp 300 Seiten vorgelegt: "Eine kurze Geschichte der Gleichheit" heißt das Buch, das Interessierten einen kompakten Einblick in den Kosmos des linken Ökonomen gibt.
Aus seiner aktivistischen Einstellung macht der Bestsellerautor keinen Hehl. Der Ton wird gleich zu Beginn gesetzt: Ökonomische Fragen seien "zu wichtig, um sie einer kleinen Kaste von Spezialisten und Führungspersonal zu überlassen", schreibt er. Es gehe um die "Änderung der Machtverhältnisse". Am Ende des Buches ruft er seinen Lesern zu, ohne aktive Bürger könnten die Kräfteverhältnisse nicht verschoben werden. Die bisherigen Erfolge auf dem Weg zu mehr Gleichheit seien die Konsequenz sozialer Kämpfe, die möglich gemacht hätten, Institutionen zu stürzen. Noch immer komme das internationale Rechtssystem "meist einem Neokolonialismus zugunsten der Reichen gleich".
Wer sich von dem oft klassenkämpferischen Duktus nicht abschrecken lässt, für den enthält das Buch aber durchaus Interessantes und teils Lehrreiches. Piketty zeichnet mit einer Fülle interessanter Daten (vor allem langen Zeitreihen) über Einkommen, Vermögen, Erbschaften, Bildungsinvestitionen und Steuersätzen die großen Linien der historischen Entwicklung nach. Anders als Karl Marx sieht er die kapitalistische Welt nicht zwangsläufig auf dem Weg zu einer immer höheren Vermögensungleichheit. Im Mittelpunkt des jetzt vorgelegten Buches stehen auch keine theoretischen Debatten, ob die Kapitalrendite nun größer ist als das Wirtschaftswachstum. Die langfristige Entwicklung sieht er durchaus positiv: Langfristig - so schreibt er - "gibt es eine historische Bewegung hin zur Gleichheit, zumindest seit dem Ende des 18. Jahrhunderts". Die Welt im Jahr 2020 sei viel egalitärer als 1950 oder 1900, die "ihrerseits in zahlreichen Hinsichten egalitärer war als die Welt von 1850 oder 1789". Dazu haben laut Piketty drei Gründe beigetragen: das Ende des Kolonialismus, der Aufbau des Sozialstaats und die Erfindung progressiver Steuersysteme. Noch im 19. Jahrhundert seien die Steuern dagegen regressiv gewesen, Arme haben also einen höheren Anteil ihres Einkommens abgeben müssen als Reiche.
Obwohl er einen historischen Trend zu mehr Gleichheit anerkennt, warnt er davor, darüber schon in Jubel auszubrechen. Zwar sei es vielen Armen in den vergangenen 200 Jahren gelungen, erstmals aufzusteigen. Bis ins beginnende 20. Jahrhundert habe es noch überhaupt keine wirkliche Mittelschicht gegeben. Doch eben längst nicht allen hätten die Tore zum Aufstieg offengestanden: "Die ärmsten 50 Prozent haben praktisch nie etwas Nennenswertes besessen", schreibt er: "Die Vorstellung, man brauche nur abzuwarten, bis das Wachstum für allgemeinen Wohlstand sorge, ergibt wenig Sinn." Auf dem langen Weg zu einem Staatswesen nach seiner Idealvorstellung eines "partizipativen Sozialismus" sieht er die Welt erst auf etwa halber Strecke angelangt. Piketty träumt von einer "Entmarktung" der Wirtschaft. Er fordert den weiteren Ausbau des Sozialstaats und deutlich höhere Einkommensteuern für Reiche. Spitzensteuersätze von 80 bis 90 Prozent hält er keineswegs für überzogen, er verweist darauf, dass es solche Sätze ansatzweise schon bis Ende der 70er Jahre in den USA und Großbritannien gab.
Wie radikal er denkt, zeigt auch sein Traum von einem Mindesterbe für alle, den er in dem Buch abermals präsentiert. In seinen Augen könnte ein solches Minimalerbe bei 60 Prozent des Durchschnittsvermögens eines Erwachsenen liegen. So kommt er mit Blick auf sein Heimatland Frankreich auf ein Minimalerbe in Höhe von etwa 120 000 Euro, das jedem im Alter von 25 Jahren ausbezahlt werden soll, finanziert aus Vermögensteuern. Ähnliche Ideen hatten vor ihm schon der britische Ungleichheitsforscher Tony Atkinson, der sich dabei wiederum auf den Philosophen Thomas Paine, einen der Gründerväter der Vereinigten Staaten, berief.
Liberales Denken kritisiert er durchweg, sein Feindbild ist intakt: der "Neoliberalismus". Interessanter als seine Politikempfehlungen sind seine wirtschaftshistorischen Rückblicke. Lesenswert ist etwa das Kapitel über das Erbe der Sklaverei und des Kolonialismus. Darin präsentiert er interessante Zahlen zum Aufstieg und Niedergang der Sklaverei in Amerika. Und er überrascht mit wenig bekannten Fakten: Als in Haiti Anfang des 19. Jahrhunderts nach einem Sklavenaufstand zum ersten Mal in der Neuzeit die Sklaverei abgeschafft wurde, setzte Frankreich Entschädigungszahlungen durch. Geld bekamen aber nicht die Sklaven, sondern die ehemaligen französischen Sklavenbesitzer für den Verlust ihres "Eigentums". Rund 125 Jahre lang zahlte Haiti dafür Schulden ab, erst Anfang der 1950er Jahre war die letzte Rate getilgt. Piketty fordert von Frankreich, dafür eine Wiedergutmachung in Höhe von 30 Milliarden Euro zu zahlen. Man muss sich solche Forderungen nicht zu eigen machen, aber der Hinweis auf solch dunkle und eher unbekannte Kapitel der Geschichte ist durchaus statthaft. TILLMANN NEUSCHELER
Thomas Piketty: Eine kurze Geschichte der Gleichheit, C. H. Beck, München 2022, 264 Seiten
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 11.01.2023
Unbedingt lesen, wenn man über die Steuerungsmöglichkeiten zu mehr Gleichheit Bescheid wissen möchte - jeder Bürger sollte das Buch lesen!









