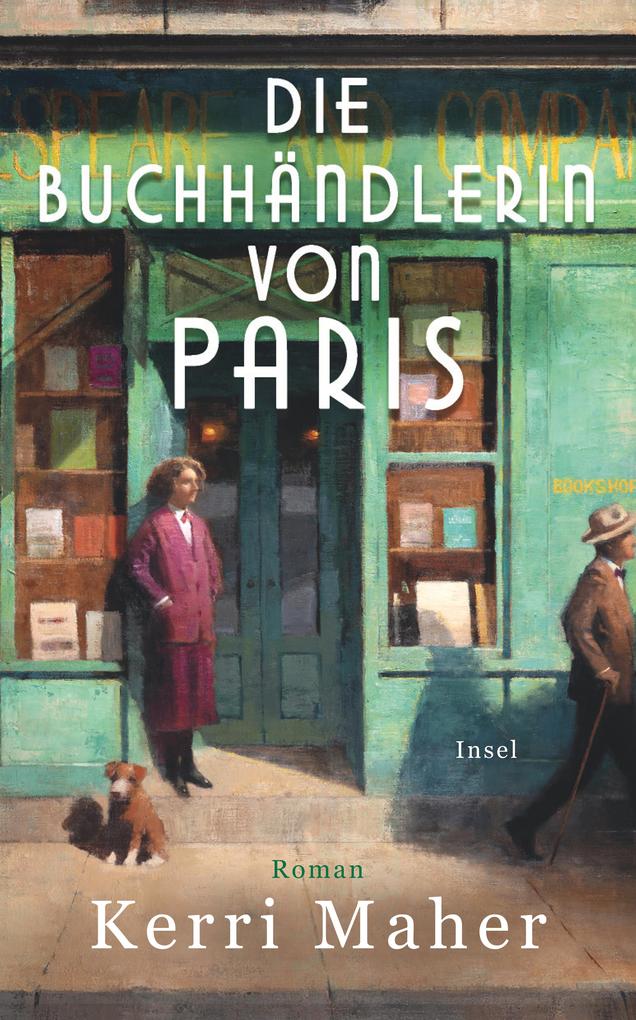Besprechung vom 11.10.2025
Besprechung vom 11.10.2025
Im Buchladen muss einfach immer alles gut werden
Weshalb liegen derzeit so viele Romane aus, in denen es um Buchhändler geht? Was vielerorts vom Verschwinden bedroht ist, wird in der Unterhaltungsliteratur gnadenlos verklärt. Hollywood hat es vorgemacht.
Von Ursula Scheer
Von Ursula Scheer
Dunkle Holzregale, Bände bis unter die Decke und ein Buchhändler, der weiß, welche Lektüre einem guttäte: Es gibt sie noch, die kleinen inhabergeführten Buchhandlungen um die Ecke, wenn auch immer seltener. Den größten Raum scheinen sie - bedrängt von Ketten, Onlinehandel und einer multimedial beförderter Leseunlust - mittlerweile in der kollektiven Imagination einzunehmen. Dort ist der Buchladen zur Chiffre für einen Ort menschlicher Wärme geworden, in dem diejenigen, die sich lesend von Geschichten davontragen lassen, ebenso zu sich selbst finden wie zu anderen, auf dass sie Liebe und seelische Genesung erfahren.
So jedenfalls hat Hollywood es inszeniert. In Nora Ephrons romantischer Komödie "E-Mail für dich" von 1998 gibt der bedrohte Einzelhandel die Idealkulisse für Irrungen und Wirrungen ab. Darin verstrickt sind die Inhaberin eines niedlichen Kinderbuchladens - gespielt von Meg Ryan als "American sweetheart" - und der Besitzer einer in New York expandieren Buchhandelskette (verkörpert von Tom Hanks). Abseits des geschriebenen Wortes bekriegen sich beide, als Brieffreunde finden sie einander unwiderstehlich. Anders als in der Filmvorlage von Ernst Lubitsch, die 1940 in einer Budapester Lederwarenhandlung spielte und wiederum auf das Theaterstück "Parfümerie" von Miklós László zurückgeht, wird kurz vor der Jahrtausendwende dank des jungen World Wide Web elektronisch korrespondiert. Hintergrund ist ein kapitalistischer Verdrängungswettbewerb, den keine Buchpreisbindung zivilisiert: Als Vorbild für die fiktive Kette "Fox & Sons Bookstores" ist leicht "Barnes & Noble" mit den Starbucks-Cafés in seinen Großfilialen auszumachen.
Mit der Heldin meint es "E-Mail für dich" nur vordergründig gut: Im emanzipatorischen Albtraum wird die fortschrittsgläubige Illusion aufgebaut, Relikte der Vergangenheit wie der von der Mutter geerbte shop around the corner gingen praktisch schmerzfrei in Neuem auf. Umso amüsanter, wovon "E-Mail für dich" nichts wissen konnte - dass es einmal nicht nur digitale Briefe, sondern auch Bücher geben würde -, und was es ausblendet: Fünf Jahre bevor der Film in die Kinos kam, hat ein Jungunternehmer eine Firma namens Amazon gegründet, die auch den größten stationären Buchhändler das Fürchten lehren sollte.
Nach diesem Popcorn-Klassiker wurde es erst einmal still um Buchbetriebe in der Unterhaltungsindustrie. Bis zwölf Jahre später auf der anderen Seite der Erdkugel ein junger Schriftsteller einen neuen Standard setzte mit einem leicht zu lesenden Roman über den Buchladen als Sehnsuchtsort. Der schmale Roman "Die Tage in der Buchhandlung Morisaki", Satoshi Yagisawas Erstling, erzählt aus der Perspektive einer jungen Frau. Sie wurde von ihrem Freund sitzengelassen und findet, obwohl selbst wenig leseaffin, Trost als Aushilfe im Antiquariat ihres Onkels. Über dem Geschäft kann sie eine winzige Wohnung beziehen, und der Kontakt mit Literatur und bibliophilen Menschen lässt ihr gebrochenes Herz heilen.
Was sich da als Handlung entfaltet, ist ziemlich vorhersehbar, doch charmant arrangiert. Yagisawas Buch wurde erst in der Heimat des Autors, dann international ein Bestseller - wobei man sich als des Japanischen nicht mächtiger Leser der deutschen Ausgabe (Insel Verlag, 2023) fragen kann, ob das Original sprachlich ebenso dürftig ist wie die Übersetzung: "Das ,Erlebnis' hatte mir wider Erwarten Auftrieb gegeben. Der Knoten in meiner Brust war weg, ich fühlte mich frei und endlich in der Lage, mein Leben wieder in Angriff zu nehmen." Zum Ausgleich zeigt die Titelillustration von Elisa Menini vorbildlich, wie man ein Buch über Büchermenschen an dieselben bringt: Man präsentiert den Eingang eines Ladenlokals voller gedruckter Schätze; aus den Schaufenstern dringt einladend Licht nach außen, und irgendwo ist eine Katze zu entdecken.
Einen Ort für Begegnungen schaffen wollte auch die amerikanische Schriftstellerin Ann Patchett, als sie 2011 gegen den Trend einen Buchladen in Nashville eröffnete, den sie immer noch erfolgreich betreibt. Das Bedürfnis danach, unter Gleichgesinnten in Bücher wortwörtlich hineinzuschnuppern, über die Seiten der Bände zu streichen und sie in der Hand zu wiegen vor dem Kauf, ist nicht verschwunden. Es fließt ein in neue Trends wie den um 2015 in den sozialen Medien entstandenen Retro-Stil "Dark Academia", der Menschen aussehen lässt, als wären sie als Zeitreisende einer Bibliothek, einem Buchladen oder einem Antiquariat der Zwischenkriegsjahre entstiegen. Eine Vorliebe fürs Stöbern in Buchhandlungen kann sich mit Nostalgie verbinden oder Eskapismusreflexen folgen - oder auch einem widerständigen Geist, der sozial und kulturell Wertvolles vor dem Überrolltwerden schützen will.
Belletristisch war die Zeit offenbar längst reif für die Buchhandlung als emotionale Wellness-Oase. Eine Skandinavierin eröffnet nach dem Tod ihrer Freundin mit deren Bibliothek einen Buchladen irgendwo in Iowa und findet die Liebe: Das ist der Plot des 2013 zuerst in Schweden erschienenen Romans von Katarina Bivald, der auf Deutsch ein Jahr später bei btb als "Ein Buchladen zum Verlieben" herauskam. "Mein zauberhafter Buchladen am Ufer der Seine" heißt ein 2017 publizierter Schmöker der Australierin Rebecca Raisin (hierzulande 2019 bei Aufbau). Er handelt von einem transatlantischen Orts- und Buchhandlungstausch nach Art des Weihnachtsfilms "Liebe braucht keine Ferien". Was in Paris klappt, funktioniert auch in London. Frida Skybäck, eine weitere Schwedin, lässt ihre romantische Heldin "Die kleine Buchhandlung am Ufer der Themse" übernehmen und verschränkt Handlungen auf zwei Zeitebenen miteinander: Auf der gegenwartsnahen erbt eine junge skandinavische Witwe besagtes Geschäft von einer unbekannten Tante, auf der anderen stürzt sich diese im London der Achtzigerjahre ins Unglück.
Wenn schon Todesfälle den Feel-Good-Roman-Weg in die Buchhandlung ebnen, warum nicht offensiv damit umgehen? Die Britin Helen Cox hat es mit "Mord im Buchladen" (deutsch 2022 bei Lübbe) getan. Davon abgesehen, wird länderübergreifend immer und immer wieder dasselbe Schema variiert: Protagonistin überwindet seelische Krise dank einer der Buchhandlung zugeschriebenen literarischen Magie. In den Klappentexten ist die Rede von herzerwärmenden Geschichten darüber, wie man "Trost und Akzeptanz im Leben findet - und über die heilende Kraft von Büchern".
In Turin findet sich "Der Buchladen der verlorenen Herzen" der Italienerin Elisabetta Ligli (2018 bei Knaur), in London "Der fabelhafte Buchladen des Mr Livingstone" der Spanierin Mónica Gutiérrez (2023 bei Goldmann) ebenso wie "Die Buchhandlung in der Baker Street" der Amerikanerin Sarah Jio (2023 als Insel Taschenbuch). In Seoul heißt es in einem offensiv bei Yagisawa abgekupferten Roman "Welcome to the Hyunam-Dong Bookshop" - so heißt ein Roman der Südkoreanerin Hwang Bo-Reum (Bloomsbury Publishing 2023). Auf Spiekeroog spielt Julie Peters' "Mein wunderbarer Buchladen am Inselweg" (2018 bei Aufbau). An Leichtigkeit bis Seichtigkeit geben sich all diese Bücher nichts: Schablonenfiguren finden nach Absolvierung eines Klischeeparcours zum Glück. Name dropping gibt es als Garnitur, von Alexandre Dumas über Jane Austen bis zu J. K. Rowling. Die darf in einem Buch eine betriebsrettende Lesung geben.
Motiviert wurde die lukrative Produktion von Unterhaltungsromanen aus dem Buchhandel wohl von einem europäischen Kinofilm aus dem Jahr 2017, der allerdings etwas raffinierter ist. In "Der Buchladen der Florence Green" spielt Emily Mortimer unter der Regie von Isabel Coixet eine Witwe - Buchhändlerinnen sind in der Fiktion überproportional oft Trauernde -, die es Ende der Fünfzigerjahre in einem Nest an der Küste Suffolks wagt, einen Buchladen zu eröffnen. Ihr einziger wirklich treuer Kunde ist der per Hauslieferung versorgte Mr. Brandish, ein Gentleman-Eremit, in dessen Rolle Bill Nighy glänzt.
Hinter dem sentimentalen Setting mit Bruchsteinhäusern, Fischerbooten, Pelerinen und Strickjäckchen tut sich der Blick in eine Schlangengrube auf: Die Missgünstigen und Mächtigen des Dorfes ertragen es nicht, wenn liberales Gedankengut aus Bücherkisten steigt, und an Nabokovs "Lolita" entzündet sich der Funke des finalen Infernos. Zu schade, dass die hübsche Vordergründigkeit des Melodrams beherrschend bleibt. Die Buchvorlage zu dem Film schrieb Penelope Fitzgerald schon 1978; er ist also gewissermaßen doppelt historisch.
Dann kam die Corona-Pandemie und steigerte - zumindest für kurze Zeit - das Interesse am kleinen Buchladen. Dass Händler im Lockdown auf Fahrrädern Bücher auslieferten, wirkte romantisch, und Carsten Henns im November 2020 bei Piper erschienener "Der Buchspaziergänger" war ein Buch der Stunde, obwohl die Verfilmung 2024 von Ngo The Chau - mit Christoph Maria Herbst als altem Aachener Buchhändler auf Kurierrunde per pedes - herziger wirkt als der Roman.
Amerikanerische Autorinnen scheint der Buchladenroman im historischen Gewand besonders zu reizen. In "Die Buchhändlerin von Paris" (Insel, 2022) widmet Kerri Maher sich Sylvia Beach und deren legendärer Buchhandlung "Shakespeare & Company". Sprachlich ist der Roman ein Floskel-Bingo ("Sein Kopf fuhr so erschrocken hoch, dass es für Sylvia wie ein Faustschlag in den Magen war"). Doch dass er gängige Strickmuster fallenlässt und von lesbischer Liebe sowie der Publikationsgeschichte des "Ulysses" erzählt, verdient Anerkennung. Madeline Martin hingegen ist wieder näher am Erwartbaren: In "Der Buchladen von Pimorse Hill" spendet eine junge Britin während des Zweiten Weltkriegs Menschen mit Büchern Trost.
Das Buch nicht als Kunstwerk, sondern als Medizin und die Buchhandlung als Apotheke: Explizit macht das Nina Georges "Das Bücherschiff des Monsieur Perdu" (Knaur, 2023). Da kehrt ein Buchverkäufer mit seiner schwimmenden "Pharmacie litteraire" nach Paris zurück, wobei ihn die eigene Vergangenheit einholt: als unerfüllte Bitte von José Saramago. Ohne Verweis auf andere, größere Literaten kommt kein Buchladen-Wohlfühlbuch aus. Man kann das wohlwollend als Anleitung zum Weiterlesen verstehen - oder als Trittbrettfahrerei. Und letztlich geht es immer im Kreis herum.
Das beweist einer der jüngsten Bestseller des Genres, aufgemacht mit tiktok-trendig dekoriertem Buchschnitt: Evie Woods' "Der verschwundene Buchladen" (Adrian & Wimmelbuchverlag, 2024). Darin rührt die irische Autorin rund um eine verstörte Heldin zusammen, was sich an Genremotiven etabliert hat, und reichert es mit Fantasy-Elementen, New-Adult-Themen, einem verlorenen Charlotte-Brontë-Manuskript, "Shakespeare & Company" und einem Hauch Franz Kafka auf mehreren Zeitebenen an. Das hat durchaus Unterhaltungswert, ist aber so brutal schlecht übersetzt, dass eine KI am Werke gewesen sein muss. Und wenn man das "Book of Kells" als vorchristliches Werk beschreibt, sollte man nicht metafiktional vorgeben, es läge einem etwas an Literaturgeschichte.
Für Menschen, die Bücher eher als dekorative Objekte wahrnehmen, sind Cafés ohnehin der interessanteste Teil einer Buchhandlung. Laurie Gilmore trägt dem mit "The Cinnamon Bun Book Store" (Harper Collins 2025) Rechnung, dem zweiten Band ihrer als "cosy" treffend charakterisierten Romanreihe aus dem erdachten Örtchen Dream Harbor. Der Japaner Yagisawa, dem wir die Buchhandelsmode in der Belletristik vielleicht zu verdanken haben, hat auch schon das Ladenlokal gewechselt: Gerade ist bei Insel sein Roman "Die Tage im Café Torunka" erschienen.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.