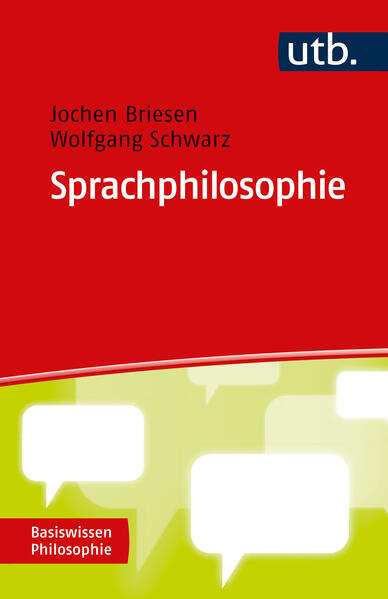Ein zentraler Zweck von Sprache ist der Austausch von Information. Wie lässt sich dieser Prozess verstehen und was genau ist das eigentlich: Sprachliche Bedeutung? Ausgehend von diesen Fragen macht die Einführung Studierende mit den Grundlagen der Sprachphilosophie vertraut und versetzt sie in die Lage, sich selbstständig mit ihren aktuellen Themen auseinanderzusetzen. Ziel ist es, eine möglichst prägnante, systematische Einführung zu liefern, die ausgehend von einer plausiblen Grundidee Schritt für Schritt sprachphilosophische Fragen, Probleme und einflussreiche Lösungsvorschläge entwickelt.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 13
1 Sprachliche Kommunikation und Wahrheitsbedingungen 15
1 1 Kommunikation und Wahrheitsbedingungen 17
1 2 Konventionen 22
1 3 Sprachkonventionen 25
2 Kompositionalität und referentielle Semantik 29
2. 1 Das Kompositionalitätsprinzip 30
2. 2 Das Kontextprinzip 31
2. 3 Eine einfache Modellsprache 33
2. 4 Semantik für die Modellsprache 35
2. 5 Übertragung auf natürliche Sprachen 39
3 Russells Theorie von Eigennamen und Kennzeichnungen 41
3. 1 Kennzeichnungen und Ersetzungsprinzip 41
3. 2 Zwei Probleme: Informativer Gehalt und leere Ausdrücke 42
3. 3 Russells Kennzeichnungstheorie 45
3. 4 Lösung der Rätsel in Bezug auf Kennzeichnungen 46
3. 5 Russells Theorie der Eigennamen 49
3. 6 Einwände gegen Russell 52
4 Freges Theorie von Sinn und Bedeutung 55
4. 1 Bedeutung: Sinn und Bezug 55
4. 2 Sinn und das Problem des informativen Gehalts 58
4. 3 Sinn und das Problem leerer Ausdrücke 60
4. 4 Intensionale Kontexte 61
4. 5 Russell und Frege: Beschreibungstheorie der Eigennamen 63
4. 6 Offene Fragen 64
5 Grundzüge einer intensionalen Semantik 67
5. 1 Intension und Extension 67
5. 2 Noch einmal: Kommunikation und Wahrheitsbedingungen 70
5. 3 Intension, Menge von Welten, Proposition 72
5. 4 Verallgemeinerung des Ansatzes 73
5. 5 Einfache Sätze und Kompositionalität 77
5. 6 Zusammenfassung 78
6 Komplexe Sätze und Probleme der intensionalen Semantik 81
6. 1 Die Verbindung von Teilsätzen 81
6. 2 Glaubenszuschreibungen 83
6. 3 Modalaussagen 86
6. 4 Problem: Indexikalische Ausdrücke und Äußerungsbedingungen 87
6. 5 Problem: Modalaussagen mit Eigennamen 89
6. 6 Diagnose und Ausblick 90
7 Kausaltheorie der Bedeutung 93
7. 1 Die Starrheit von Eigennamen 95
7. 2 Weitere Argumente gegen die Beschreibungstheorie 99
7. 3 Konflikt mit der konventionalen Bedeutungstheorie 101
7. 4 Die Kausaltheorie der Bedeutung 104
7. 5 Die Starrheit von Artbegriffen 106
8 Externalismus und andere philosophisch interessante Konsequenzen 109
8. 1 Das Zwillingserde-Gedankenexperiment 110
8. 2 Die Methode der Begriffsanalyse 113
8. 3 Soziale Arten und sozialer Konstruktivismus 115
8. 4 Notwendigkeit und Apriorität 117
8. 5 Leib-Seele-Problem und Identitätsthese 120
8. 6 Zusammenfassung und Ausblick 123
9 Kontextabhängigkeit und zweidimensionale Semantik 125
9. 1 Indexikalische Ausdrücke und zwei Arten von Wahrheitsbedingungen 126
9. 2 Kaplans zweidimensionale Semantik 129
9. 3 Noch einmal: Ich bin hier 133
9. 4 Weitere Formen der Kontextabhängigkeit 135
9. 5 Zweidimensionale Beschreibungstheorie 137
9. 6 Zweidimensionale Kausaltheorie 140
9. 7 Grenzen des Ansatzes und Zusammenfassung 144
10 Wörtliche Bedeutung und Implikaturen 147
1 0. 1 Grice Theorie konversationeller Implikaturen 148
1 0. 2 In die Irre führen durch Implikaturen 152
1 0. 3 Ironie und Metapher 153
1 0. 4 Arten von Implikaturen und Präsuppositionen 155
1 0. 5 Probleme und Weiterentwicklungen 159
11 Sprechakte und Sprachgebrauch 163
1 1 . 1 Sprachhandlungen und Gebrauchstheorie 164
1 1 . 2 Grundzüge der klassischen Sprechakttheorie 165
1 1 . 3 Sprechakte und konventionale Bedeutungstheorie 170
1 1 . 4 Komplikationen: Danken, Grüßen, Fragen 174
1 1 . 5 Konvention vs. Intention 176
1 1 . 6 Sprache und gesellschaftliche Gefahren 179
Glossar 183
Literaturverzeichnis 191