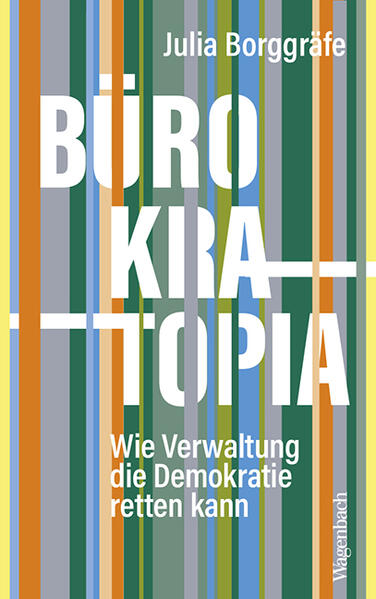Besprechung vom 22.04.2025
Besprechung vom 22.04.2025
Bürokratie, die Vertrauen schafft
Eine frühere Spitzenbeamtin legt dar, wie Verwaltungen in Deutschland bürgernäher organisiert werden können. Aus dem Dilemma aller Pläne zum Bürokratieabbau weist sie jedoch keinen Ausweg.
Mehr Bürokratie wagen", heißt es in einem Essay, der im Aprilheft des "Merkur" erschien. Ein Plädoyer "Wider den Bürokratieabbau" sendete kürzlich der Deutschlandfunk Kultur, die "Süddeutsche Zeitung" druckte ein "Lo b den Bürokraten". Und der Berliner Wagenbach-Verlag veröffentlicht in seinem Frühjahrsprogramm ein Buch der Juristin Julia Borggräfe mit dem Titel "Bürokratopia", das in seinem Untertitel nichts weniger als die Rettung der Demokratie ausgerechnet durch die Verwaltung verspricht. Darf man aus den genannten drei Beispielen schon auf einen neuen Trend schließen? Auf eine Gegenbewegung zu der sonst von allen Seiten und zu jeder Zeit erhobenen, weil stets populären Forderung nach dem Abbau der Bürokratie, dem sich schon die letzte Bundesregierung verschrieben hatte und der in den USA gerade mit der disruptiven Kettensäge betrieben wird.
Natürlich geschieht dies jenseits des Atlantiks wiederum mit einer eigens dafür geschaffenen Behörde, dem Department of Government Efficiency (DOGE). Denn dem Versuch des Bürokratierückbaus wohnt ein eigentümliches Paradox inne, das der Ethnologe David Graeber schon vor einem Jahrzehnt als "ehernes Gesetz des Liberalismus" formulierte: "Jede Regierungsinitiative, die den Amtsschimmel bändigen und die Marktkräfte fördern will, resultiert in der Zunahme von Vorschriften, Verwaltungsarbeit und der vom Staat beschäftigten Bürokraten."
Dem allgegenwärtigen Negativbild einer ineffizienten, übergriffigen und wenig bürgerfreundlichen Bürokratie setzt Julia Borggräfe in ihrem Buch den Utopieentwurf einer "bürgerorientierten, partizipativen, zukunftsgerichteten und effektiven" Verwaltung entgegen. Ihr dazu auf 140 Seiten ausgebreitetes Konzept lautet kurz gefasst und wenig überraschend: Die real existierenden Verwaltungen müssen wie Unternehmen werden.
Borggräfe selbst hat Erfahrungen in beiden Welten. Sie war vier Jahre lang Abteilungsleiterin im SPD-geführten Bundesarbeitsministerium. Zuvor arbeitete sie in den Personalabteilungen der Messe Berlin GmbH und der Daimler AG. 2022 wechselte Borggräfe als Ko-Geschäftsführerin in ein Beratungsunternehmen. Und wie das Produkt einer Beratung liest sich auch ihr Buch, bei dem man das Gefühl nicht loswird, es handele sich um die Verschriftlichung einer der berühmt-berüchtigten immer gleichen Powerpoint-Präsentationen, mit denen Consultingfirmen ihr Geld verdienen. Da fallen Schlagworte wie "Servant Leadership", "active sourcing", "Sprints", "User Journey", "Design Thinking", "strategic foresight", "Horizon Scanning", "wicked problems", "Futures Literacy" und nicht zu vergessen der vielfach anzutreffende Begriff "proaktiv".
Man ahnt schnell, in welches Wunderland die Reise unter Mitnahme der vielen schönen, vermeintlich progressiven, weil englischen Begriffe im Gepäck hingehen soll. Dabei beweist Borggräfe ein historisches und gegenwärtiges Problembewusstsein, erinnert an die verhängnisvolle Rolle der Bürokratie im Nationalsozialismus und bei der Transformation im Osten Deutschlands nach 1990 und verschweigt nicht den aktuellen Zustand der deutschen Verwaltung: "starre Strukturen, bürokratische Prozesse, oft langjährige Hierarchien" und "routinemäßiger 'Dienst nach Vorschrift'".
Als Beispiele für die Resultate einer antiquierten deutschen Verwaltungskultur führt sie an, dass von den fünf Milliarden Euro für den Digitalpakt Schule wegen des komplizierten Antragsverfahrens weniger als die Hälfte abgerufen worden sei und dass die Entwicklung eines digitalen Antragsverfahrens für das Wohngeld sieben Jahre in Anspruch genommen habe. Was es braucht, ist ein Kulturwandel, den Borggräfe einfordert, auch wenn das Wort bei ihr nicht fällt. Auf den langen Fluren deutscher Verwaltungsgebäude weht oft noch immer ein preußischer Geist, und dessen Beharrungskräfte sind gewaltig. Schon 1942 urteilte der deutsche Politikwissenschaftler Franz Neumann über die "extrem ehrgeizigen" deutschen Beamten: "Ihr großes Streben ist zu bleiben, wo sie sind, oder genauer: so rasch wie möglich befördert zu werden." Borggräfe erinnert daran, dass die Schweiz den Beamtenstatus 2002 abgeschafft hat, fordert eine systematische Förderung verwaltungsinterner kritischer Reflexion, eine bürgernahe Verwaltungssprache und eine stärkere Dienstleistungsorientierung an deren Bedürfnissen.
Doch am Ende landet man wieder bei Graebers Gesetz aus seinem 2015/16 erschienenen, bis heute ungemein anregenden Buch "Bürokratie. Die Utopie der Regeln", wonach die Verwaltung unter den Bedingungen der komplexen kapitalistischen Gesellschaft letztlich immer vergrößert, wer sie effizienter machen will. Auch Borggräfe schlägt die Schaffung zahlreicher neuer Gremien nach dem Vorbild anderer Länder vor: Kompetenz- und Servicecenter für die Personalauswahl auf Bund- und Länderebene, um dem Personalmangel zu begegnen; einen Ausbau der Personalentwicklung, um die Verwaltung als Arbeitgeber attraktiver zu machen; eine neue strategische Arbeitseinheit für Digital- und Zukunftsthemen auf Bundesebene und eine weitere Umsetzungseinheit für Fragen der digitalen Transformation oder ein "Committee for the Future", wie es in Finnland schon lange eines gibt. Dabei erinnert Borggräfes Buch an viele schon existierende Behörden hierzulande, von denen der gemeine Zeitungsleser vielleicht bislang nichts ahnte. Denn wer kennt schon die "Bundesakademie für öffentliche Verwaltung" (BAköV) oder das "Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr" (BAPersBw). Es wurde 2012 nach dem Ende der Wehrpflicht gegründet, hat etwa 3000 Mitarbeiter und soll vor allem der Gewinnung von Personal für die Freiwilligenarmee dienen.
Warum Borggräfes Befunde nicht nur ein Problem für die bürokratischen Institutionen dieses Landes sind, macht sie in ihrer zentralen These klar. Denn Verwaltungen stellen im Unterschied zu den Unternehmen "eine essenzielle Säule des demokratischen Staatssystems" dar. Die Bürger begegnen ihrem Staat fast täglich auf der Ebene einer seiner Behörden. Wenn sie die von ihren Steuergeldern finanzierte Verwaltung als dysfunktional wahrnehmen, überträgt sich diese Einschätzung schnell auch auf Staat und demokratisches System. Der Autorin zufolge sollten die Beamten und Angestellten ihre potentiell demokratiestabilisierende Rolle viel selbstbewusster nach außen vertreten, gerade auch gegenüber der Politik. Denn die Verwaltung kann "ein echter Resilienzfaktor in Krisenzeiten" sein. Sie könne helfen, das Bildungssystem langfristig zu verbessern und die Folgen von Klimakrise und demographischem Wandel zu bewältigen. Damit ist die Anschlussfähigkeit der Neuerscheinung an alle laufenden Diskurse sichergestellt. RENÉ SCHLOTT
Julia Borggräfe: Bürokratopia. Wie Verwaltung die Demokratie retten kann.
Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2025, 144 S.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.