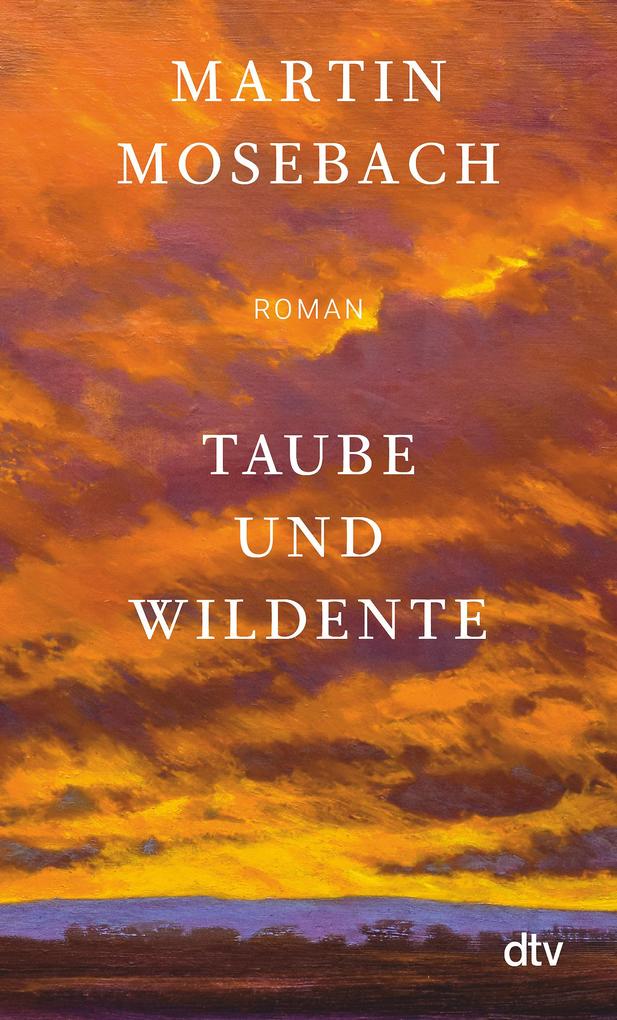
Zustellung: Mo, 04.08. - Mi, 06.08.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Sprachgewaltig, bildstark, stimmungsvoll: Martin Mosebach erzählt in diesem Roman einer Ehe, der zugleich der Roman eines Gemäldes ist, von Schuld und Versöhnung, Liebe und Verlust.
»Ein vollendet ausgeführtes Romangemälde. « Literarische Welt
Wie jedes Jahr verbringt die Familie Dalandt den Sommer in der Provence. Die Hitze macht träge, in der Zypresse zirpen Zikaden, und jeden Morgen läuft die Hausherrin im Nachthemd durch den Garten zum Pförtnerhaus, wo der Verwalter sie erwartet. Ihr Mann ist durch eine eigene verhängnisvolle Beziehung abgelenkt. Da entzündet sich ein Ehestreit an 'Taube und Wildente', einem Stillleben aus dem 19. Jahrhundert. Was hat es mit dem zinnoberroten Punkt in seinem Zentrum auf sich, macht der es nicht zu einem modernen Meisterwerk? Aber die Frau will es verkaufen, die Spannung zwischen beiden wächst. Martin Mosebach, der menschliche Schwächen schildert wie kein zweiter, malt mit Wörtern. Ein flammender Roman über Kunst, Liebe und Verrat.
Über den Abgrund in einer Ehe und einen Fehltritt mit Folgen, über Schönheit, Verdammnis und Verlust - virtuos und fesselnd erzählt von einem der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftsteller der Gegenwart.
»Ein unerhörtes Stück Literatur über Liebe, Kunst und Verrat samt glorioser Pointe. « Tobias Haberl, Süddeutsche Zeitung
»Provence, ein altes Landhaus, das uralte Drama des Menschlichen, ein stilistischer Lesegenuss von hohem Rang. « Iris Radisch. Die Zeit
Produktdetails
Erscheinungsdatum
15. Februar 2024
Sprache
deutsch
Untertitel
Roman | 'Ein unerhörtes Stück Literatur über Liebe, Kunst und Verrat samt glorioser Pointe. ' Tobias Haberl, Süddeutsche Zeitung.
1. Auflage.
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
336
Autor/Autorin
Martin Mosebach
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
260 g
Größe (L/B/H)
190/115/26 mm
ISBN
9783423148894
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Himmel und Hölle, Leben und Kunst, Liebe und Ehe, Ethik und Ästhetik, Totem und Tabu: Der raffinierte Erzähler Mosebach weist in seinem Roman den Weg in eine andere Moderne. Richard Kämmerlings, Die Welt, Literarische Welt
Martin Mosebach schildert die von Schuld, Sünde und Laster durchwirkten Geschehnisse mit feinster psychologischer Beobachtungsgabe, die die Dualität zwischen Verborgenem und Offengelegtem, zwischen individuellem Gewissen undgeteilten Konventionen (. . .) sorgsam nachzeichnet. (. . .) ein ungeheures ästhetisches Vergnügen. Sibylle Anderl, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Ein Sommer auf dem Lande und gefährliche Liebschaften. Nie war Mosebach so frivol und so spannnd. Ulrich Greiner, Die Zeit
Provence, ein altes Landhaus, das uralte Drama des Menschlichen, ein stilistischer Lesegenuss von hohem Rang. Iris Radisch, Die Zeit
Taube und Wildente ist ein raffinierter Gesellschaftsroman und zugleich ein Buch, das darüber reflektiert, wie sich schale oder grausame Wirklichkeit zur Kunst sublimiert. (. . .) Mit ihrer Schattierungskunst ist Mosebachs Sprache ein Instrumentarium, das gerade widrige Eindrücke vermittelt. Wolfgang Schneider, Der Tagesspiegel
Ein großer Niedergangsroman. (. . .) Wie einst bei Thomas Mann reicht auch bei Mosebach der Verfall weit über die Familie hinaus, und seine Sprache nimmt den Leser beinahe ähnlich gefangen wie die des Großmeisters aus Lübeck. Peter Mohr, Abendzeitung (München)
In einer hypnotischen, kunstvollen Komposition porträtiert der Frankfurter Schriftsteller eine Gesellschaft und Zeit, die im permanenten Reizzustand lebt. (. . .) ein stilistisches Glanzstück. Bernd Melichar, Kleine Zeitung
Ein raffiniert gebautes Erzählgebäude, das man bis in die hintersten Winkel erkunden will. Eine meisterliche Milieustudie: sprachmächtig, subtil und voller Spott. Pia Reinacher, Die Weltwoche
Martin Mosebach ist mit Taube und Wildente ein tröstliches, elegantes, sehr unterhaltsames Buch gelungen, eines, das Wärme und Genauigkeit bietet. Einer der lässigsten Romane des Büchnerpreis-Trägers überhaupt. Alexander Wasner, SWR 2 Kaffee oder Tee
Mosebach hat sich auf den Verfall spezialisiert, auf moralisch Anrüchiges, auf bürgerliche Dekadenz. Das aber geschieht stets in einer kostbaren Sprache und in ausgewählter Kulisse, mit Sinn für erlesene Details und guten Geschmack. Jörg Magenau, rbb Radio 3
Martin Mosebach lässt in Taube und Wildente Feuer und Wasser über ein unerwartet robustes Bürgertum niedergehen. (. . .) Das Aufflackern von Leidenschaft wird subtil variiert. Judith von Sternburg, Frankfurter Rundschau
Menschen, die in ihrer sinnlichen Präsenz so betörend wie lächerlich und abstoßend zugleich sind (. . .). Ein bisschen Tschechow steckt in ihnen allen. Das macht diesen mit wahrer Meisterschaft verfassten Roman so lesens- und erlebenswert. Sabine Dultz, Münchner Merkur
Martin Mosebach schildert die von Schuld, Sünde und Laster durchwirkten Geschehnisse mit feinster psychologischer Beobachtungsgabe, die die Dualität zwischen Verborgenem und Offengelegtem, zwischen individuellem Gewissen undgeteilten Konventionen (. . .) sorgsam nachzeichnet. (. . .) ein ungeheures ästhetisches Vergnügen. Sibylle Anderl, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Ein Sommer auf dem Lande und gefährliche Liebschaften. Nie war Mosebach so frivol und so spannnd. Ulrich Greiner, Die Zeit
Provence, ein altes Landhaus, das uralte Drama des Menschlichen, ein stilistischer Lesegenuss von hohem Rang. Iris Radisch, Die Zeit
Taube und Wildente ist ein raffinierter Gesellschaftsroman und zugleich ein Buch, das darüber reflektiert, wie sich schale oder grausame Wirklichkeit zur Kunst sublimiert. (. . .) Mit ihrer Schattierungskunst ist Mosebachs Sprache ein Instrumentarium, das gerade widrige Eindrücke vermittelt. Wolfgang Schneider, Der Tagesspiegel
Ein großer Niedergangsroman. (. . .) Wie einst bei Thomas Mann reicht auch bei Mosebach der Verfall weit über die Familie hinaus, und seine Sprache nimmt den Leser beinahe ähnlich gefangen wie die des Großmeisters aus Lübeck. Peter Mohr, Abendzeitung (München)
In einer hypnotischen, kunstvollen Komposition porträtiert der Frankfurter Schriftsteller eine Gesellschaft und Zeit, die im permanenten Reizzustand lebt. (. . .) ein stilistisches Glanzstück. Bernd Melichar, Kleine Zeitung
Ein raffiniert gebautes Erzählgebäude, das man bis in die hintersten Winkel erkunden will. Eine meisterliche Milieustudie: sprachmächtig, subtil und voller Spott. Pia Reinacher, Die Weltwoche
Martin Mosebach ist mit Taube und Wildente ein tröstliches, elegantes, sehr unterhaltsames Buch gelungen, eines, das Wärme und Genauigkeit bietet. Einer der lässigsten Romane des Büchnerpreis-Trägers überhaupt. Alexander Wasner, SWR 2 Kaffee oder Tee
Mosebach hat sich auf den Verfall spezialisiert, auf moralisch Anrüchiges, auf bürgerliche Dekadenz. Das aber geschieht stets in einer kostbaren Sprache und in ausgewählter Kulisse, mit Sinn für erlesene Details und guten Geschmack. Jörg Magenau, rbb Radio 3
Martin Mosebach lässt in Taube und Wildente Feuer und Wasser über ein unerwartet robustes Bürgertum niedergehen. (. . .) Das Aufflackern von Leidenschaft wird subtil variiert. Judith von Sternburg, Frankfurter Rundschau
Menschen, die in ihrer sinnlichen Präsenz so betörend wie lächerlich und abstoßend zugleich sind (. . .). Ein bisschen Tschechow steckt in ihnen allen. Das macht diesen mit wahrer Meisterschaft verfassten Roman so lesens- und erlebenswert. Sabine Dultz, Münchner Merkur
 Besprechung vom 11.06.2025
Besprechung vom 11.06.2025
So ein Roman, der fällt doch nicht vom Himmel
Auf klassischen Spuren zeichnet der Vogelflug im Atelierfenster die immanente Poetik des Buches vor: Wort und Bild, Mimesis und Täuschung in Martin Mosebachs "Die Richtige".
Schon in Martin Mosebachs zweitjüngstem Roman spielte ein Gemälde eine gewichtige Rolle, die Objekte des Wildstilllebens von Otto Scholderer firmieren sogar im Titel: "Taube und Wildente" (siehe Geisteswissenschaften vom 26. Oktober 2022). In "Die Richtige", Mosebachs neuem Roman , ist nun sogar der Protagonist ein Künstler namens Louis Creutz. Auch hier tauchen Vögel in Verbindung mit Malerei auf, allerdings in anderer Weise.
Während Creutz weibliche Akte nach Modellen malt, geben sich in seinem Atelier zwei Vögel einem possierlichen Spiel hin, das zu Beginn des Romans ausführlich beschrieben wird. Ein Vogel fliegt ins Atelier, der andere bleibt draußen: Durch das Fensterglas voneinander getrennt, betrachten sie einander, picken mit den Schnäbeln nach dem anderen, lassen ihre Flügel wild flattern und versuchen, "in der Luft zu stehen und zugleich die kleinen Brüste aneinanderzudrängen, was sie niemals taten, wie der Maler zu beobachten meinte, wenn sie ohne das durchsichtige Hindernis zusammen waren". Creutz ist fasziniert von dieser "geradezu mit dem Menschen konkurrierenden Aberration: die hinter Glas unerreichbare Erscheinung des anderen für reizvoller und anziehender zu halten als den unverstellten Zugang zu ihm. 'Man kann nicht gleich behaupten, die Vögel hätten die Malerei entdeckt, aber die Wirkung, die sie auf manche ausüben kann, die kennen sie auch.'"
Eine berühmte antike Künstlerlegende bemüht Vögel, um die Wirkung mimetischer Kunst zu illustrieren: Im Wettbewerb mit Parrhasios malte Zeuxis Weintrauben, die so echt aussahen, dass Vögel versuchten, sie aufzupicken. Parrhasios wiederum gab einen Vorhang so realistisch wieder, dass Zeuxis, noch stolz über den Erfolg seiner Vogeldarstellung, ihn aufziehen wollte. Als er seine Täuschung bemerkte, konzedierte er Parrhasios den Sieg: Während er selbst Vögel getäuscht habe, sei es diesem gelungen, ihn, einen Künstler, hinters Licht zu führen.
Mosebach lässt nicht nur die Vögel mit den bildbetrachtenden Menschen "konkurrieren", er tritt mit der Anfangsvignette seines Romans auch selbst in einen Agon mit der antiken Anekdote ein. Auch er zieht Vögel heran, um über Malerei zu reflektieren, aber statt sich täuschen zu lassen, delektieren sich seine Vögel am "Als-ob", das der bildlichen Darstellung zugrunde liegt: So wie es auf "manche" einen besonderen Reiz ausübt, in einem Bild etwas zu sehen, was nicht da ist, ergötzen sich die Vögel daran, etwas unmittelbar vor sich zu sehen, ohne es berühren zu können.
Diese Rekonfiguration der Vögel als nicht mehr naiver, sondern bewusster Bildbetrachter am Anfang von "Die Richtige" ist programmatisch für die bildtheoretischen Reflexionen, die sich wie ein Faden durch den Roman ziehen. Nutzte Mosebach in "Taube und Wildente" Scholderers Bild vor allem dazu, die akademische Tradition der modernen Malerei gegenüberzustellen, betritt er in "Die Richtige" das Spannungsfeld von Mimesis und Täuschung.
Creutz gelingt es, die junge, schöne Astrid mit dem geschäftlich sehr erfolgreichen, aber ebenso langweiligen wie unansehnlichen Dietrich zu verkuppeln. Nun kann er Astrid zu seinem Modell und seiner Geliebten machen, ohne die Gefahr einer festen Bindung fürchten zu müssen. So souverän Creutz sein Vorhaben ins Werk setzt, Astrid entzieht sich ihm, bevor er sein Bild von ihr beendet hat. Voller Zorn übermalt er das Bild und versetzt "der Leinwand Pinselhiebe, als treffe er damit den mit solcher Inbrunst beschworenen Körper". Der Galerist von Creutz erhascht einen Blick auf das malträtierte Bild und überredet ihn, es in Paris auszustellen - mit gewaltigem Erfolg. Ein Kritiker jubelt, Creutz habe "sein germanisches Korsett abgeworfen, den elitären peinture-Kult, den zynischen érotisme, die verdrossene Eitelkeit auf ein souverän exerziertes Handwerk. Er hat die Tyrannei der Mimesis gesprengt, er läßt sich nicht mehr vom Modell versklaven."
Die bitterböse Satire auf eine theoretisch verbrämte, aber inkompetente Kunstkritik ist nicht zuletzt durch den Widerspruch zu den eigenen Aussagen von Creutz markiert. Für ihn "zählt allein das Bild und nicht das Modell. Meine Täuschungen beim Studium des Modells sind Maßstab. Ich will mein Modell so malen, daß die Begegnung mit dem realen Modell eine gewissen Enttäuschung auslöst." Creutz ist weit davon entfernt, ein Sklave seines Modells zu sein; keineswegs strebt er nach einer mimetischen Wiedergabe der Welt. Er will eine eigene Wahrheit schaffen, die nicht im Besonderen, sondern im Allgemeinen liegt.
Ebenso wie das Konzept der Mimesis geht der Wettkampf zwischen Bild und Wort auf die Antike zurück. Vor allem kaiserzeitliche Autoren wägen oft spielerisch das mimetische Vermögen bildlicher und sprachlicher Darstellungen gegeneinander ab. Lukian im zweiten Jahrhundert nach Christus beispielsweise lässt in einem seiner Texte zuerst einen Redner auftreten, der betont, wahrer Kunstgenuss erfordere eine sprachliche Reaktion auf das Gesehene. Dann widerspricht ein zweiter Redner, Bilder seien Reden überlegen. Allerdings belegt er seine These mit Bildbeschreibungen, welche in einem performativen Widerspruch die Macht des Wortes vorführen. Besondere Beliebtheit sollte sich der Paragone, der Wettstreit zwischen Bild und Wort, in der Renaissance erfreuen, bevor er in Lessings "Laokoon" einen Höhepunkt erreichte.
Auch in "Die Richtige" zeichnet sich die Kontur des Paragone ab. Creutz malt nicht nur, er schreibt auch, neben Nachrichten an sein Modell auch in einem "elektronischen Tagebuch". Doch was er dort notiert, "geriet ihm nach seinem Geschmack immer zu kurz; er kam sich dann vor wie ein Vogel, der die Flügel ausbreitet, aber nicht fliegt." Wieder erscheinen Vögel in einer Reflexion über Darstellung, dieses Mal jedoch über eine sprachliche: Creutz sieht im Spiel der Vögel in seinem Atelier einen Spiegel für die Wirkung seiner Bilder, seine Notate kommen jedoch anders als Vögel nicht vom Boden.
Zu dieser impliziten Gegenüberstellung von Bild und Wort passen die Ähnlichkeiten, welche die ersten Rezensionen zwischen Creutz und Mosebach erkannt haben. Creutz nimmt im Roman die Position eines internen Autors ein, der das Geschehen dirigiert, bis sich Astrid ihm verweigert. Beide betrachten ihre Objekte mit Kälte, ebenso wie Mosebach hat sein Held einen gnadenlosen Blick für menschliche Schwächen und versteht sich diese zunutze zu machen. Wenn Andreas Platthaus treffend feststellt "Bei Creutz schaudert uns dabei vor Abscheu, bei Mosebach vor Wonne" (F.A.Z. vom 15. März), bewegt er sich auf einem Terrain, das schon Aristoteles vermessen hat. In der Poetik findet sich die Beobachtung, was uns in der Wirklichkeit Kummer bereite, könne uns in der Darstellung erfreuen.
Mosebach wird zu Recht für seine rhetorisch vollendeten und zugleich anschaulichen Beschreibungen gerühmt. Trotzdem wäre es wohlfeil, ihn zum Sieger im Paragone mit seinem Helden zu küren. Eher gewinnt sein ästhetisches Programm an Schärfe vor dem Hintergrund der Kommentare von Creutz über sein Schaffen. Auf der einen Seite spiegelt Creutz' Ablehnung einer einfachen Wiedergabe der Wirklichkeit Mosebachs Selbstverständnis. In seinem Essay "Wer einen Roman schreibt - sollte der wissen, was ein Roman ist?" erklärt Mosebach Erich Auerbach, den Autor von "Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur", zu seinem Romantheoretiker, erteilt aber dem Realismus eine Absage. Seine Sympathien gehören dem Naturalismus, der, so Mosebachs Definition, "seinem tiefsten Antrieb entsprechend, darstellen will, was nicht da sein sollte, empörenderweise aber dennoch da ist, um die Leser zum Aufstand gegen das existierende Böse zu ermutigen - und der Verdacht bleibt: Alles Daseiende ist böse." Diese moralische Dimension tritt in "Die Richtige" mit besonderer Deutlichkeit hervor.
Auf der anderen Seite kommt in den Vögeln, die sich durch die Fensterscheibe betrachten, ein anderes Kunstverständnis zum Ausdruck als in Creutz' Verabsolutierung seines Schaffens. Für Creutz entsteht "die einzige Wirklichkeit, die zählt, [...] aus meinen Täuschungen". Skrupellos nimmt er den Ruin seiner Modelle in Kauf, um seine Werke malen zu können. In Mosebachs Vignette der Vögel als Bildbetrachter ist hingegen das "Als-ob" die Quelle des Kunstgenusses. Die Kunst verdrängt nicht die Wirklichkeit, sondern gewinnt ihren besonderen Reiz dann, wenn sie als der Wirklichkeit ähnliche Nichtwirklichkeit erkannt wird. Vom Ästhetizismus, für den Mosebach bisweilen gescholten wird, ist die in seinem neuen Roman eingebettete Poetik weit entfernt. JONAS GRETHLEIN
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 16.12.2024
Große Literatur über verwickelte Liebesbeziehungen, Brüche in der Kunstgeschichte und mediterrane Landschaft. Sprachlich auf einsamem Niveau
LovelyBooks-Bewertung am 20.07.2024
Altmodische Sprache. Sehr gute Beobachtungsgabe. Dekadente, dysfunktionale Familie ohne jegliche Selbstreflektion. Tierfeindlich. Abgebr.









