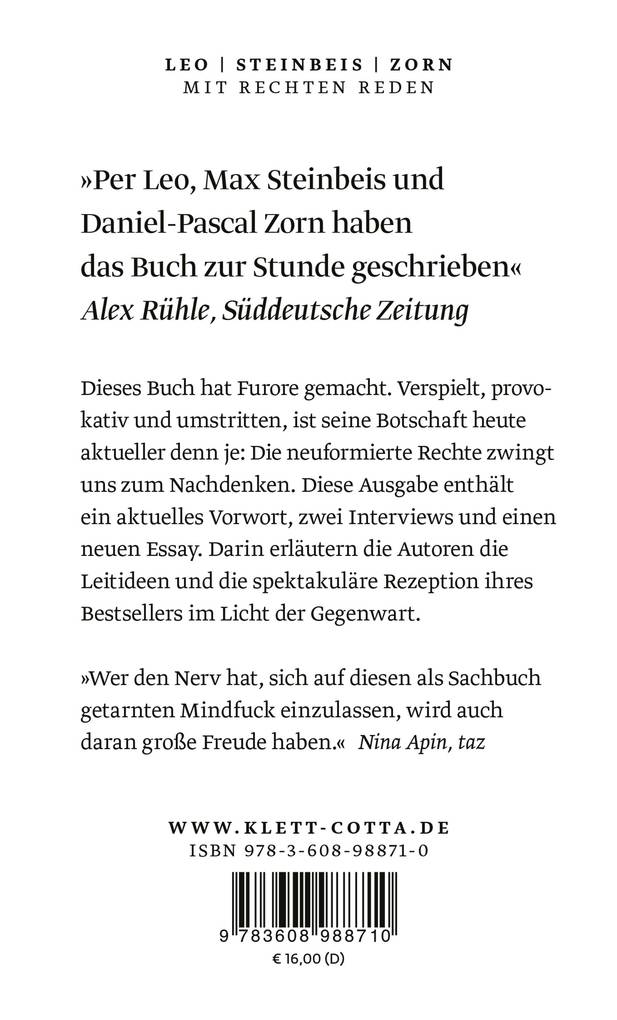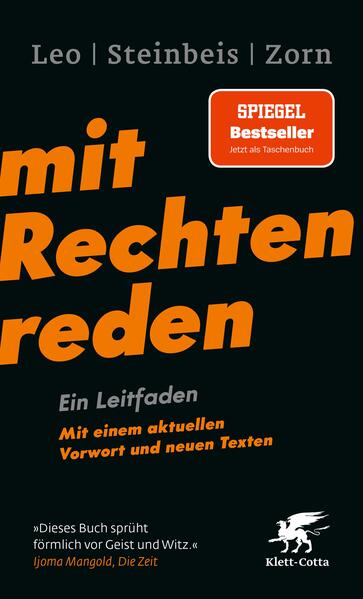
Zustellung: Fr, 16.05. - Mo, 19.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Das vieldiskutierte Buch zum Umgang mit den Rechten
Die Autoren haben mit ihren Thesen vielfältige Debatten ausgelöst - viel dringlicher noch stellt sich uns heute die Frage, wie wir mit Rechtspopulisten und der Neuen Rechten umgehen müssen. Das Taschenbuch bietet ein zusätzliches Vorwort, einen neuen Essay und zwei Interviews, welche die vielfach besprochenen Leitideen und die breite Rezeption des Bestsellers einordnen und erklären. Mit Rechten reden heißt nicht nur, mit Rechthabern streiten. Sondern auch mit Gegnern, die Rechte haben. Und mit Linken.
Demokratie ist kein Salon. Die Republik lebt vom Streit, von Rede und Gegenrede, nicht nur von Bekenntnissen und moralischer Zensur. Dieser Leitfaden zeigt, dass es in der Auseinandersetzung mit Rechtspopulismus und Neuen Rechten um mehr geht als die Macht des besseren Arguments. Es geht vor allem um die Kunst, weniger schlecht zu streiten. Per Leo, Max Steinbeis und Daniel-Pascal Zorn sagen nicht, wie man mit Rechten reden muss. Sie führen vor, warum, wie und und worüber sie selbst mit Rechten reden. Und sie denken über das Reden mit Rechten nach. Mal analytisch, mal literarisch. Teils logisch, teils mythologisch. Hier polemisch, dort selbstironisch.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
11. Januar 2025
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage 2025
Ausgabe
Ungekürzt
Seitenanzahl
245
Autor/Autorin
Per Leo, Maximilian Steinbeis, Daniel-Pascal Zorn
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
178 g
Größe (L/B/H)
187/112/18 mm
ISBN
9783608988710
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Die Jongen-Affäre liefert ein Musterbeispiel für den Automatismus missglückender öffentlicher Kommunikation, mit dessen Analyse Per Leo, Maximilian Steinbeis und Daniel-Pascal Zorn in ihrem vieldiskutierten Buch Mit Rechten reden einsetzen. Vertreter von Positionen des rechten Randes verstehen und inszenieren sich als Opfer herrschender Meinungsmacht. Leo, Steinbeis und Zorn halten eine Boykottstrategie von Gatekeepern öffentlicher Foren für kontraproduktiv: Sie beglaubigt die Opferpose. «Patrick Bahners, FAZ, 08. 11. 2017 Patrick Bahners, FAZ
»Dieses Buch sprüht förmlich vor Geist und Witz. Was nicht ganz unwichtig ist, denn während die Öffentlichkeit lange überzeugt war, dass am rechten Rand nur Analphabeten zugange seien, haben die rechten Echokammern längst ihren eigenen Esprit (eher von Sarkasmus als von Ironie beseelt) entwickelt. . . . Es gibt keinen herrlicheren Triumph für die Rechte, als wenn sich die Linke genau so verhält, wie es dem Feindbild der Rechten entspricht. Leider hat die Wirklichkeit nicht lange gezögert, diese zentrale These von Mit Rechten reden eindrucksvoll zu illustrieren. «Die Zeit, Ijoma Mangold, 19. 10. 2017 Ijoma Mangold, Die Zeit
»[D]as wohl meistdiskutierte Buch der diesjährigen Messe . . . Die Veranstaltung [des Antaios-Verlags] war ein derart beeindruckender Beleg für die Richtigkeit dieser These, dass man meinen könnte, Leo, Steinbeis und Zorn hätten sich das anschwellende Spektakel als performativen Beleg ihrer Buchthesen ausgedacht. «Süddeutsche Zeitung, Alex Rühle, 15. 10. 2017 Alex Rühle, Süddeutsche Zeitung
»Maximal mögliche Gelassenheit, so könnte man einen Grundgedanken des Buch zusammenfassen, ist womöglich die einzige Strategie, mit der man die Fallen der Neuen Rechten umgehen kann. . . . Wie man es macht, dieses Spiel [der Rechten] zu verweigern, ohne als Spielverderber zu gelten, beweisen Leo, Steinbeis und Zorn in ihrem Buch auch performativ: In einem fast schon heiteren Ton signalisieren sie, wie wenig sie selbst mit der hilflosen Entrüstung zu tun haben wollen, mit der große Teile der Öffentlichkeit artig das Geschäft der Provokateure betreiben. «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Harald Staun, 15. 10. 2017 Harald Staun, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
»Leo, Steinbeis und Zorn sagen nicht, wie man mit Rechten reden muss. Sie führen vor, warum, wie und worüber sie selbst mit Rechten reden. Und sie denken über das Reden mit Rechten nach. Mal analytisch, mal literarisch. Teils logisch, teils mythologisch, polemisch oder selbstironisch. « Nachrichten Kaiserslautern, 25. Januar 2024 Nachrichten Kaiserslautern
»In ihrem auf der Frankfurter Buchmesse breit diskutierten Buch "Mit Rechten reden" haben die Autoren Maximilian Steinbeis, Per Leo und Daniel-Pascal Zorn viele bedenkenswerte Anregungen versammelt, wie ein inhaltlich fundierter Dialog als offenes Gespräch gestaltet werden kann. «Felix Müller, Berliner Morgenpost, 12. 03. 2018 Felix Müller, Berliner Morgenpost
»Per Leo, Maximilian Steinbeis und Daniel Pascal-Zorn definieren ungewöhnlich , argumentieren schlau und liefern dennoch keinen Ratgeber für den Umgang mit eben jenen Menschen, die sich rechts nennen oder sich für rechts halten, die sich aber ohne ihren linken Gegenpart in der Regel gar nicht selbst grenzscharf einsortieren können. «Goslarsche Zeitung, 29. 11. 2017 Goslarsche Zeitung
»Ein kluges, faires, freies Buch. «Christian Eger, Mitteldeutsche Zeitung, 26. 10. 2017 Christian Eger, Mitteldeutsche Zeitung
»Auch ohne den Eklat auf der Buchmesse wäre die gerade erschienene Streitschrift Mit Rechten reden das Buch der Stunde. Oder zumindest ein Buch, das man allen empfehlen sollte, die besser verstehen wollen, wieso die öffentliche Debatte über den Umgang mit der Neuen Rechten schnell so verfahren wird. Jetzt . . . wirkt der Eklat fast wie eine Bestätigung der Thesen, die Per Leo, Maximilian Steinbeis und Daniel-Pascal Zorn . . . entwickeln. «Allgemeine Zeitung, Johanna Dupré, 18. 10. 2017 Johanna Dupré, Allgemeine Zeitung Mainz
»In der Diagnose enthüllt «Mit Rechten reden» wenig Neues. Erfrischend dagegen ist der Ansatz, die Mängel der Debattenkultur in einen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang zu spannen: Nicht du hast das Problem mit mir. Wir beide haben eines, aneinander und miteinander. Da wir politisch aufeinander angewiesen sind, können wir uns weder einfach ausgrenzen noch ignorieren. So ironisch ab- und aufgeklärt ihr Tonfall bisweilen ist, so ernst scheint den drei Autoren das Anliegen, den ausgetretenen Kampfplatz neu zu beleben, die Moral zugunsten von mehr Logik über Bord zu werfen und wieder zuzuhören. Dann können aus Feinden wieder Gegner werden. «Neue Zürcher Zeitung, Tobias Sedlmaier, 17. 10. 2017 Tobias Sedlmaier, Neue Zürcher Zeitung
»Dieses Buch gibt uns einiges zum Grübeln auf, denn es stellt die Frage, wohin wir mit unserer großen Erzählung, unserem Habitus, unserem Ansatz wollen. [. . .] Unser Mythos sei der vom »ewigen, unerlösten Opfer«, und darum könne, »wer nicht mit ihnen leidet, nur gegen sie sein. Aggressive Jammerlappen sind sie. Wehleidige Arschlöcher. Unerlöste, tatbereite Opfer. « Das ist starker Tobak, das ist ein Frontalangriff, und zwar ein sauber ausgearbeiteter [. . .]. «Götz Kubitschek, Sezession, 16. 10. 2017 Götz Kubitschek, Sezession
»2017 erschienen mehrere Bücher aus dem linksliberalen Milieu, die dazu auffordern, sich mit Faschisten zu unterhalten, weil man angeblich etwas von ihnen lernen könnte. Aber was? Besonders brutale Promotion? Das intelligenteste dieser Bücher stammt von Per Leo, Maximilian Steinbeis und Daniel-Pascal Zorn, es heißt »mit Rechten reden« und zeigt sehr gut, dass die Rechten außer dunkel dräuenden Gefühlen nicht viel zu bieten haben, aber das immer erfolgreicher. «Junge Welt, Christof Meueler/Peter Merg, 16. 10. 2017 Christof Meueler, Junge Welt
»Der analytische Gewinn des Buches liegt dabei vor allem im überzeugenden Nachweis darüber, wie sich die rechte Rhetorik erfolgreich aus der eigenen Verantwortung stiehlt. . . . Man muss den Optimismus der drei Autoren nicht teilen, um ihre Einladung an alle Rechten und Nichtrechten zu einem anderen Sprachspiel, einem konstruktiven Dialog nachdrücklich zu begrüßen. It s on! «Deutschlandfunk Kultur, Simone Rosa Miller, 16. 10. 2017 Simone Rosa Miller, Deutschlandfunk Kultur
»Wer den Nerv hat sich auf diesen als Sachbuch getarnten Mindfuck einzulassen, wird auch daran große Freude haben. «taz, Nina Apin, 10. 10. 2017 Nina Apin, taz
»Das ist großes Theater, vielleicht auch Stoff für einen Film, den Christoph Schlingensief vom Olymp herab realisieren könnte, das Wiedereintreten situationistischen Denkens in die verarmte und ausgedörrte Arena des politischen Redens unserer Zeit. (. . .) Wer in der beginnenden Legislaturperiode sich auf dieses Spiel einließe und unter der Regie des nächsten Bundestagspräsidenten Debatten führen wollte, die den prästabilierten Totentanz des Behauptungsredens endlich hinter sich ließen und dem politischen Prozess die Würde des Enttäuschens zurückgäben, kommt nicht darum herum, besonders dieses Kapitel sehr aufmerksam zu lesen. Alles hat seine Zeit. Dieses Buch gilt unserer. «Der Freitag, Hans Hütt, 05. 10. 2017 Hans Hütt, der Freitag
»Das so meinungsfreudige wie sprachgewitzte Buch will kein Ratgeber sein, versteht sich aber als Leitfaden für Situationen kommunikativer Zuspitzung in den Sozialen Medien oder beim Smalltalk. «Tagesspiegel, Christian Schröder, 22. 09. 2017 Christian Schröder, Tagesspiegel
»Dieses Buch sprüht förmlich vor Geist und Witz. Was nicht ganz unwichtig ist, denn während die Öffentlichkeit lange überzeugt war, dass am rechten Rand nur Analphabeten zugange seien, haben die rechten Echokammern längst ihren eigenen Esprit (eher von Sarkasmus als von Ironie beseelt) entwickelt. . . . Es gibt keinen herrlicheren Triumph für die Rechte, als wenn sich die Linke genau so verhält, wie es dem Feindbild der Rechten entspricht. Leider hat die Wirklichkeit nicht lange gezögert, diese zentrale These von Mit Rechten reden eindrucksvoll zu illustrieren. «Die Zeit, Ijoma Mangold, 19. 10. 2017 Ijoma Mangold, Die Zeit
»[D]as wohl meistdiskutierte Buch der diesjährigen Messe . . . Die Veranstaltung [des Antaios-Verlags] war ein derart beeindruckender Beleg für die Richtigkeit dieser These, dass man meinen könnte, Leo, Steinbeis und Zorn hätten sich das anschwellende Spektakel als performativen Beleg ihrer Buchthesen ausgedacht. «Süddeutsche Zeitung, Alex Rühle, 15. 10. 2017 Alex Rühle, Süddeutsche Zeitung
»Maximal mögliche Gelassenheit, so könnte man einen Grundgedanken des Buch zusammenfassen, ist womöglich die einzige Strategie, mit der man die Fallen der Neuen Rechten umgehen kann. . . . Wie man es macht, dieses Spiel [der Rechten] zu verweigern, ohne als Spielverderber zu gelten, beweisen Leo, Steinbeis und Zorn in ihrem Buch auch performativ: In einem fast schon heiteren Ton signalisieren sie, wie wenig sie selbst mit der hilflosen Entrüstung zu tun haben wollen, mit der große Teile der Öffentlichkeit artig das Geschäft der Provokateure betreiben. «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Harald Staun, 15. 10. 2017 Harald Staun, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
»Leo, Steinbeis und Zorn sagen nicht, wie man mit Rechten reden muss. Sie führen vor, warum, wie und worüber sie selbst mit Rechten reden. Und sie denken über das Reden mit Rechten nach. Mal analytisch, mal literarisch. Teils logisch, teils mythologisch, polemisch oder selbstironisch. « Nachrichten Kaiserslautern, 25. Januar 2024 Nachrichten Kaiserslautern
»In ihrem auf der Frankfurter Buchmesse breit diskutierten Buch "Mit Rechten reden" haben die Autoren Maximilian Steinbeis, Per Leo und Daniel-Pascal Zorn viele bedenkenswerte Anregungen versammelt, wie ein inhaltlich fundierter Dialog als offenes Gespräch gestaltet werden kann. «Felix Müller, Berliner Morgenpost, 12. 03. 2018 Felix Müller, Berliner Morgenpost
»Per Leo, Maximilian Steinbeis und Daniel Pascal-Zorn definieren ungewöhnlich , argumentieren schlau und liefern dennoch keinen Ratgeber für den Umgang mit eben jenen Menschen, die sich rechts nennen oder sich für rechts halten, die sich aber ohne ihren linken Gegenpart in der Regel gar nicht selbst grenzscharf einsortieren können. «Goslarsche Zeitung, 29. 11. 2017 Goslarsche Zeitung
»Ein kluges, faires, freies Buch. «Christian Eger, Mitteldeutsche Zeitung, 26. 10. 2017 Christian Eger, Mitteldeutsche Zeitung
»Auch ohne den Eklat auf der Buchmesse wäre die gerade erschienene Streitschrift Mit Rechten reden das Buch der Stunde. Oder zumindest ein Buch, das man allen empfehlen sollte, die besser verstehen wollen, wieso die öffentliche Debatte über den Umgang mit der Neuen Rechten schnell so verfahren wird. Jetzt . . . wirkt der Eklat fast wie eine Bestätigung der Thesen, die Per Leo, Maximilian Steinbeis und Daniel-Pascal Zorn . . . entwickeln. «Allgemeine Zeitung, Johanna Dupré, 18. 10. 2017 Johanna Dupré, Allgemeine Zeitung Mainz
»In der Diagnose enthüllt «Mit Rechten reden» wenig Neues. Erfrischend dagegen ist der Ansatz, die Mängel der Debattenkultur in einen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang zu spannen: Nicht du hast das Problem mit mir. Wir beide haben eines, aneinander und miteinander. Da wir politisch aufeinander angewiesen sind, können wir uns weder einfach ausgrenzen noch ignorieren. So ironisch ab- und aufgeklärt ihr Tonfall bisweilen ist, so ernst scheint den drei Autoren das Anliegen, den ausgetretenen Kampfplatz neu zu beleben, die Moral zugunsten von mehr Logik über Bord zu werfen und wieder zuzuhören. Dann können aus Feinden wieder Gegner werden. «Neue Zürcher Zeitung, Tobias Sedlmaier, 17. 10. 2017 Tobias Sedlmaier, Neue Zürcher Zeitung
»Dieses Buch gibt uns einiges zum Grübeln auf, denn es stellt die Frage, wohin wir mit unserer großen Erzählung, unserem Habitus, unserem Ansatz wollen. [. . .] Unser Mythos sei der vom »ewigen, unerlösten Opfer«, und darum könne, »wer nicht mit ihnen leidet, nur gegen sie sein. Aggressive Jammerlappen sind sie. Wehleidige Arschlöcher. Unerlöste, tatbereite Opfer. « Das ist starker Tobak, das ist ein Frontalangriff, und zwar ein sauber ausgearbeiteter [. . .]. «Götz Kubitschek, Sezession, 16. 10. 2017 Götz Kubitschek, Sezession
»2017 erschienen mehrere Bücher aus dem linksliberalen Milieu, die dazu auffordern, sich mit Faschisten zu unterhalten, weil man angeblich etwas von ihnen lernen könnte. Aber was? Besonders brutale Promotion? Das intelligenteste dieser Bücher stammt von Per Leo, Maximilian Steinbeis und Daniel-Pascal Zorn, es heißt »mit Rechten reden« und zeigt sehr gut, dass die Rechten außer dunkel dräuenden Gefühlen nicht viel zu bieten haben, aber das immer erfolgreicher. «Junge Welt, Christof Meueler/Peter Merg, 16. 10. 2017 Christof Meueler, Junge Welt
»Der analytische Gewinn des Buches liegt dabei vor allem im überzeugenden Nachweis darüber, wie sich die rechte Rhetorik erfolgreich aus der eigenen Verantwortung stiehlt. . . . Man muss den Optimismus der drei Autoren nicht teilen, um ihre Einladung an alle Rechten und Nichtrechten zu einem anderen Sprachspiel, einem konstruktiven Dialog nachdrücklich zu begrüßen. It s on! «Deutschlandfunk Kultur, Simone Rosa Miller, 16. 10. 2017 Simone Rosa Miller, Deutschlandfunk Kultur
»Wer den Nerv hat sich auf diesen als Sachbuch getarnten Mindfuck einzulassen, wird auch daran große Freude haben. «taz, Nina Apin, 10. 10. 2017 Nina Apin, taz
»Das ist großes Theater, vielleicht auch Stoff für einen Film, den Christoph Schlingensief vom Olymp herab realisieren könnte, das Wiedereintreten situationistischen Denkens in die verarmte und ausgedörrte Arena des politischen Redens unserer Zeit. (. . .) Wer in der beginnenden Legislaturperiode sich auf dieses Spiel einließe und unter der Regie des nächsten Bundestagspräsidenten Debatten führen wollte, die den prästabilierten Totentanz des Behauptungsredens endlich hinter sich ließen und dem politischen Prozess die Würde des Enttäuschens zurückgäben, kommt nicht darum herum, besonders dieses Kapitel sehr aufmerksam zu lesen. Alles hat seine Zeit. Dieses Buch gilt unserer. «Der Freitag, Hans Hütt, 05. 10. 2017 Hans Hütt, der Freitag
»Das so meinungsfreudige wie sprachgewitzte Buch will kein Ratgeber sein, versteht sich aber als Leitfaden für Situationen kommunikativer Zuspitzung in den Sozialen Medien oder beim Smalltalk. «Tagesspiegel, Christian Schröder, 22. 09. 2017 Christian Schröder, Tagesspiegel
 Besprechung vom 19.03.2025
Besprechung vom 19.03.2025
Sprachspiel, neue Runde
"Mit Rechten reden" und von Gewalt schweigen
Es muss in einer Demokratie eine Möglichkeit geben, rechts zu sein, ohne von Staat, Medien und Zivilgesellschaft als Feind bekämpft zu werden. Auch und gerade wer sich nicht als rechts versteht, ist gut beraten, daran mitzuwirken, diese Möglichkeit einzuräumen. Rechten als politischer Gegner und nicht als Feind gegenüberzutreten, verlangt jedoch, dass die Kräfte, die nicht rechts sein wollen, wissen, wofür sie selbst stehen, dass sie sich untereinander differenzieren und sich nicht ständig durch rechte Provokationen die Form der Auseinandersetzung aufzwingen lassen.
Das ist in groben Zügen das Argument des 2017 erschienenen Buches "Mit Rechten reden. Ein Leitfaden" von Per Leo, Maximilian Steinbeis und Daniel-Pascal Zorn. Jetzt ist bei Klett-Cotta eine erweiterte Neuausgabe erschienen. Fast 60 der 256 Seiten bieten neues Material: ein ausführliches neues Vorwort, Zorns Essay "Zur Verschiebung des rechten Sprachspiels 2017-2024" und zwei nachgedruckte Interviews. Steinbeis war, soweit ersichtlich, nicht mehr beteiligt und hat das neue Vorwort nicht gezeichnet.
Was in "Mit Rechten reden" nur ganz am Rande vorkommt, ist rechte Gewalt. Rechte, die kriminell bis terroristisch organisiert Gewalt ausüben und den Staat zu unterminieren versuchen, müssen zwar auch nach Leo und Zorn als Feind betrachtet werden. Doch reicht es, heißt es ausdrücklich, wenn Verfassungsschutz und Antifa sich um sie kümmern.
Wenn man nun zum Beispiel in Thüringen lebt, hat man in den vergangenen Jahren das eine oder andere Gespräch darüber geführt, was denn im schlimmsten Fall geschehen könnte. Die Korrelation rechter Gewaltkriminalität mit politischen Erfolgen der AfD, aber auch etwa Maximilian Krahs Äußerungen dazu, private Waffenbesitzer mit hilfspolizeilichen Aufgaben betrauen zu wollen, lassen vermuten, dass dies eben nicht nur politisch-administrativ Unangenehmes bedeuten könnte. Die richtige und insbesondere Leo wichtige Feststellung, dass Deutschland sich nicht in einem Bürgerkrieg befinde (auch nicht in einem "molekularen", wie ihn die Rechten herbeischreiben wollen), geht also möglicherweise am Punkt vorbei. Dass es Politkitsch ist, ein zweites 1933 und eine zweite Schoa an die Wand zu malen, und dass mit einer siegreichen AfD nicht sofort das Vierte Reich kommt, heißt nicht, dass es nicht eine für heutige deutsche Verhältnisse unerhörte Zahl von Opfern staatlich protegierter und durch die Verflechtungen der Partei mit der extremistischen Szene beförderter Gewalt geben könnte.
Bei der Risikobewertung der AfD und ihres Umfelds gewichten die Autoren den Gewaltaspekt zu gering: Das schien mir schon 2017 die grundlegende Schwäche von "Mit Rechten reden", als ich das Buch für das Internetfeuilleton "54books" rezensierte. In den siebeneinhalb Jahren seit Erscheinen haben sich mehrere rechte Terrorakte ereignet, es gab etwa 40 Tötungsdelikte mit rechtem Hintergrund, und die rechte Straßengewalt, insbesondere in der ostdeutschen Provinz, hat stark zugenommen. Dies wird in den neu hinzugekommenen Texten punktuell angesprochen, aber eine nähere Auseinandersetzung mit der Frage der Bewertung rechter Gewalt bleiben die Autoren nach wie vor schuldig. Wie Leo sich im Interview mit Benjamin Moldenhauer von 2019 zu diesem Thema windet, lohnt sich zu lesen. Immerhin äußert er, man dürfe "real existierende Extremfälle" wie Gewaltakte nicht "essentialistisch zum Kern" von Gruppen erklären. Als Beispiele von Gruppen nennt er Rechte, Asylbewerber und militante Linke in einem Atemzug, den Vergleich von Opferzahlen verbittet er sich.
Zorns Nachwort, das nochmals gut erläutert, wie "Rechte" für die Zwecke des Buches definiert sind, kann man ergänzend heranziehen: "Rechts" ist für die Verfasser eben vor allem ein strukturelles Merkmal eines Diskurses, den Rechte "Nicht-Rechten" aufzwingen wollen und dem "Nicht-Rechte" auf den Leim gehen, wenn sie sich auf rechte Existenzkampfrhetorik einlassen. Als konkrete Exponenten dieses "Sprachspiels" tauchen jedoch durchweg, wo nicht wie in weiten Teilen des Buches bloß fiktive Rechte auf fiktive Linke treffen, Akteure wie die AfD oder die bekannte Schnellroda-Connection auf, deren Berührungen mit gewalttätigen Milieus unbestreitbar sind. Die Autoren können sich also zuschreiben, sich mit einem konkreten politischen Phänomen zu beschäftigen, sich aber auch jederzeit darauf zurückziehen, dass die Akteure sie nur in der Rolle von Proponenten des "Sprachspiels" interessieren. Dies war schon 2017 eine fragwürdige Positionierung, und die Neuausgabe ändert nichts daran.
Ohnehin sind sich die Verfasser, auch wenn sie einräumen, dass sich die Fronten verschoben haben, sehr sicher, nach wie vor grundsätzlich die richtigen Antworten zu haben. Mindestens dreimal, im neuen Vorwort, im neuen Nachwort und im "Spiegel"-Interview von 2024, sagen sie deutlich, dass es uns heute besser ginge, hätten wir uns nur an ihre Ratschläge gehalten. Das sagt viel über ihr Selbstbewusstsein. Dass sie recht haben, darf man getrost bezweifeln. MATTHIAS WARKUS
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.