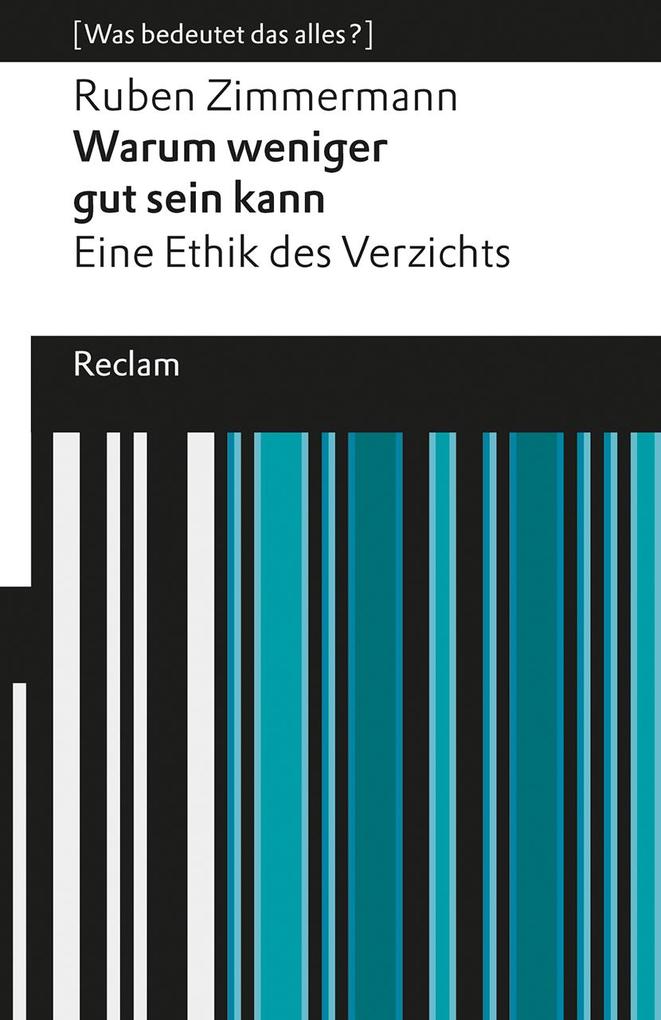
Zustellung: Mo, 04.08. - Mi, 06.08.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Weniger ist mehr - woran wir uns gewöhnen sollten, dürfen und können!
Verzicht wird häufig als politischer Kampfbegriff oder apokalyptisches Drohwort verwendet und stößt so vielfach auf Widerstand.
Aber könnte das Verzichten angesichts von Übermaß und Überdruss nicht nur notwendig, sondern vielleicht sogar hilfreich und befreiend sein? Was ist gut am Verzicht in ganz unterschiedlichen Handlungsfeldern? Wann tut er weh? Und warum verzichten Menschen trotzdem?
Ruben Zimmermann plädiert dafür, das Verzichten als individuell und sozial wertvolle Handlungsweise zu verstehen. Er erläutert, wie der freiwillige Verzicht funktioniert und was ihn vom auferlegten Verbot unterscheidet. So wird erkennbar, worin die Chancen einer Ethik des Verzichts für Einzelne, die Sozialgemeinschaft und sogar für kommende Generationen liegen.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
26. März 2025
Sprache
deutsch
Untertitel
Eine positive Perspektive auf Verzicht als wertvolle Handlungsweise in einer kapitalistischen Welt.
'Reclam Universal-Bibliothek'.
Originalausgabe.
Auflage
Originalausgabe
Seitenanzahl
120
Reihe
Reclam Universal-Bibliothek
Autor/Autorin
Ruben Zimmermann
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
64 g
Größe (L/B/H)
146/93/9 mm
ISBN
9783150146613
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 07.05.2025
Besprechung vom 07.05.2025
Nach dem Wachstum
Ruben Zimmermann lobt den Verzicht
Laut einer Studie der Europäischen Umweltagentur (EEA) vom März dieses Jahres haben EU-Bürger im Jahr 2022 pro Kopf 19 Kilogramm Textilien und Schuhe gekauft. Mehr als je zuvor. Dieser Konsumlust setzt der Mainzer Theologieprofessor Ruben Zimmermann einen Appell zum Verzicht entgegen. Wer in der Lage sei, etwas zu tun, der sei auch in der Lage, es zu unterlassen. So in etwa lautet die These Zimmermanns, der sich in einem Forschungszentrum zur Ethik in der Antike und im Christentum mit dem Phänomen des Verzichts beschäftigt.
Wer sich bei der Lektüre Versprechungen à la "Weniger ist mehr" oder "The Joy of Missing Out (JOMO)" erhofft, wird hier nicht fündig. Der Titel des Essays, "Warum weniger gut sein kann", spielt nicht auf die Leichtigkeit des Verzichts an, sondern auf seine moralische Dimension. Entsprechend liefert Zimmermann einen Text, der von aristotelischem Maßhalten und stoizistischer Radikalität über aktuelle Konsumkritik bis zu medizinethischen Fragen führt, um zu zeigen, wie vielfältig (und mühevoll) Verzicht sein kann. Die Entscheidung jedes Einzelnen steht bei ihm im Zentrum: "Verzicht ist seinem Wesen nach von Freiheit, Freiwilligkeit und Flexibilität gekennzeichnet."
Zimmermann grenzt den Begriff ab vom Verbot, will ihm den unangenehmen Beigeschmack des "Kampfbegriffs" in aktuellen Debatten nehmen. Der Ausschöpfung eigener Privilegien setzt er Weitsicht und Selbstregulation entgegen. Für eine lebenswerte Zukunft aller brauche es die Zurückhaltung derer, die es gut haben. "Zu gut vielleicht", schreibt Zimmermann und vertritt ein relationales Verständnis von Privilegien, das ohne Superlative auskommt. Ob jene Privilegien auf "eigene Verdienste" zurückgehen oder aber "durch den Zufall einer glücklichen Geburt in eine wohlhabende Familie oder in einer privilegierten Region des Landes oder dieser Erde entstanden sind", spielt für ihn keine Rolle.
Zentral für die Überzeugungen des Autors ist dagegen die Unmöglichkeit nicht endenden Wachstums. So speist sich seine Verzichtsethik aus philosophischen Traditionen, rechnet mit dem Status quo von Lebensweisen ab, bei denen nicht viel gefragt wird, bevor umso mehr konsumiert wird, und wird schließlich zur entschiedenen Postwachstumsstrategie. Ins Visier genommen wird die immer größer werdende "Schere zwischen einigen wenigen Nutznießern des Wachstums und einer großen Mehrheit, die am Mehr des Wachstums nicht partizipiert".
Die Klimaethik ist das Herzstück seiner Ethik des Verzichts. Hier kann Zimmermann - 2023 Initiator eines ökumenischen Appells für entschiedenere Klimapolitik - auch Verboten als notwendiges Mittel demokratischer Ordnung etwas abgewinnen und tritt für eine "Kulturtechnik der freiwilligen und tolerierten Einschränkungen" ein. Nimmt man Zimmermann beim Wort, wird der Verzicht zwar nicht zum Gebot, aber eben zum "right thing to do". Und wenn der Verzicht des Einzelnen Wellen schlägt und andere zur Nachahmung anregt, entstehe ein Klima, in dem auch staatliche Verbote auf offene Ohren treffen. Wer verzichtet, darf sich folglich auf die Fahne schreiben: "aktiv, entscheidungsstark und zukunftsorientiert". Nicht schlecht, in diesen Zeiten. ELISA SCHÜLER
Ruben Zimmermann: "Warum weniger gut sein kann". Eine Ethik des Verzichts.
Reclam Verlag, Ditzingen 2025. 120 S., br.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Warum weniger gut sein kann. Eine Ethik des Verzichts. [Was bedeutet das alles?]" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









