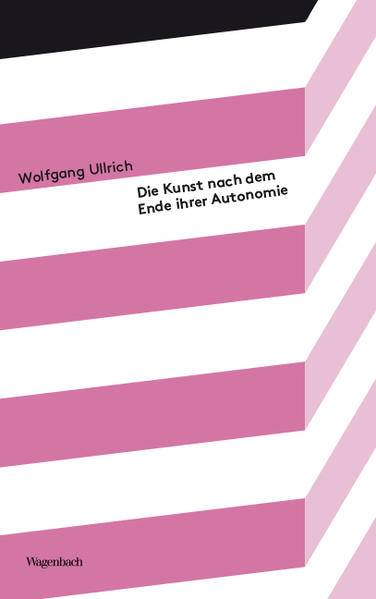
Zustellung: Fr, 23.05. - Mo, 26.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Muss Kunst heute politisch, fair und klimaneutral sein? Was unterscheidet sie noch von Mode und Design? Kritisch und zugleich kulturoptimistisch: Wolfgang Ullrichs umfassende Analyse eines Paradigmenwechsels, dessen Konsequenzen weit über die Kunst hinausreichen.
Das in der Moderne im Westen vorherrschende Ideal autonomer Kunst ist am Ende. Unterscheidungen zwischen Kunst und Kommerz lösen sich ebenso auf wie fest umrissene Werkgrenzen und Rollenklischees: Jeff Koons entwirft Taschen für Louis Vuitton, Künstler-Labels produzieren »Art Toys«, kollaborative Projekte setzen auf die Mitwirkung vieler, und Protestgruppen fordern mehr soziale Verantwortung der Kunstwelt. Mit wacher Zeitgenossenschaft führt Wolfgang Ullrich einzelne Phänomene wie beispielsweise Make-up-Fotos auf Instagram, die utopische Malerei von Kerry James Marshall und Takashi Murakamis Sneaker zusammen und entfaltet so das Panorama einer neuen Kunst, die sich mit Aktivismus und Konsum verbündet: einer Kunst, die Kräfte möglichst vieler Disziplinen in sich bündelt, damit aber anderen und mehr Kriterien als früher zu genügen hat.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
17. März 2022
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
192
Reihe
Kleine Kulturwissenschaftliche Bibliothek
Autor/Autorin
Wolfgang Ullrich
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
291 g
Größe (L/B/H)
217/141/19 mm
Sonstiges
Englisch Broschur
ISBN
9783803151902
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 12.03.2022
Besprechung vom 12.03.2022
Vielleicht noch Jay-Z im Louvre
Gerne auch Sandalen aus recyceltem Plastikmüll: Wolfgang Ullrich sieht sich an, was heute so alles unter Kunst rubriziert wird.
Von Georg Imdahl
Es ist kein schönes, aber ein anregendes Gedankenspiel, das der Autor in einer Passage seines Buchs anstellt: Könnte dem Begriff "Kunst" ein ähnlicher Bedeutungsschwund widerfahren wie der "Metaphysik", dem "Geist", der "Seele"? Wir verstehen zwar noch, was mit diesen Begriffen gemeint ist, beziehen sie aber nicht mehr auf das eigene Denken, erfüllen sie nicht mehr mit Leben. Und, so ließe sich weiter fragen, bedeutet nicht "zeitgenössische Kunst" mit ihrer angeborenen Skepsis gegenüber Kanon, Genie, Meisterwerk per se eine Absage an etablierte Hochkultur? Ist da eine Entwicklung vorgezeichnet - und es also nur noch eine Frage der Zeit, wann wir uns an die Kunst so erinnern werden wie an die Metaphysik?
So weit ist es momentan noch nicht, wohl aber beklagt Wolfgang Ullrich einen Kunst-Status-quo "nach dem Ende ihrer Autonomie". Als unbedingte Prämisse, wie sie zum Beispiel vom New Yorker Kritiker Clement Greenberg in den Fünfzigerjahren propagiert wurde, hat sich die Selbstbezüglichkeit der Ästhetik tatsächlich erledigt, und wer dies heute unter dem Rubrum "post-autonomes" Zeitalter betrauert, ist damit etwas spät dran. Ähnliche Klage hätte sogar schon vor hundert Jahren angestimmt werden können, als mit abseitigen Dingen wie einem Flaschentrockner die eingeübten Werkbegriffe unterspült wurden.
Gleichwohl kann seltsam anmuten, was heute alles so als Kunst durchgeht: Sneakers im Look von Kampfsport, Trekking und Neo-Geo, Sandalen aus recyceltem Plastikmüll, "Satan-Shoes" mit einem Blutstropfen in der Sohle - Erzeugnisse, die die japanische Manga-Kultur feiern, soziales Empowerment im Zeichen benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen befördern oder auch wohlfeiles Konsumgewissen beruhigen. Dazu kommen Handelswaren wie Art Toys in Gestalt possierlicher Figürchen, die im Netz angemessen gehypt werden. Ullrich rümpft die Nase darüber in seinem Abgesang auf die Gegenwartskunst. Sie erscheint ihm, "als hätte ich einen Filmriss gehabt und ein paar Jahre verpasst".
Dafür wiederum ist er gut informiert über die Filiationen einer Kunstpraxis, die diese unter den unterschiedlichsten ökonomischen, weltanschaulichen, soziopolitischen Vorzeichen auf Abwege führt und ihre Essenz pulverisiert. Den Sneakern nun aber mit van Goghs "Bauernschuhen" und Heideggers Hermeneutik von 1936 beikommen zu wollen, die die Kunst noch zum "Wirklichkeitsbooster" habe erklären können, führt auch nicht eben ins Zentrum heutigen Diskurses (ein Theoretiker der Postmoderne wie Fredric Jameson hatte van Goghs Schuhwerk bereits vor Jahrzehnten gegen Warhols "Diamond Dust Shoes" in Stellung gebracht).
Als Ursachen für die "Schwächung der Autonomie" nennt Ullrich, durchaus nicht überraschend, einen "überstrapazierten und entleerten" Begriff von Kunst, die Globalisierung ihrer Institutionen und den "Sog der sozialen Medien". Mit manchem hat er recht: Wenn nicht nur Altmeister-Gemälde wie der Leonardo zugeschriebene Salvator Mundi, sondern auch ein Formel-1-Rennwagen oder das Skelett eines Tyrannosaurus Rex in einer Auktion für Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts aufgerufen werden und sagenhafte Preise erlösen, dann - ja was soll man dann überhaupt noch sagen? Dann finden wir uns offenbar in einer postrationalen Ära wieder.
Wo aber sieht Ullrich die nach wie vor bestehenden Optionen einer postautonomen Kunst? Zu seinen Beispielen zählen die schwarze Ledertasche mit dem (in Anführungszeichen gesetzten) Aufdruck "Sculpture" des Designers Virgil Abloh und seine Marke "Off-White", ein Titelbild von Kerry James Marshall auf der Zeitschrift "Vogue" und das Video "The Carters" von Beyoncé und Jay-Z aus dem Louvre.
Das interessanteste Phänomen, das Ullrich hier ins Feld führt, ist die Aufklärungsarbeit von Forensic Architecture, einem Londoner Kollektiv, das staatliche Rechtsverstöße auf aller Welt in minutiöser Detailrecherche rekonstruiert, um damit juristisch belastbare Beweise vorzulegen - hierzulande im Fall des NSU-Mordes in Kassel, international etwa bei fragwürdigem Vorgehen gegen Flüchtlinge in Seenot oder Bombenangriffen im Nahen Osten. Dafür entwickelt die Forschergruppe jeweils eigene Demonstrationsmodelle, die an sensueller Prägnanz kaum zu übertreffen sind. Als Installationen im Kunstraum wirken sie etwas seltsam, denn der Gerichtssaal scheint eigentlich der geeignete Ort. Warum betrachten wir solche Forensik bei Biennalen, der Documenta oder in der Frankfurter Schirn? Ullrich stellt sie kurzerhand in eine Linie der Naturbetrachtung, die von John Constable über Maria Sibylla Merian zu Leonardo zurückführt und an "vorautonome Traditionen" anknüpfe, die auch das Ziel hatten, "schwer Verständliches zu veranschaulichen". Kurioser ließe sich der Auftrag von Forensic Architecture nicht begründen.
Ullrichs Analyse leidet unter der Unschärfe der Begriffe von autonomer und "postautonomer" Kunst. Für eine Generalattacke auf die Gegenwart mangelt es an theoretischer Durchdringung. Relevante Kunst, und sei sie politisch oder sozialkritisch noch so engagiert, lässt sich als solche in ihrer Wirkungsmacht nicht nacherzählen oder abbilden. Man muss sie selbst erleben, darin behauptet sie ihre Selbständigkeit, mag sie noch so viel außerkünstlerische Realität in sich aufgenommen haben. Eine Menge dessen, was an Gegenwartskunst heute produziert, propagiert, vermarktet, gesammelt wird, leistet das nicht. Daraus haben Kunsthistoriker und Philosophinnen wie Peter Osborne und Juliane Rebentisch bereits vor einigen Jahren den Schluss gezogen, als "zeitgenössisch" nur mehr eine Teilmenge heutiger Hervorbringungen zu betrachten, nämlich solche, die ihre Gegenwart, in geschichtsbewusster, selbstkritischer ästhetischer Setzung, auf den Punkt bringen.
Wolfgang Ullrich: "Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie".
Klaus Wagenbach Verlag, Berlin 2022. 192 S., Abb., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









