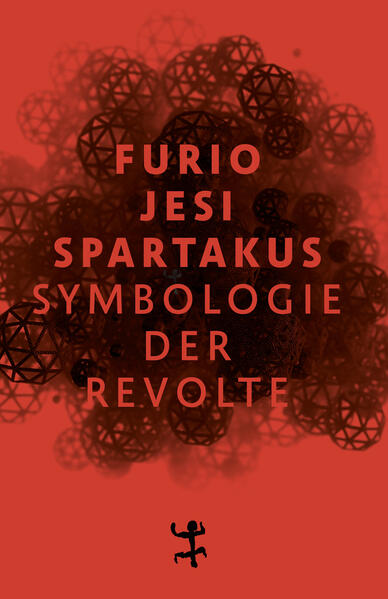
Zustellung: Mi, 03.09. - Fr, 05.09.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Schon 1969 hat Furio Jesi Spartakus. Symbologie der Revolte verfasst, doch erst 2000 wurde seine Rekonstruktion des Spartakusaufstandes in Berlin im Winter 1918-19 posthum veröffentlicht. Hier liegt sie erstmalig in deutscher Übersetzung vor. Am Beispiel des Spartakusaufstandes entwickelt Jesi den grundlegenden politischen Unterschied von Revolution und Revolte.
Ausgehend von literarischen Quellen wie Brecht, Eliade, Nietzsche, Mann und Bakunin skizziert Jesi eine Phänomenologie der Revolte, die zwei Zeitlichkeiten gegeneinander stellt: die zielgerichtete Linearität der Revolution und die »Aussetzung der historischen Zeit« in der Revolte. Jesi behauptet einen grundlegenden Unterschied zwischen dem unmittelbaren Erscheinen (Epiphanie) der Idee und ihrer Erstarrung im ideologischen Kanon, zwischen der Zeit der Subversion oder des Mythos und der Zeit der Erinnerung. Damit verbindet er Mythos und Revolte und versteht die Wirklichkeit des Mythos als etwas radikal Neues, gerade weil sie sich nicht in die Zeit der Erinnerung einschreiben lässt und wieder zu einem Synonym von Wahrheit wird.
Jesi, der eine ganze Generation italienischer Denker:innen von Pasolini über Eco bis Agamben beeinflusste, zeigt das spartakistische Berlin als eine aktualisierte Version der Pariser Kommune, die dann wiederkehrt in den Revolten des Pariser Mai 1968 und den politischen Kämpfen im Italien der 70er Jahre und so politisch anschlussfähig bleibt für gegenwärtige Bewegungen, die den Status quo eines "There is no alternative" angreifen.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
30. Januar 2025
Sprache
deutsch
Untertitel
Symbologie der Revolte.
1. Auflage.
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
267
Autor/Autorin
Furio Jesi
Übersetzung
Frank Engster, Cinzia Rivieri
Verlag/Hersteller
Originalsprache
italienisch
Produktart
gebunden
Gewicht
324 g
Größe (L/B/H)
200/123/28 mm
ISBN
9783751820684
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 23.08.2025
Besprechung vom 23.08.2025
Romantischer Kommunismus
Scheitern müssen die echten Revoluzzer: Furio Jesis Feier fehlgeschlagener Insurrektionen
Über die Deutschen heißt es, sie haben noch nie eine Revolution gemacht. Entweder agierten sie zu zögerlich oder zu ungestüm, verpassten die Möglichkeit, etwas Neues in die Welt zu setzen, oder überschätzten sie. Als Beispiel für Letzteres gilt der Spartakusaufstand. In heilloser Fehleinschätzung der Lage wie der eigenen Kräfte probten die frischgebackenen deutschen Kommunisten im Januar 1919 einen Aufstand, der nach wenigen Tagen niedergeschlagen wurde. Die Parteistrukturen wurden beschädigt, die Köpfe der Bewegung, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, ermordet. So bekam der Kommunismus in Deutschland arge Startprobleme, die er nie so recht überwinden konnte.
Schenken wir Furio Jesi Glauben, dann lag in dieser Insurrektion jedoch allerhand Zauber, Poesie und damit etwas, das sogar über den glanzvollen Erfolgen von 1789 oder 1917 steht. In seiner Studie aus dem Jahr 1969, die nun erstmals in deutscher Übersetzung vorliegt, solidarisierte sich der Kommunist Jesi mit den Verlierern der Geschichte, mit den erfolglosen Revoluzzern, die er von den ruhmreichen Revolutionären absetzt, die gut organisiert den erfolgreichen Umsturz schaffen. Dabei allerdings oft so erfolgreich sind, dass sie die alte Ordnung kopieren und alsbald bei einem drögen Bürokratismus landen. Sie verbleiben, wie Jesi schreibt, in der "historischen Zeit". Die Revolte dagegen, spontan und störrisch, lebt in ihrer eigenen Welt, sie suspendiert die historische Zeit und kommt damit dem kommunistischen Ideal des ganz Anderen näher als ihre erfolgreiche Schwester, die Revolution. Während die Revolutionäre nur ans absehbare "Morgen" denken, bereiten die Revoltierenden bereits das "Übermorgen" vor - und vollziehen damit den Sprung vom Klassenbewusstsein zum "Bewusstsein des Menschen".
Jesi, das wird hier bereits deutlich, war ein seltsamer Kommunist. Geboren 1941 in eine alte Rabbiner-Familie in Turin, wandte er sich früh der Ägyptologie zu, der griechischen Antike und dem modernen Deutschland - für ihn die drei großen Reservoirs an Mythen, Fabeln und Legenden, die er für den Kommunismus nutzbar machen wollte. Damit trieb Jesi den italienischen Kommunismus auf die Spitze. Seit Antonio Gramsci hatte dieser ein Faible für Phantastik - wie überhaupt für alles, was im Marxismus gemeinhin als "Überbau" bezeichnet wird. Gramsci hatte seinen Parteifreunden geraten, den Kampf um die Macht nicht allein auf ökonomischem Gebiet zu führen. Man müsse auch die Seelen streicheln.
Jesi ging noch einen Schritt weiter und empfahl seinen Genossen, im Mythos zu leben - nicht strategisch, sondern existenziell. Denn der "echte Mythos" ist das, was ewig wahr ist und die Menschen zu tollen Taten animiert. Er ist vom instrumentell deformierten "technischen Mythos" zu unterscheiden. Hierbei beruft sich Jesi, wie Andrea Cavalletti in seinem Vorwort erläutert, auf den Psychoanalytiker Karl Kerényi. Allerdings setzt er sich an einer Stelle von ihm ab: Wo Kerényi bürgerlich gebildete Einzelne zu Hütern der echten Mythen erklärt, hofft Jesi auf die Tat der Massen: auf die proletarische Revolte, die das Bürgertum zerschlägt, statt es durch technisierte Revolutionen zu kopieren.
Der Spartakusaufstand ist für Jesi in doppelter Weise mythisch: Zum einen schließt er an den berühmten antiken Sklavenaufstand an sowie an Adam Weishaupts Illuminatenorden und Georg Büchners hessische Bewegung, die ebenfalls im Namen des Spartakus agierten. Außerdem stünden die Revoltierenden von 1919 in einer phantasmapolitischen Reihe mit der Pariser Commune von 1871 und dem Pariser Mai 68, in dessen Schatten Jesi die Schrift verfasste - auch an die Aufstände in Turin, die quasi vor Jesis Haustür stattfanden, dürfte er beim Schreiben gedacht haben. All diese Erhebungen sind gescheitert, erzeugten aber ein großartiges Bild, das der nächsten Generation an Revoltierenden einen Auftrag hinterließ: Macht da weiter! Macht es besser! Bringt es zu Ende.
Paradoxerweise wird so bei Jesi das Scheitern der Revolte zur Bedingung ihres Gelingens: Das Niedermähen der Barrikadenkämpfer und die Ermordung Luxemburgs und Liebknechts erzeugten Märtyrer, die die Legende anreicherten. Der Vergleich mit dem Christentum wird immer wieder evoziert: Jesi beschreibt die Kämpfe im Register von "Märtyrern" und "Epiphanien". Den revolutionären Antirevolutionär Scheidemann bezeichnet er als "allzu bescheidenen Verkünder eines allzu bescheidenen Evangeliums". Jesis Interesse für Offenbarungen und Mythen dürfte bei den meisten Marxisten für Stirnrunzeln sorgen. Vollends die Fassung werden sie verlieren, wenn Jesi offen für einen gesunden Vorrat an "reaktionären Komponenten" in den Händen des Proletariats wirbt, an echten Mythen. Jesi, so scheint es, ist der Marxist, der sich am deutlichsten dem Überbau verschrieben hat. Er selbst bekannte, seine Schrift erinnere in ihrer fragmentarischen Beschwörung einer Phantasiewelt "mehr an Finnegans Wake als an 'Die Akkumulation des Kapitals'".
Aufschlussreich ist dieses Buch noch in einer anderen Hinsicht: Es spricht - auch in Verbindung mit Cavalettis Vorwort und dem Nachwort der Übersetzer Cinzia Riviera und Frank Engster - eine Einladung aus, Jesi als einen Vordenker der italienischen Gegenwartsphilosophie zu entdecken. Rund um Figuren wie Giorgio Agamben, Giacomo Marramao und Antonio Negri ist dort in den vergangenen Jahrzehnten ein Denken entstanden, das um ähnliche Themen kreist wie Jesi: Religion, Mythos, Suspension der Zeit und Außerkraftsetzung der Ordnung in der reinen Revolte. Agamben soll ein eifriger Leser von Jesi gewesen sein, Pasolini und Eco auch.
Außer dem Schlüssel zu Italien könnte Jesi auch den zu Deutschland liefern: Das Spartakus-Buch steckt voller Referenzen auf Thomas Mann, Bertolt Brecht oder Erwin Piscator, sodass der Eindruck entsteht, halb Deutschland beteiligte sich an der Nachbereitung des Mythos Spartakus. Der Germanist Jesi hat die Ergebnisse zusammengetragen. Sie bilden, wie er schreibt, die Fortsetzung seiner Studie über das "Geheime Deutschland", die bislang nicht übersetzt wurde. Durch Jesis Brille erscheint die lange bemäkelte deutsche Politikaversion, das Unvermögen, historische Chancen zu verwirklichen, als etwas Anderes, Tieferes: Der romantische Revoltierende ist revolutionärer als der Revolutionär. Er wälzt alles um, sogar die Umwälzung, und schafft am Ende nichts Praktisches. Aber etwas Mythisches. Und darauf kommt es an. MORITZ RUDOLPH
Furio Jesi: "Spartakus". Symbologie der Revolte.
Aus dem Italienischen von Cinzia Rivieri und Frank Engster.
Matthes & Seitz Verlag, Berlin 2025.
267 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Spartakus" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









