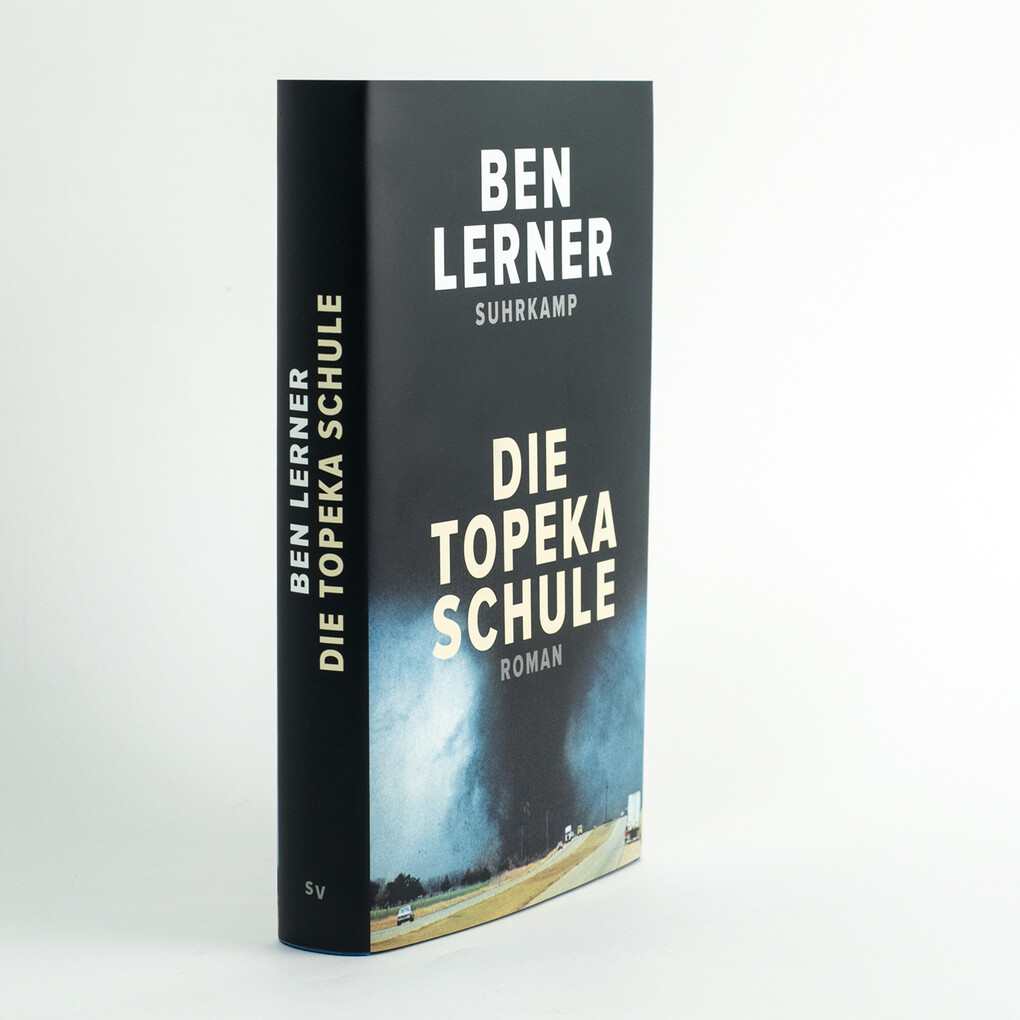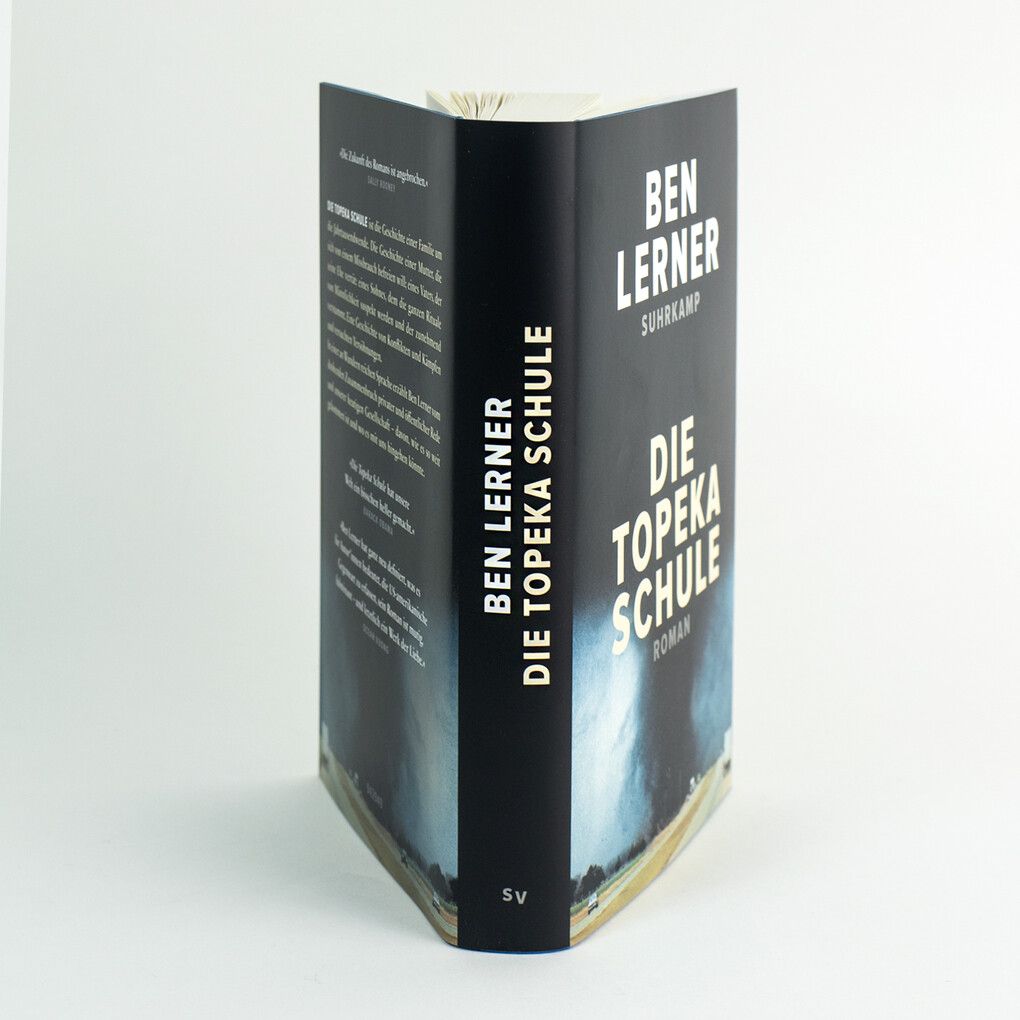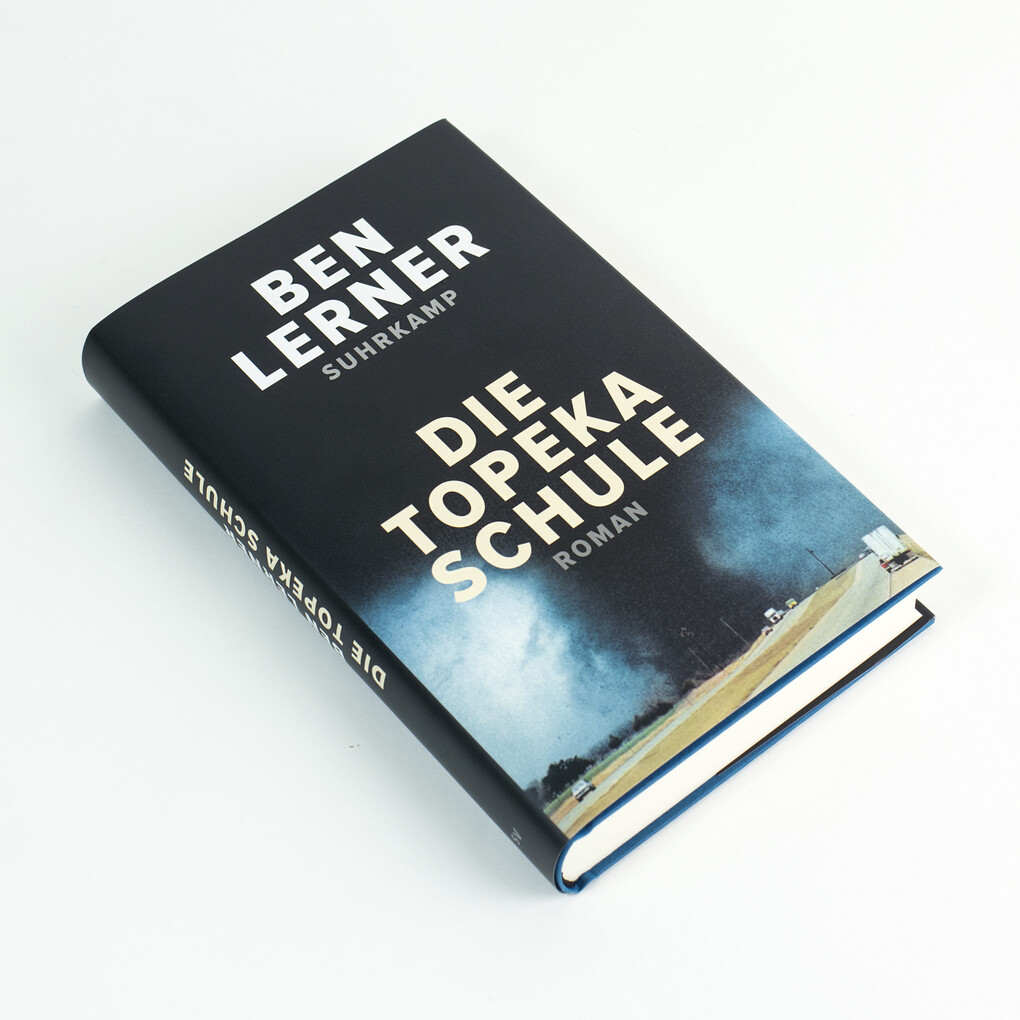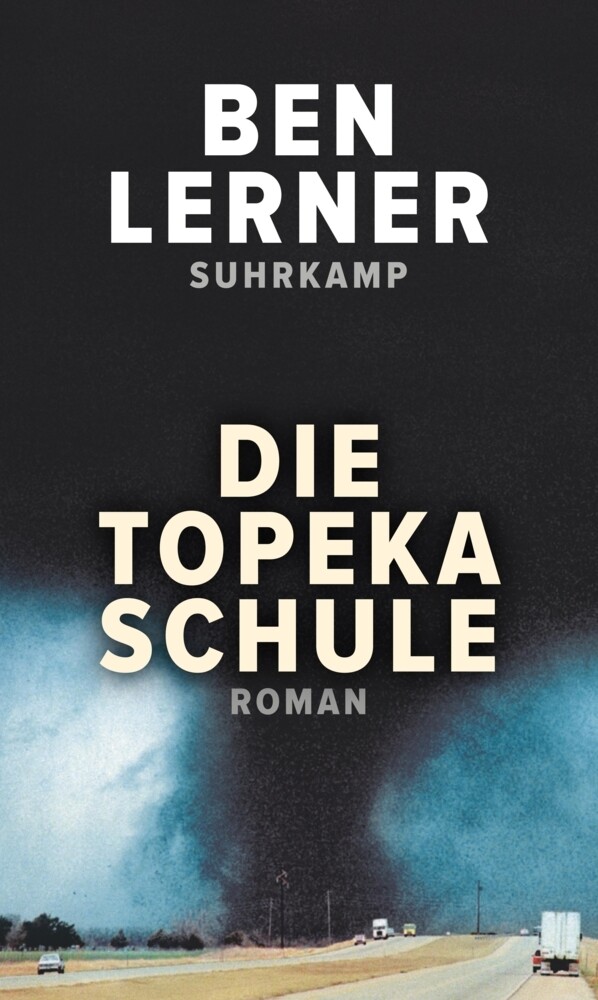
Zustellung: Mo, 04.08. - Mi, 06.08.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiAdam Gordon geht auf die Topeka-High-School, er steht kurz vorm Abschluss. Seine Mutter Jane ist eine berühmte feministische Autorin, sein Vater Jonathan ein Experte darin, »verlorene Jungs« wieder zum Sprechen zu bringen. Sie beide sind in einer psychiatrischen Einrichtung tätig, in der Therapeuten und Patienten aus der ganzen Welt zusammenkommen. Adam selbst ist ein bekannter Debattierer, alle rechnen damit, dass er die Landesmeisterschaft gewinnt, bevor er auf die Uni geht. Er ist ein beliebter Typ, cool und ausschreitungsbereit, besonders sprachlich, damit keiner auf die Idee kommt, er könnte auch schwach sein. Adam hat ein Herz für Außenseiter, und so freundet er sich mit Darren an er weiß nicht, dass der einer der Patienten seines Vaters ist , und führt ihn in seine Kreise ein. Mit desaströsen Folgen
Die Topeka Schule
ist die Geschichte einer Familie um die Jahrtausendwende. Die Geschichte einer Mutter, die sich von einer Missbrauchsgeschichte befreien will; von einem Vater, der seine Ehe verrät; von einem Sohn, dem die ganzen Rituale von Männlichkeit suspekt werden und der zunehmend verstummt. Eine Geschichte von Konflikten und Kämpfen und versuchten Versöhnungen.
In einer an Wundern reichen Sprache erzählt Ben Lerner vom prekären Zusammenhalt einer Familie, von fraglichen Vorbildern und vom drohenden Zusammenbruch privater und öffentlicher Rede. Die Art, wie dabei das Historische und das Persönliche miteinander verwoben werden, stärkt unseren Glauben daran, was Literatur heute zu leisten vermag.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
17. August 2020
Sprache
deutsch
Untertitel
Roman.
Originaltitel: The Topeka School.
Seitenanzahl
395
Autor/Autorin
Ben Lerner
Übersetzung
Nikolaus Stingl
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
englisch
Produktart
gebunden
Gewicht
494 g
Größe (L/B/H)
214/134/32 mm
ISBN
9783518429495
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Klug und witzig führt Ben Lerner das akademische Milieu vor und holt dabei die sprachlose Wut der USA ans Licht.« Andrea Köhler, Neue Zürcher Zeitung
»Ben Lerners Topeka Schule ist eine kluge Erzählung über weiße Privilegien. Sie endet bei Trump.« Philipp Hindahl, der Freitag
»... [Ein Werk] im klügsten, aufklärerischsten und oft sehr witzigen Sinne. Der politischen Literatur unserer Tage könnte es ein Licht aufstecken.« Kai Sina, Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Es ist schön zu sehen, wie viel Empathie dieser rhetorisch beschlagene Autor aufbringt für einen Protagonisten, der gar keine adäquate Sprache hat, und fast schon paradox, wie viel imaginative Energie es braucht, um dessen alogische Traumwelt auszuleuchten.« Frank Schäfer, taz. die tageszeitung
» Die Topeka Schule ist Ben Lerners dritter Roman, er ist außerdem sein politischster und sein bisher bester ...« Wieland Freund, DIE WELT
»Wenn der Roman en détail von der fundamentalen Orientierungslosigkeit erzählt, die weiße, privilegierte Jungs in den Neunzigern in abgrundtiefe Krisen stößt, ist er nichts Geringeres als ein literarisches Phänomen.« Felix Stephan, Süddeutsche Zeitung
»Lerner siedelt die Geschichte des Analytikersohns und Debattiertalents Adam in den Neunzigerjahren an, erzählt aber tatsächlich von den Anfängen der Ära Trump. Es geht um den Anfang unserer Infokriege und die große Krise der Männlichkeit. Brillant!« WELT AM SONNTAG
»Ein literarischer Text, der mir Amerika aufgeschlüsselt hat wie kaum ein anderer Roman der letzten Zeit.« Sandra Kegel, 3sat Buchzeit
»Ben Lerner, der viel aus seiner eigenen Biografie schöpft, hat mit [ Die Topeka Schule ] einen Roman geschrieben, der sich nicht nur mit Leichtigkeit durch seine verwobenen Erzählebenen und Figuren-Perspektiven bewegt, sondern auch detailgenau von der immensen sozialen und kulturellen Spaltung in den USA erzählt.« Vladimir Balzer, Deutschlandfunk Kultur
»Sprache wird im Buch zum doppelten Vehikel: Einerseits ist sie eine Waffe, ein verletzendes Machtinstrument, das in der entmenschlichenden Sprache der Trump-Ära mündet. Andererseits ist sie Werkzeug des Wunders der Kommunikation.« Hanno Hauenstein, Berliner Zeitung
»Ben Lerners Topeka Schule ist eine kluge Erzählung über weiße Privilegien. Sie endet bei Trump.« Philipp Hindahl, der Freitag
»... [Ein Werk] im klügsten, aufklärerischsten und oft sehr witzigen Sinne. Der politischen Literatur unserer Tage könnte es ein Licht aufstecken.« Kai Sina, Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Es ist schön zu sehen, wie viel Empathie dieser rhetorisch beschlagene Autor aufbringt für einen Protagonisten, der gar keine adäquate Sprache hat, und fast schon paradox, wie viel imaginative Energie es braucht, um dessen alogische Traumwelt auszuleuchten.« Frank Schäfer, taz. die tageszeitung
» Die Topeka Schule ist Ben Lerners dritter Roman, er ist außerdem sein politischster und sein bisher bester ...« Wieland Freund, DIE WELT
»Wenn der Roman en détail von der fundamentalen Orientierungslosigkeit erzählt, die weiße, privilegierte Jungs in den Neunzigern in abgrundtiefe Krisen stößt, ist er nichts Geringeres als ein literarisches Phänomen.« Felix Stephan, Süddeutsche Zeitung
»Lerner siedelt die Geschichte des Analytikersohns und Debattiertalents Adam in den Neunzigerjahren an, erzählt aber tatsächlich von den Anfängen der Ära Trump. Es geht um den Anfang unserer Infokriege und die große Krise der Männlichkeit. Brillant!« WELT AM SONNTAG
»Ein literarischer Text, der mir Amerika aufgeschlüsselt hat wie kaum ein anderer Roman der letzten Zeit.« Sandra Kegel, 3sat Buchzeit
»Ben Lerner, der viel aus seiner eigenen Biografie schöpft, hat mit [ Die Topeka Schule ] einen Roman geschrieben, der sich nicht nur mit Leichtigkeit durch seine verwobenen Erzählebenen und Figuren-Perspektiven bewegt, sondern auch detailgenau von der immensen sozialen und kulturellen Spaltung in den USA erzählt.« Vladimir Balzer, Deutschlandfunk Kultur
»Sprache wird im Buch zum doppelten Vehikel: Einerseits ist sie eine Waffe, ein verletzendes Machtinstrument, das in der entmenschlichenden Sprache der Trump-Ära mündet. Andererseits ist sie Werkzeug des Wunders der Kommunikation.« Hanno Hauenstein, Berliner Zeitung
 Besprechung vom 16.08.2020
Besprechung vom 16.08.2020
Formen der Zungenfertigkeit
Sprache ist Macht, Missbrauch, Magie: "Die Topeka Schule", Ben Lerners Roman über eine Jugend
Ben Lerner ist ganz offiziell ein Genie: 2015 erhielt er das 625 000-Dollar-Stipendium der MacArthur-Foundation, die sogenannte Genie-Förderung. Für seinen zweiten Roman "22:04" bekam er einen sechsstelligen Vorschuss, was man nicht zuletzt deshalb weiß, weil Lerner es gleich am Anfang seines zweiten Romans erzählt, der von einem Schriftsteller namens Ben erzählt, der seinen zweiten Roman schreibt. Sein erster, "Abschied von Atocha", handelte von einem etwas jüngeren Mann namens Adam, der in Madrid studiert und Schriftsteller werden will. Von Ben ist Adam so weit entfernt, wie es die Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen sind, auch wenn das eine ganze Dimension sein kann, weil sich ja durch ein paar Vorzeichenwechsel ein ganzes Leben ändern kann.
Jetzt ist Adam zurück, als eine der drei bis vier Hauptfiguren in "Die Topeka Schule", und man muss nicht lange googeln, um herauszufinden, wie nah der Stoff dieses Romans an der Biographie von Ben Lerner ist: Lerner ist 1979 in Topeka geboren, einer Kleinstadt in Kansas, wo seine Eltern, wie die Adams, für eine berühmte psychotherapeutische Stiftung arbeiteten, eine Raumstation avancierten therapeutischen Denkens im provinziellen amerikanischen Heartland. Adams/Bens Vater ist Spezialist für "verlorene Jungs" und dreht nebenbei Filme, zum Beispiel eine Adaption von Hermann Hesses Kurzgeschichte "Ein Mensch mit Namen Ziegler". Seine Mutter schreibt feministische Bestseller über weibliche Wut oder das Muttersein. Und wer nach den Primärtexten dieses Romans sucht, der findet den ausführlich beschriebenen Film von Adams Vater Jonathan auf der Website von Bens Vater Steve Lerner. Und in Harriet Lerners Buch "The Mother Dance" zahlreiche Anekdoten über die herausfordernde Erziehung ihres Sohnes. Man tut Ben Lerner also nicht Unrecht, wenn man sagt, dass das Thema seiner Romane in erster Linie Ben Lerner ist. Dass er seine Erfahrungen überhaupt fiktionalisiert, scheint er dabei eher für eine fragwürdige Gepflogenheit zu halten: "Warum kommt es mir gefährlich vor, die Namen meiner Töchter zu fiktionalisieren?" fragt er, als er von seinen Mädchen erzählt.
Wer das Leben und Denken eines dreißig- bis vierzigjährigen weißen Brillenträgers aus Brooklyn bisher nicht für den Stoff eines originellen Romans hielt oder Lerners ironisch-distanzierte Selbstreflexionen über seine Rolle als brillentragender weißer Autor aus Brooklyn eher für Eitelkeit, ist sicher skeptisch, wenn es nun in "Die Topeka Schule" eben um die Kindheit und Jugend eines vierzigjährigen weißen Brillenträgers aus Brooklyn geht - erst recht, wenn sich schnell zeigt, dass Adam schon als Jugendlicher ein Genie war, ein Meister der Worte, ein Champion im Debattieren. Aber tatsächlich lernt man in dem neuen Roman auch einen neuen Ben Lerner kennen. Das liegt weniger daran, dass seine Kindheit immerhin nicht in Brooklyn oder sonst wo in Bohemistan spielt oder dass es diesmal eine Andeutung von Plot gibt, eine Nebenfigur namens Darren, einen Außenseiter, von dem man gleich zu Anfang erfährt, dass er irgendetwas Schlimmes mit einer Billardkugel veranstalten wird. Es liegt vor allem daran, dass Lerner diesmal den Erfahrungsraum seines eigenen Kopfes verlässt und nicht nur über Adam in der dritten Person, sondern aus der Perspektive der Eltern in der ersten Person erzählt.
Die vielschichtige Erzählweise ist mehr als eine Fingerübung, um abzubilden, dass es mehr als eine Wahrheit der Geschichte gibt. Sie dient vor allem dazu, das Spannungsfeld der verschiedenen "Regimes von Sprache", wie Lerner das nennt, deutlich zu machen, in denen Adam aufwächst, die Rolle dieser Sprachen als Muster und Prägung, als Werkzeug und Politik. So unterschiedlich diese Sprachen auch sind, die empathische, fast rituelle Sprache der Therapie, die breitbeinigen Sprüche der Teenager, die strategische Rhetorik der Debattier-Wettkämpfe, so erfüllt sie doch in jedem Fall einen ähnlichen Zweck: "Fast alle - Vorschüler, Mann-Kinder, Familientherapeuten, Analytiker, Biopsychologen, Debatten-Trainer - stimmten darin überein, dass Sprache magische Effekte haben konnte", schreibt Lerner. Nur Darren, dessen Entwicklung hinter der der Gleichaltrigen zurück ist, schlägt sich sprachlos durchs Leben.
In Lerners Fall bedeutet das, dass auch sein Erfolg als Autor von jener fragwürdigen Magie profitiert, weil solche sprachlichen Tricks eben nicht nur poetische Betörungen evozieren können, sondern auch jenes vergiftete Kommunikationsklima, welches heute regelmäßig beklagt wird. Vor allem in den Debatten lernt Adam schon als Schüler, dass es nicht auf Überzeugungen oder Überzeugungskraft ankommt, sondern nur auf Überwältigung und Überforderung. Die extremste Ausprägung davon ist die Technik des "Spreadings", die damals in den Wettkämpfen beliebt wird, ein Kofferwort aus "speed" und "reading", in der deutschen Ausgabe etwas krumm mit "Schnellsen" übersetzt. Beim "Spreading" reden die Debatter mit der Geschwindigkeit, die man sonst nur von Auktionären kennt. Das Ziel ist es, in der begrenzten Zeit möglichst viele Argumente aufzubieten, damit der Gegner nicht auf alle eingehen kann, ein formales Versäumnis, das unabhängig von der Qualität des Wortschwalls zum Punktabzug führt. Lerner sieht darin den Vorboten eines rhetorischen Bullyings, das sich mittlerweile in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ausgebreitet hat, etwa "dem 24-Stunden-Nachrichtenzyklus, den Twitter-Stürmen, dem algorithmischen Handel, den Tabellenkalkulationen und der DDoS-Attacke". Adams damaliger Tutor Evanson bringt ihm "einen zwischenmenschlichen Stil" bei, "den vollständig abzulegen er Jahrzehnte brauchen würde: die verbale Entsprechung von Unterarmen und Ellbogen". Evanson dagegen, auch er nur eine schlecht getarnte reale Figur, wird "zum Schlüsselarchitekten der rechtesten Regierung (...) die Kansas je erlebt hat, (...), ein wichtiges Vorbild für die Regierung Trump."
Dass es nicht so leicht ist, sich gegen diese Sprache zu behaupten, liegt auch daran, dass sie eine Form der Männlichkeit verkörpert, die nicht so leicht von ihren intellektuelleren Manifestationen zu trennen ist. Denn auch Adams schriftstellerische Ambitionen entstehen letztlich aus der Hoffnung auf die manipulative Kraft der Worte: "Er wollte Dichter werden, weil Gedichte Zauber waren, geformter, Sinn zunichtemachender und neu stiftender Klang, der Gewalt zufügte und abwehrte, der einen berühmt - und sei es fürs Ausgelöschtwerden - machte und noch andere Auswirkungen auf Körper haben konnte: sie einschläfern oder aufwecken", schreibt Lerner. Um aus seinem Talent als Debatter und Dichter auch unter seinen Peers soziales Kapital zu schlagen, musste er es "als eine Form von sprachlichem Kampf" aufführen: "Wenn sprachliches Können Schaden anrichten und dafür sorgen konnte, dass man Sex hatte, dann konnte man es als Jugendlicher in den Bereich des Sozialen integrieren, ohne von den geläufigen Werten von Intellekt und Ausdruck vollständig abzurücken." Am Ende ist für Adam auch Oralsex nur eine andere Form der Zungenfertigkeit, ein Versuch, "den Körper mit Sprache zu überziehen", mit dem er seiner Freundin zwar "seine positive Andersartigkeit als Dichter, Protofeminist und demnächst an einer Elite-Uni studierende Alternative zu den Typen" demonstrieren will, die aber im Prinzip nichts anderes ist als eine leicht zu erlernende "Form der Ausdrucksfähigkeit". Sogar das Training dafür (lautes Lesen mit einem zwischen die Zähne geklemmten Stift) ist mit dem fürs Schnellreden identisch.
Sein Buch, so hat es Lerner in einem Interview beschrieben, sei eine "Genealogie der Stimme, die es schreibt", ein Inventar all der Stimmen, die am Ende das ergeben, was man vielleicht als sein Ich bezeichnen könnte: ein Ich, welches ein Mensch, der sich dieser Einflüsse so bewusst ist wie Lerner, deshalb nie als authentisch wahrnimmt. Insofern ist es falsch, ihm seine Selbstbetrachtung als Narzissmus auszulegen; schon eher handelt es sich um den Versuch, die eigene Position, Herkunft, Sprache und deren Grenzen zu benennen. In "Die Topeka Schule" geschieht das, nicht explizit, aber durchaus auch im Sinne dessen, was man critical whiteness nennt, im Bewusstsein also, dass die eigenen Erfahrungen nicht so universell sind, wie es ambitionierte Schriftsteller lange glaubten.
HARALD STAUN.
Ben Lerner: "Die Topeka Schule". Roman. Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl. Suhrkamp, 395 Seiten, 24 Euro Foto Tim Knox / Suhrkamp
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 03.01.2023
Ich fand "Die Topeka Schule" sehr schwer zu lesen. Ich bin mit dem Stil des Autors nicht wirklich warm geworden und fand ihn stellenweise auch sehr gewollt eloquent, zu hochgestochen und zu intellektuell. Das mag passen, wenn man bedenkt, dass Jane und Jonathan Akademiker*innen sind, Psycholog*innen noch dazu, Darren und Adam sind es gleichwohl (noch) nicht und ich fand die Gedankengänge oft unpassend und nicht altersgemäß für Teenager.Die im Klappentext beschriebene Freundschaft zwischen Darren und Adam war für mich nicht erkennbar, dass Jane den erlebten Missbrauch aufarbeitet, erfährt man quasi nebenbei in ihren Sitzungen mit Sima, dass Jonathan nicht aus seiner Rolle als Ehebrecher ausbrechen kann, wirkt fast schon zu konstruiert. Allerdings ist das auch ein wenig bezeichnend für dieses Buch.Ich hatte irgendwann Mühe, es zu Ende zu lesen, habe mich stellenweise ertappt, wie ich Seiten nur quergelesen habe und dann noch einmal lesen musste, weil ich Angst hatte, etwas wirklich Wichtiges verpasst zu haben (habe ich nicht). Die Perspektivwechsel und unterschiedlichen Zeiten, in denen das Buch angesiedelt ist, haben mich zwischenzeitlich ein wenig durcheinander gebracht und ich fand es schwer, dem eigentlichen Handlungsstrang zu folgen. Es gibt einfach zu viele Nebengeräusche.Kurzum: Die Topeka Schule ist ein sehr anspruchsvolles Buch, das man nicht mal eben so zwischendurch lesen kann oder sollte. Für mich war es leider nichts. Schade.
LovelyBooks-Bewertung am 21.03.2022
Gut zu lesen, trotz stilistischen Finessen. Leider hab ich den Plot nicht verstanden oder es gab keinen