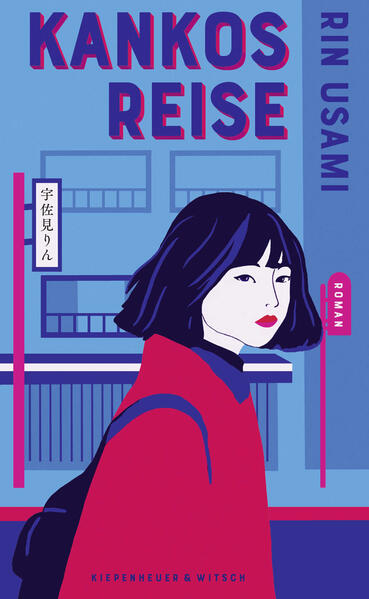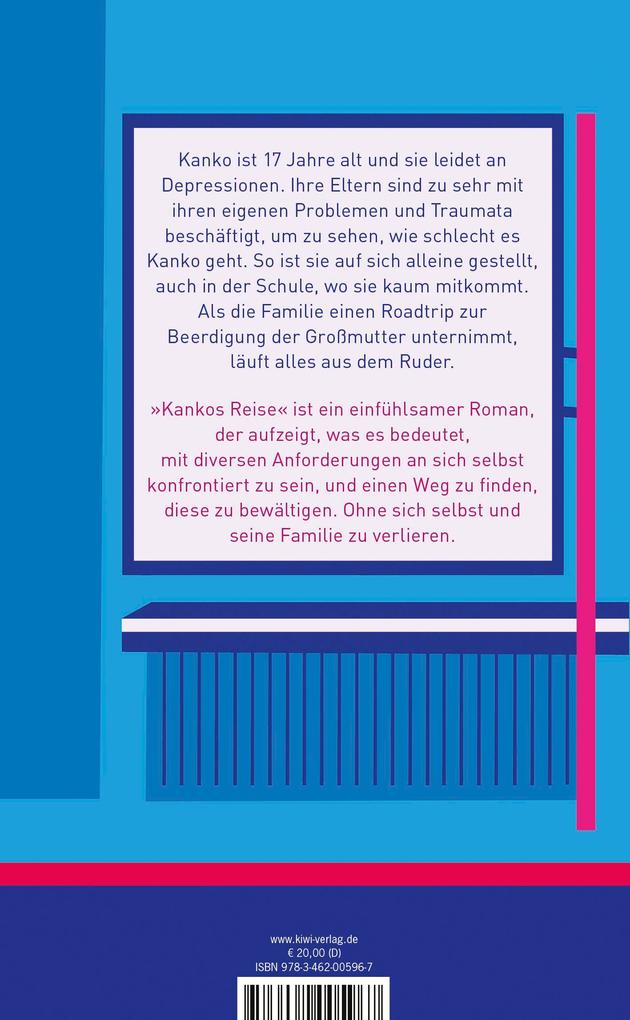Besprechung vom 16.07.2025
Besprechung vom 16.07.2025
Die familiäre Hölle ist butterweich und lauwarm
Das Automobil als schützender Kokon: Rin Usamis intelligenter japanischer Roman "Kankos Reise"
"Es tut weh, wenn die Sonne aufgeht. Es tut weh, wenn sie untergeht . . . So wie die Sonne vom Himmel auf die Erde scheint und zur Lebensenergie unzähliger Geschöpfe wird, regnet auch Gewalt vom Himmel, geht in die Blutbahn über und wird weitergegeben." Die 1999 geborene Schriftstellerin Rin Usami, die für ihr etwas zeitgeistiges Buch "Idol in Flammen" 2021 den Akutagawa-Preis erhielt, ist Japans literarischer Shootingstar und eine Chronistin des Schmerzgedächtnisses der Moderne.
Ihr neues Buch, das in Japan 2022 unter dem Titel "Tochter des Autos" erschien, berührt am Beispiel einer durchschnittlichen Familie Themen wie Leistungsgesellschaft und Dysfunktionalität, Versehrtheit, Verrücktheit und geistige Gesundheit.
Jedes Familienmitglied ist, wie sich zeigt, mit einem Makel behaftet: da wären die 17 Jahre alte depressive Heldin und Schulschwänzerin Kanko, der ältere Bruder und Studienabbrecher Nii, der unter Asthma und Mobbing leidende jüngere Bruder Pon - beide Brüder sind von zu Hause ausgezogen - und zu guter Letzt der ebenso sensible wie gewalttätige Vater und die unter den Folgen eines Schlaganfalls leidende Mutter, die dem Alkohol zugeneigt ist.
Der Tod der Großmutter väterlicherseits gerät zum Aufbruchssignal der Schicksalsgemeinschaft: Es entspinnt sich ein fast fröhlicher Roadtrip zur Trauerfeier in die Provinz nach Katashina in der Präfektur Gunma. Das Besondere ist, dass die Familie wie in früheren Zeiten im Auto übernachtet. Das Auto als Kokon und Huis clos symbolisiert die symbiotische Familie. Doch die "ungesunde Reise" entfremdeter Familienmitglieder zur Trauerfeier der einsam gestorbenen Oma bietet auch Chancen auf Heilung; und unterwegs besuchen sie eine heiße Quelle sowie den Berg Nikko-Shirane.
Usami skizziert Gärprozesse des familiären Unfriedens. Intelligent sinniert sie über "die Familie, diesen Ort, über den weder ein Richter noch ein Gott wacht". Losgelöst von Raum und Zeit ("Sie scheinen alle im roten Abendlicht zu schwimmen, das das Auto flutet"), kommt es zur sukzessiven Annäherung. Bereinigende Wortgefechte werden mit der Beschreibung von glühenden Landschaften untermalt. Usami spielt auch auf das buddhistische Motiv des Feuerwagens ("kasha") an als einen mit Feuer gefüllten Karren, der die Seelen Sündiger zur Hölle trägt. Die Hölle im religiösen wie die säkulare Alltagshölle betreffenden Sinn ist ein Leitmotiv. Die familiäre Hölle sei "butterweich und lauwarm", ihr qualvolles Wesen liege in endloser Repetition: "Leben heißt nur, dass man nicht gestorben ist. Jeder vergisst die Hölle von gestern, um in der Hölle von heute weiterzumachen."
Bei der Ankunft in Katashina kontrastieren die verlogenen Trauerreden mit der Realität der einst ein wildes Leben führenden Großmutter: unter ihren vier Kindern missachtete sie besonders Kankos Vater, wobei auch ihr Mann seinen Zorn über deren ausschweifendes Leben bevorzugt an ihm ausließ. Auf der Trauerfeier prägen zunächst scheinheilige Oberflächlichkeiten die Gespräche unter Verwandten: Schweigen und Aussprache erscheinen gleichermaßen unerträglich.
Zwischen Licht und Erleuchtung beschwört Usami ein synästhetisches Universum: "Als draußen gerade die Straßenlaternen angehen, fängt der Priester an, Sutras zu rezitieren." Die Auszeit auf dem Land und Wanderungen Kankos mit ihrem Bruder Nii in Katashina - ihr ist, "als würde der ganze Berg vor mal lauter, mal leiser werdenden Klängen brodeln und köcheln" - erinnern an belebte Natur in Miyazakis Animes. Ein "Baumtunnel aus ineinander verflochtenen Ästen" symbolisiert Reisen ins Unbewusste. Die Prosa evoziert ein kosmisches In-sich-Fügen der Dinge, Düfte und Klänge.
Der Wunsch nach Rückkehr in eine idealisierte Vergangenheit durchzieht als roten Faden den Roman. So beschließt die Familie zwischen Trauer, Urlaubsreise und Selbstfindung, auf dem Rückweg bei einem früher oft besuchten Freizeitpark vorbeizuschauen. Doch der Versuch, ein glückliches Familienfoto von einst auf einem Karussell nachzustellen, scheitert, erweist es sich doch bei der Ankunft als ausrangiert.
Kathartisches Weinen und Schreien der vulnerablen wie peinigenden Eltern (bei Bekanntgabe von Kankos erfolgreicher Aufnahmeprüfung für die Mittelschule "hörte sie in ihren Stimmen den Schrei eines Neugeborenen, das außer ihr niemanden auf der Welt hat") symbolisieren fließende Grenzen zwischen Eltern und Kindern ("Diese Menschen sind meine Eltern und meine Kinder"). In Lektionen der Empathie eruiert das Buch die Scham darüber, Opfer zu sein, die Wirkmacht der Liebe und Unmöglichkeit, nicht zu verletzen.
Auch Selbstmordvisionen tauchen auf in den "fixen Ideen" Kankos, sich vom Schuldach zu stürzen, oder der Mutter, die Familie in den Unfalltod zu kutschieren.
Kankos Initiationsreise spiegelt Ambivalenzen zwischen dem entgrenzten Freiheitswillen der Moderne und konservativer Tradition. In einer frappanten Volte beschließt Kanko, im Auto zu leben. Kankos Kompromiss evoziert "Amae", das als Freiheit in Geborgenheit bekannte Strukturelement japanischer Psyche. Der Rückzug ins Auto erinnert auch an die Isolation der "Hikikomori", doch ist Kanko nur ein halber Hikikomori. Da sie nun wieder regelmäßig zur Schule geht, umfängt Kankos Moratorium im Automobil auch konstruktive Züge und symbolisiert einen Ausblick auf eine bessere Zukunft.
"Kankos Reise" ist ein wertvolles Stück Healing Fiction in einer gewaltbereiten und kriegstüchtigen Zeit. Sie bietet belletristische Lockerungsübungen für frustrierte Seelen und geballte Fäuste: "Es ist grausam und tut weh, einen Körper zu entspannen, der durch die Gewalt, die der Himmel auf ihn herabregnen ließ, hart geworden ist." STEFFEN GNAM
Rin Usami:
"Kankos Reise".
Roman.
Aus dem Japanischen von Luise Steggewentz. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2025.
176 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.