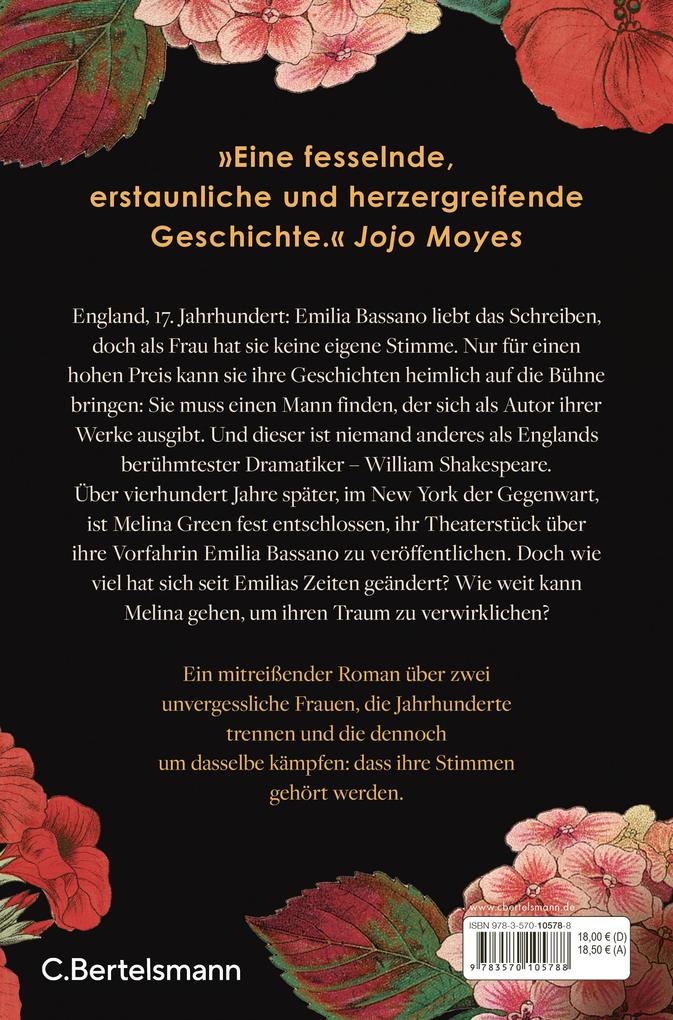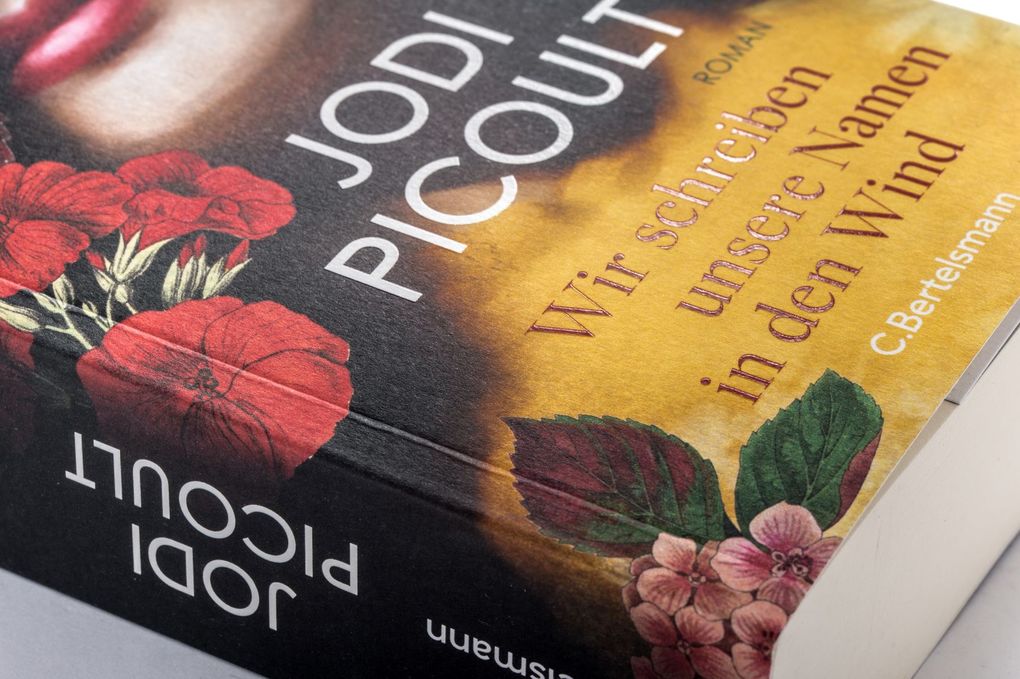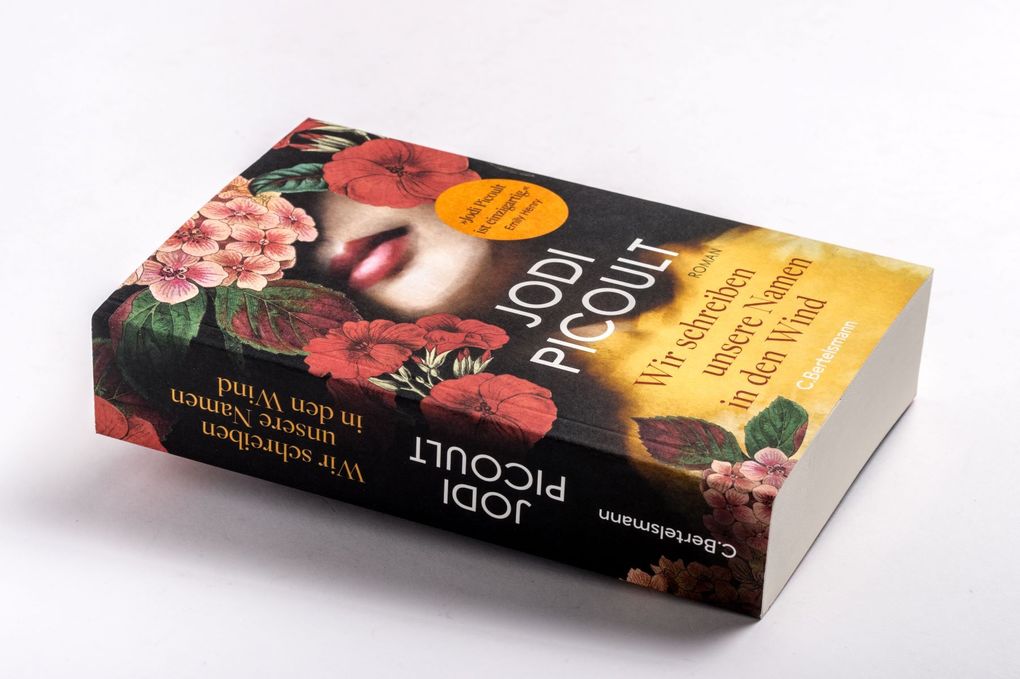Jodi Picoult ist eine Autorin, die gern auf dem schmalen Grat zwischen Unterhaltung und Thesenroman balanciert. In ihrem neuen Werk wagt sie sich an eines der heiligsten Gespenster der Literaturgeschichte: die Frage, ob William Shakespeare tatsächlich der Autor seiner eigenen Werke war. Picoult beantwortet sie mit einer Mischung aus forensischem Eifer und erzählerischem Furor und legt die Feder in die Hand einer Frau: Emilia Bassano, Dichterin, Geliebte des Lord Chamberlain, Zwangsfigur in einem Spiel, in dem Frauen weder auf der Bühne noch hinter dem Schreibtisch vorgesehen sind.Wie so oft spannt Picoult den Bogen über Jahrhunderte. Im zweiten Erzählstrang kämpft Melina Green, angebliche Nachfahrin Emilias und zeitgenössische Dramatikerin, im New Yorker Theaterbetrieb gegen dieselben unsichtbaren Mauern. Die Parallelen sind offensichtlich und bitter zugleich. Fünfhundert Jahre Fortschritt haben wenig daran geändert, dass der Weg für Frauen und erst recht für nichtweiße oder queere Stimmen mit struktureller Geringschätzung gepflastert ist. Picoult arbeitet diese Analogie mit großer Leidenschaft heraus, mal subtil und mal mit der Wucht eines Vorschlaghammers.Die historische Ebene erweist sich als das stärkere Fundament dieses Romans. Picoult hat akribisch recherchiert und fängt den Geruch von Talgkerzen und Druckerschwärze ebenso ein wie den bleiernen Atem einer Gesellschaft, in der weibliche Begabung allenfalls als Staffage geduldet wird. Emilia ist eine Figur, der man glaubt: scharfzüngig, strategisch und verletzlich. Die Gegenwartshandlung hingegen schwankt. Melinas Konflikte, von einer demütigenden Mentor-Beziehung über den Zwang zum männlichen Pseudonym bis hin zum moralischen Slalom zwischen Wahrheit und Karriere, sind glaubwürdig, doch manche Nebenfiguren geraten zu sehr in die Rolle grob gezeichneter Feindbilder.Dass Picoult ihre Shakespeare-These nicht als bloße literarische Schnitzeljagd inszeniert, sondern als Kommentar zur anhaltenden Unsichtbarkeit weiblicher Stimmen, ist der klügste Zug dieses Romans. Ob ihre Beweisführung für Emilia Bassano überzeugt, ist letztlich zweitrangig. Entscheidend ist, dass sie den Leser zwingt, die eigene Bereitschaft zur männlichen Autoritätsgläubigkeit zu hinterfragen. Man kann diesem Buch vorwerfen, dass es zu lang geraten ist, dass es sich in didaktischen Dialogen verfängt und den inneren Motor immer wieder selbst ausbremst. Dennoch ist es schwer, sich dem Ernst und der Dringlichkeit seines Anliegens zu entziehen."Wir schreiben unsere Namen in den Wind" ist nicht Picoults charmantestes Buch, aber vielleicht ihr kompromisslosestes. Es fordert Geduld und die Bereitschaft, sich von einem Roman belehren zu lassen. Wer sich darauf einlässt, wird die Namen, die der Wind davonträgt, nicht so schnell vergessen.