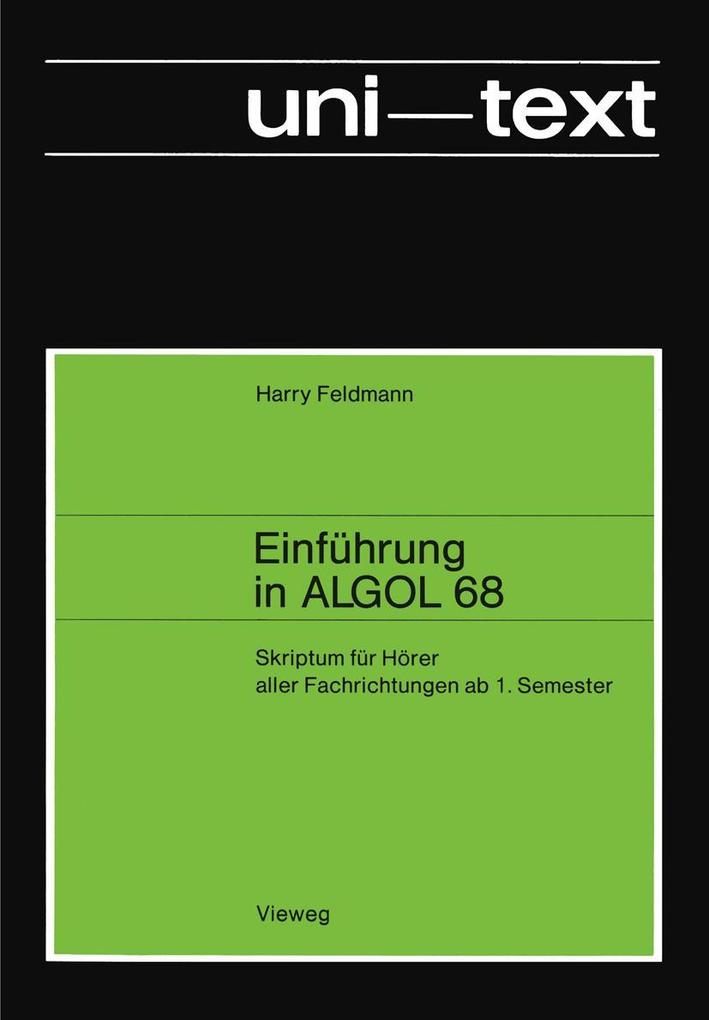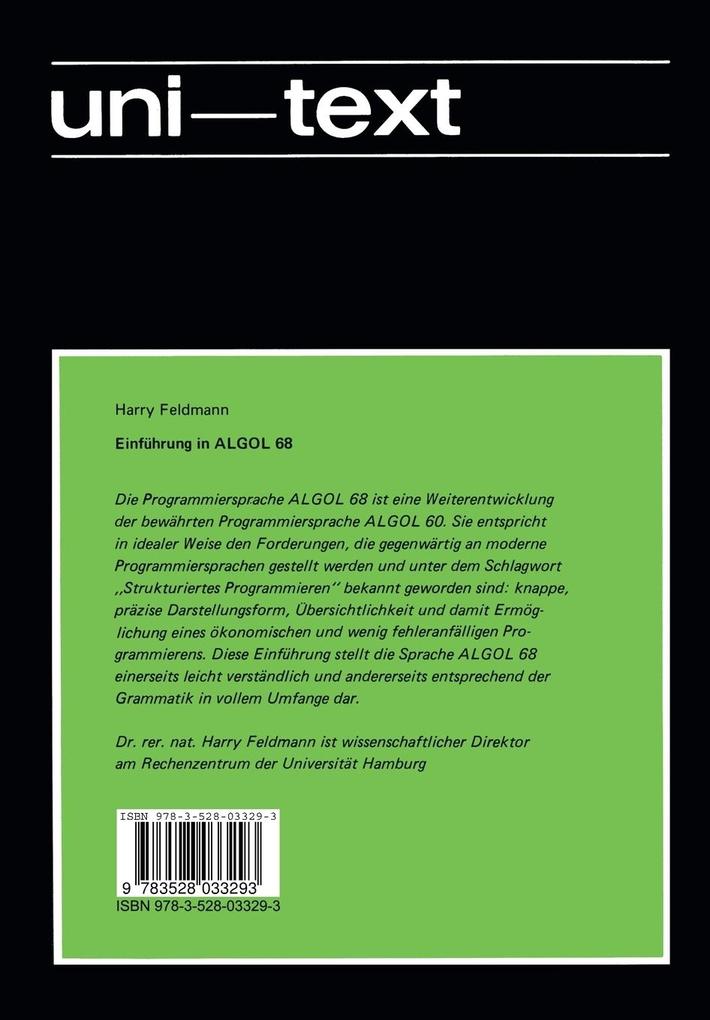in ALGOL 68 Skriptum tür Hörer aller Fachrichtungen ab 1. Semester Vieweg CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek Feldmann, Harry: Einführung in ALGOL 6B [achtundsechzig): Skriptum für Hörer aller Fachrichtungen ab 1. Semester. - 1. Aufl. - Braunschweig: Viewag, 197B. (Uni-Texte: Skripten) Verlagsredaktion: Alfred Schubert 1978 Alle Rechte vorbehalten © Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig, 197B Die Vervielfältigung und Übertragung einzelner Textabschnitte, Zeichnungen oder Bilder auch für die Zwecke der Unterrichtsgestaltung gestattet das Urheberrecht nur, wenn sie mit dem Verlag vorher vereinbart wurden. Im Einzelfall muß über die Zahlung einer Gebühr für die Nutzung fremden geistigen Eigentums entschieden werden. Das gilt für die Vervielfältigung durch alle Verfahren einschließlich Speicherung und jede Übertragung auf Papier, Transparente, Filme, Bänder, Platten und andere Medien. ISBN 978-3-528-03329-3 ISBN 978-3-322-85513-8 (eBook) DOI 10. 1007/978-3-322-85513-8 Vorwort Das vorliegende Skriptum entstand aus Vorlesungen über ALGOL 68, die der Verfasser von 1973 bis 1977 an der Universität Hamburg für Studierende aller Fachrichtungen gehalten hat. ALGOL 68 (algorithmic language, herausgegeben für 1968 von A. van Wijngaarden u. a. m. , revised 1975) ist Nachfolger von ALGOL 60 (herausgegeben für 1960 von P. Naur, revised 1963) und enthält Weiterentwicklungen bewährter Sprachkonstruktionen aus LlSP, PASCAL, PL1, SIMULA u. a. m. wie z. B. Zeichentextverarbeitung, flexibel expandierende Feldlänge, Teilfelder, Strukturen und Verweistechnik. Außerdem wird in (revised) ALGOL 68 erstmalig der Zusammenhang von Vereinbarung und Aufruf insbesondere bei Prozedur-, Parameter-Vereinbarungen, Prioritäten von Operationen und Einführung neuer Arten grammatisch exakt dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
0 Einleitung. - 0. 1 Entwicklung von ALGOL 68. - 0. 2 Einführende Beispiele. - 0. 3 Schreibweisen. - 0. 4 Testfragen. - 1 Objekte (Name, Wert, Art). - 1. 1 Graphische Interpretation von Objekten. - 1. 2 Produktionsschema für name. - 1. 3 Übersichtsschema für Eigenname. - 1. 4 Art eines Objekts. - 1. 5 Testfragen. - 2 Felder und Strukturen. - 2. 1 Felder. - 2. 2 Strukturen. - 2. 3 Testfragen. - 3 Programm, eigentliches Programm. - 3. 1 Übersichtsschema für Programm. - 3. 2 Eigentliches Programm. - 3. 3 Eigentliches Vor- und Nachspiel. - 3. 4 Testfragen. - 4 Geklammerte Klauseln. - 4. 1 Übersichtsschema für ÄRT GEKLAMMERTE Klausel. - 4. 2 Geklammerte serielle Klausel. - 4. 3 Geklammerte kollaterale und synchronisierbare Klausel. - 4. 4 Eigenfeld- und Eigenstruktur-Klausel. - 4. 5 Geklammerte UNTERSCHEIDUNG Klausel. - 4. 6 Schleifen-Klausel. - 4. 7 Testfragen. - 5 Vereinbarungen. - 5. 1 Vereinbarende BENENNUNG. - 5. 2 Zielvereinbarung. - 5. 3 Spezifikationsvereinbarung. - 5. 4 Übersichtsschema für VEBART-Vereinbarung. - 5. 5 Grund-Vereinbarung. - 5. 6 Variablen-Vereinbarung. - 5. 7 Routine-Vereinbarung. - 5. 8 Operations-Vereinbarung. - 5. 9 Vorrang-Vereinbarung. - 5. 10 Art-Vereinbarung. - 5. 11 Vereinbarer. - 5. 12 Erklärer. - 5. 13 Testfragen. - 6 Klauseln. - 6. 1 Übersichtsschema für ÄRT Klausel. - 6. 2 Implizite Konvertierung. - 6. 3 Verweisung. - 6. 4 Verweisidentitätsrelation. - 6. 5 Prozedurtext siehe 7. 2. 1. - 6. 6 Zielaufruf. - 6. 7 Leerklausel. - 6. 8 TERTIÄRKLAUSEL. - 6. 9 SEKUNDÄRKLAUSEL. - 6. 10 PRIMÄRKLAUSEL. - 6. 11 Testfragen. - 7 Bereichsschachtelung und Prozeduren. - 7. 1 Bereichsschachtelung. - 7. 2 Prozeduren. - 7. 3 Testfragen. - 8 Standard-Vereinbarungen (Originalfassung Revised Report). - 8. 1 Abkürzende Schreibweisen. - 8. 2 Abfragbare Rechner-Konstanten etc. - 8. 3 Standard-Arten. - 8. 4 Standard-Vorrang von Operationen. - 8. 5Standard-Operationen. - 8. 6 Standard-Funktionen etc. - 8. 7 Standard-Synchronisierungs-Operationen etc. - 9 Datenübergabe. - 9. 1 Dateien, Kanäle, Geräte (Bücher). - 9. 2 Formatierte Übergabe. - 9. 3 Unformatierte (Standard- Format-) Übergabe. - 9. 4 Binäre Übergabe. - 9. 5 Testfragen. - 10. 1/9 Übungsaufgaben. - A Anhang. - A0 Kurze Einführung in zweischichtige Grammatiken. - A0. 1/2 Definition zweischichtiger Grammatiken. - A0. 3/5 Beispiel. - A1 Metazeichen, Zeichen, Startvokabel (englisch-deutsch). - A1. 1 Metazeichen, Zeichen, Startvokabel. - A2 Schema der Metaregeln (englisch-deutsch). - A2. 1 VOKABELER etc. - A2. 2 ÄRT. - A2. 3 FORMAT. - A2. 4 NUMFORMAT, BITS, BYTES. - A2. 5 KLAUSEL. - A2. 6 NAME. - A2. 7 VEBART etc. - A3 Schema der Hyperregeln (englisch-deutsch). - A3. 1 Programm. - A3. 2 serielle Klausel, kollaterale Klausel. - A3. 3 geklammerte Unterscheidung, Klausel. - A3. 4 Schleifen-Klausel. - A3. 5 vereinbarende BENENNUNG mit NAME, Zielvereinbarung, Spezifikationsvereinbarung. - A3. 6 VEBART-Vereinbarung. - A3. 7/8 VEBART-Vereinbarungstext. - A3. 9 Vereinbarer. - A3. 10 Erklärer. - A3. 12 Implizite Konvertierung. - A3. 13 Klausel. - A3. 14 TERTIÄR-, SEKUNDÄRKLAUSEL. - A3. 15 PRIMÄRKLAUSEL. - A3. 16 GEKLAMMERTE Klausel. - A3. 17/8 Eigenbenennung. - A3. 19 Formattext. - A3. 21 abkürzende Redewendungen. - A3. 22/7 Aussagenformen. - A3. 28 Graph der Aussagenformen. - A4 Darstellung von Symbolvokabeln (englisch-deutsch). - A4. 1 Buchstaben-, Eigennamen-Symbolvokabeln. - A4. 2 Operator-, Vereinbarungs-, Art-Symbolvokabeln. - A4. 3 Programmgliederungs-, Schleifen-, Kompragmentar-Symbolvokabeln. - A4. 4 Zusatzregeln zur Darstellung von Name Symbol. - L Literaturverzeichnis. - L1 Buchliteratur zu Revised ALGOL 68. - L2 Eine Auswahl von Algorithmen-und Aufgabensammlungen. - 11/27 Alphabetischer Index.