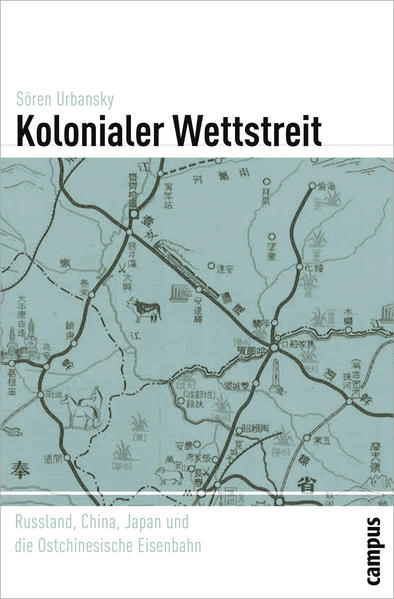Besprechung vom 04.04.2025
Besprechung vom 04.04.2025
Gegenseitige Unterstützung war oft von Nutzen
Die beiden Historiker Sören Urbansky und Martin Wagner folgen der Geschichte des Verhältnisses von China und Russland
Schon einmal von Henricus Sneevliet gehört? Unter dem Decknamen "Maring" war er zunächst Agent im damaligen Niederländisch-Ostindien (heute Indonesien), bevor ihn die kommunistische Führung in Moskau Anfang der Zwanzigerjahre in die chinesische Küstenstadt Shanghai entsandte. Sneevliet sollte aus den dort mittlerweile entstandenen marxistischen Lesezirkeln eine Partei in Lenins Geist formen. Tatsächlich wurde wenig später die Kommunistische Partei Chinas gegründet. Von ihrer späteren Bedeutung war sie noch weit entfernt, zunächst folgten erbitterte Auseinandersetzungen im eigenen Land und ein jahrelanger Krieg gegen Japan. Und auch die Moskauer Unterstützer verhielten sich nicht eindeutig. Sie förderten Mao Zedongs Kommunisten, aber auch die chinesischen Nationalisten um Sun Yat-sen und später Chiang Kai-shek.
Die Episode belegt das vielschichtige Verhältnis zwischen Russland und China, wie es die beiden Historiker Sören Urbansky und Martin Wagner in ihrem Buch ausloten - vom ersten russischen Gesandten, der im August 1618 die chinesische Grenzstadt Kalgan erreichte, bis zum Verhältnis der beiden gegenwärtigen Machthaber Wladimir Putin und Xi Jinping. Dabei ist ihnen nicht nur gelungen, eine komplizierte Beziehung zu erhellen, sondern auch zwei Länder zu charakterisieren, die anscheinend ganz anders funktionieren als das westliche Europa oder Amerika.
Einerseits China, das schon ein multiethnisches Riesenreich mit einer recht weit entwickelten Bürokratie war, als von Russland noch keine Rede war, und sich diplomatisch mit dem Rest der Welt im Wesentlichen über ein strenges Ritual- und Tributsystem verband, aber vor allem auf sich fixiert blieb. Und andererseits ein aufstrebendes Fürstentum namens Moskau, das sich anschickte, den eigenen Geltungsbereich zu vergrößern, und seinen Herrschaftszuschnitt und Machtanspruch mithilfe importierter christlicher Symbolik legitimierte.
An den Ufern des Amur standen sich beide Reiche dann irgendwann gegenüber, weil Russland beständig nach Osten und China nach Westen wuchs, grenzten aneinander und hatten an Ähnlichkeit zumindest etwas gewonnen: Beide waren kontinentale Imperien, beide zentrierten Entscheidungsgewalt in einer Person und einen Hofstaat beziehungsweise Beamtenapparat. Zunächst ging es um Handelsbeziehungen, schnell um Gebietsstreitigkeiten, um Grenzverläufe, um gemeinsame Feinde. Immer wieder eskalierten Konflikte, bis hin zu den ethnischen Säuberungen an Chinesen nahe Blagoweschtschensk im Sommer 1900.
Historisch war zunächst China mächtiger, dann Russland, heute ist es wieder das Reich der Mitte. Es geht um Migration, um Kontrolle, um chinesische Gastarbeiter, die beispielsweise beim russischen Eisenbahnbau helfen, oder eine andersgläubige russische Diaspora auf der chinesischen Seite der Grenze. Die für das gegenwärtige Weltgefüge aufschlussreichsten Passagen sind wenig überraschend diejenigen, die sich mit der Geschichte der beiden Länder im zwanzigsten Jahrhundert befassen, als der letzte chinesische Kaiser abdanken musste und dann im Zarenreich die Revolution ausbrach: als Moskau versuchte, Einfluss zu nehmen auf die Entwicklung des Nachbarn, chinesische Gruppierungen Rat und Anweisungen von dort erbaten, aber zugleich bestrebt waren, sich abzugrenzen. Der Zweite Weltkrieg schließlich erschütterte beide Länder, nirgendwo sonst starben mehr Zivilisten als in Russland oder China.
Gewalt ist eine Erfahrung, die beide Länder teilen. Mongolen, Napoleon und schließlich Hitler überfielen Russland. Engländer, Franzosen, Amerikaner, Russen und Japaner demütigten China militärisch, zerteilten und kolonisierten es. Obwohl von echter Verbundenheit nach den Beschreibungen Urbanskys und Wagners nahezu nie die Rede sein konnte, wird verständlich, warum man einander oft unterstützte. Nicht wegen geteilter Traditionen, sondern weil es vor allem nützlich war und bis heute ist. Man kann bei der Lektüre nachvollziehen, warum China versucht, sich gegenwärtig weitgehend neutral zu verhalten, insbesondere mit Blick auf die Invasion der Ukraine durch Russland.
Und es wird verständlich, warum die chinesische Führung nach Maos Tod entschied, das Land zu öffnen, durch eine gezielte Außenwirtschaftspolitik auf Marktmechanismen zu setzen und so wachsenden Wohlstand zu ermöglichen. Warum die Volksrepublik zur zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und ein wichtiger Exporteur auch anspruchsvoller Industriegüter werden konnte, Hochtechnologie eine dominierende Rolle spielt, Milliardensummen für Künstliche Intelligenz, Halbleiter, Quantencomputer, Raumfahrt und modernste Waffentechnik mobilisiert werden - um nie wieder so wehrlos oder abhängig zu sein wie in den letzten hundertfünfzig Jahren der Kaiserzeit. Deutlich schwerer nachvollziehbar ist hingegen, warum Russland demgegenüber ziemlich stagnierte und ein weltwirtschaftlicher Winzling geblieben ist - und die Russen ihre heutige Führung akzeptieren, die Abnutzungskriege als politisches Mittel wählt und dem Militärischen so großen Raum gewährt. ALEXANDER ARMBRUSTER
Sören Urbansky und Martin Wagner: "China und Russland". Kurze Geschichte einer langen Beziehung.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2025. 329 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.