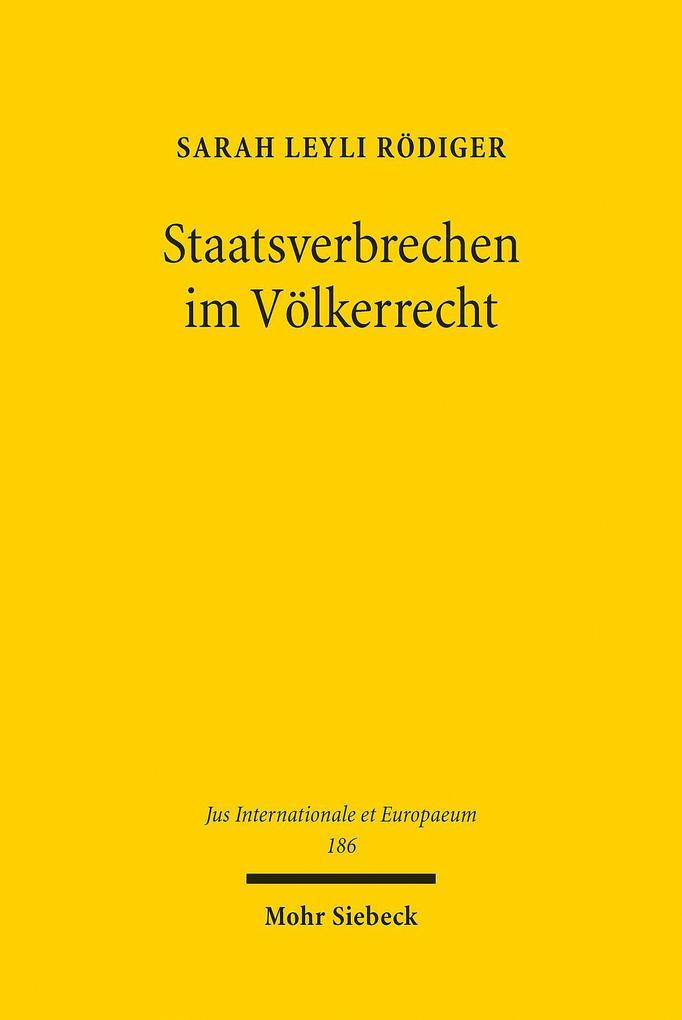Menschenrechtsorganisationen machen durch Interventionen beim Internationalen Strafgerichtshof die Öffentlichkeit auf Verbrechen von Staaten des Globalen Nordens aufmerksam. Dabei nutzen die zivilen Akteure das Recht als Instrument, um breite Prozesse der Aufarbeitung von Staatsverbrechen zu initiieren.
Staatsverbrechen wie Ökozide, Migrations- oder Kriegsverbrechen sind jüngst durch zivilgesellschaftliches Engagement in das öffentliche Bewusstsein gelangt. Menschenrechtsorganisationen reichen Strafanzeigen bei Gericht ein, um öffentliche Debatten anzuregen. Mit ihren Interventionen vor dem Internationalen Strafgerichtshof machen sie die Öffentlichkeit auf Verbrechen des Globalen Nordens aufmerksam, die bislang wenig sichtbar sind. Diese strategische Prozessführung verfolgt einen rechtlichen und sozialen Wandel. Dabei nutzen zivile Akteure das Recht als Werkzeug, um breite Aufarbeitungsprozesse zu initiieren. Zugleich geraten die Akteure weltweit unter Druck und ihre Handlungsräume werden zunehmend eingeschränkt. Starke Zivilgesellschaften haben eine menschenrechtsschützende Funktion, insoweit sind völkerrechtliche Strategien zur Einbindung im Kontext der Aufarbeitung wichtig.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Erster Teil: Der Staat als Akteur der Verbrechenserzeugung und Verbrechensaufarbeitung
Kapitel 1: Staatsverbrechen und Völkerrecht
Kapitel 2: Staatsverbrechen als kriminologisches Konzept
Kapitel 3: Staatsverbrechen als Paradoxon
Zweiter Teil: Aufarbeitung von Staatsverbrechen
Kapitel 4: Konzeption von Aufarbeitung im Völkerrecht
Kapitel 5: Staatsimmanente Defizite
Kapitel 6: Völkerrechtsbezogene Defizite
Dritter Teil: Kontrollmechanismen
Kapitel 7: Zivilgesellschaftliche Organisationen in der Völkerrechtsordnung
Kapitel 8: Zivilgesellschaftliche Interventionen als Initiatoren von Aufarbeitungsprozessen
Kapitel 9: Handlungsspielräume zivilgesellschaftlicher Interventionen
Schluss: Völkerrechtlicher Rahmen einer erweiterten Aufarbeitung von Staatsverbrechen