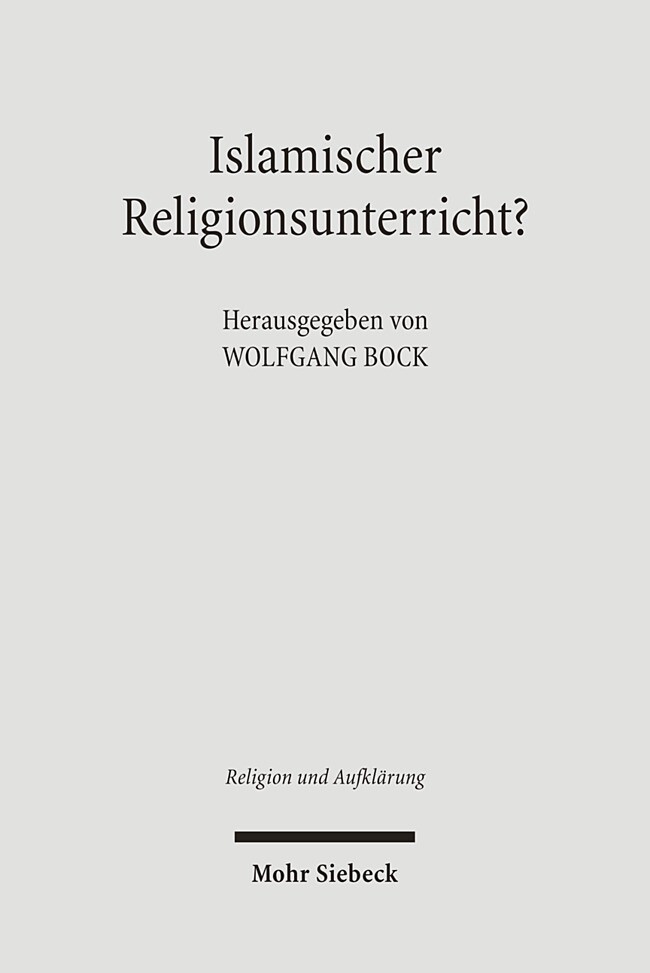Die Einführung Islamischen Religionsunterrichts ist mit erheblichen rechtlichen und tatsächlichen Problemen verbunden, die wesentlich in den religiösen und politischen Strukturen des Islam und dessen Bewertung liegen. Die rechts-, islam- und sozialwissenschaftlichen Untersuchungen dieses Bandes zeigen, daß erste Schritte hin zu einem Religionsunterricht im Sinne des Grundgesetzes schulrechtlich möglich, verfassungsrechtlich abgesichert und rechtspolitisch sinnvoll sind.
This collection of articles presents the results compiled by a task force of legal experts and theologians at the FEST (Protestant Institute for Interdisciplinary Research) in Heidelberg on the question of religious instruction in Islam. The problems that arise are a result of traditionally underdeveloped organizational structures in Islam as well as its political and religious diversity. In the first part of the work, two controversial theories are presented. Whereas the first theory takes a sceptical-critical view, the second advocates careful steps toward reform along the lines of religious instruction in Islam. In the second part, reports from the individual federal states explain their legal policies pertaining to primary and secondary schools education. The federal states have all developed their own individual models which range from the study of Islam (which contains no elements of a specific profession of this faith) to religious instruction in Islam. Der Sammelband präsentiert die Ergebnisse einer mehrjährigen Forschungsarbeit einer juristisch-theologischen Arbeitsgruppe an der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST, Heidelberg) zur Frage eines Islamischen Religionsunterrichts. Der Einführung Islamischen Religionsunterrichts als ordentliches Lehrfach im Sinne des Grundgesetzes stehen ernsthafte tatsächliche und rechtliche Hindernisse entgegen. Sie ergeben sich sowohl aus der traditionell wenig entwickelten Organisationsstruktur des Islam als auch aus seiner politischen und religiösen, vom Sufismus bis zum terroristischen Extremismus reichenden Vielfalt. Unterschiedliche Bewertungen dieser religiösen und politischen Strukturen, aber auch wesentlich voneinander differierende rechtspolitische Strategien der Bundesländer im Bereich des Religionsunterrichts führen zu divergenten Rechtsauffassungen. Vor dem Hintergrund einer Darstellung dieser auch islamwissenschaftlichen und religionssoziologischen Grundfragen werden im ersten Teil zwei einander kontrovers gegenüberstehende rechtswissenschaftliche Thesenreihen entwickelt. Während die erste für eine skeptisch-kritische Auffassung eintritt, plädiert die zweite trotz des Fehlens eines organisierten islamischen Ansprechpartners für vorsichtige Reformschritte in Richtung auf einen Islamischen Religionsunterricht. Die im zweiten Teil enthaltenen Länderberichte legen die unterschiedlichen Ausgangspunkte, Ziele und vorläufigen Ergebnisse der jeweils landesspezifischen Schulrechtspolitik dar. Islamkunde (ohne Elemente des religionsspezifischen Bekennens) oder Islamischer Religionsunterricht, zwischen diesen beiden Polen entwickeln die meisten Bundesländer eigene Modelle. Den Abschluss des Bandes bildet eine von der Forschungsgruppe erarbeitete und verabschiedete rechtspolitische Erklärung zu den mit der Einführung Islamischen Religionsunterrichts verbundenen Schwierigkeiten.
Inhaltsverzeichnis
I. Rechtsfragen
Wolfgang Bock : Islamischer Religionsunterricht oder Religionskunde - Stefan Korioth : Islamischer Religionsunterricht und Art. 7 Abs. 3 GG - Mathias Rohe : Rahmenbedingungen der Anwendung islamischer Normen in Deutschland und Europa
II. Länderberichte
Barbara Lichtenthäler : Islamische Religion im schulischen Unterricht: Baden-Württemberg - Ulrich Seiser und Dieter Schütz : Islamische Religion im schulischen Unterricht: Bayern - Wolfgang Bock : Islamischer Religionsunterricht im Lande Berlin - Franz Köller : Rechtliche Probleme im Zusammenhang mit der Einführung eines islamischen Religionsunterrichts in Hessen - Rolf Bade : " Islamischer Religionsunterricht" - ein niedersächsischer Versuch - Ulrich Pfaff : Zur Situation des Islamunterrichts in Nordrhein-Westfalen
III. Hintergründe
Thomas Lemmen : Muslimische Spitzenverbände in Deutschland: Ansprechpartner für einen islamischen Religionsunterricht? - Herbert L. Müller : Islamistische " Gegenwelten" - Versuch einer kritischen Annäherung - Reinhard Hocker : Erfahrungen und Orientierungen junger muslimischer Migranten - Peter Müller : Religionspädagogische Prolegomena für die Entwicklung eines Curriculums Islamischer Religionsunterricht
IV. Anhang
Arbeitsgruppe Kirchenrecht und Staatskirchenrecht: Empfehlung zum Islamischen Religionsunterricht